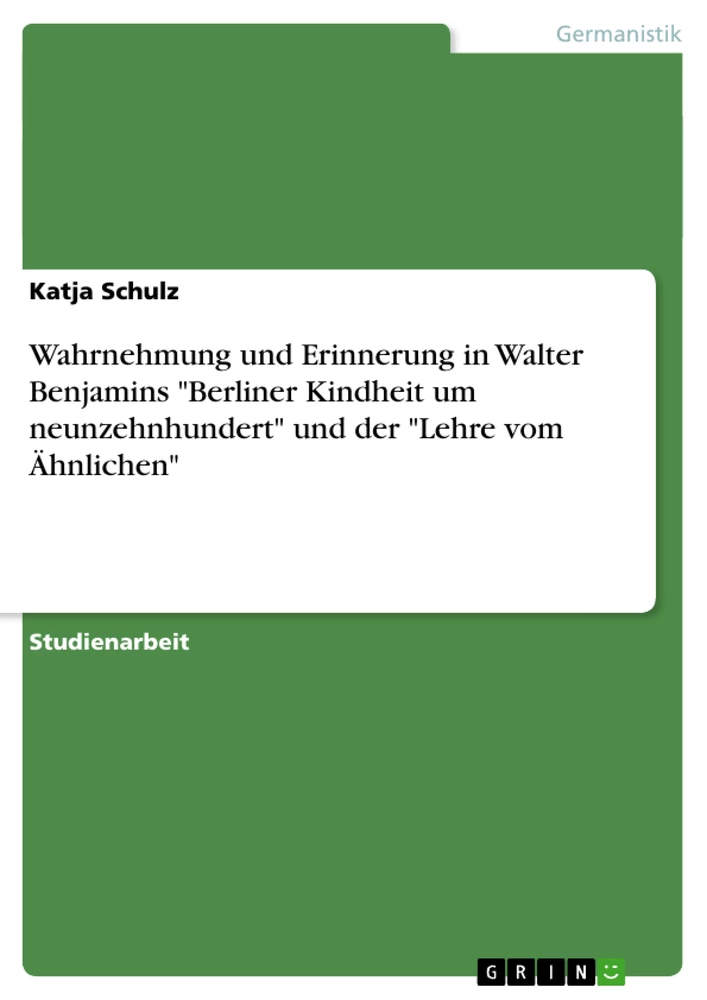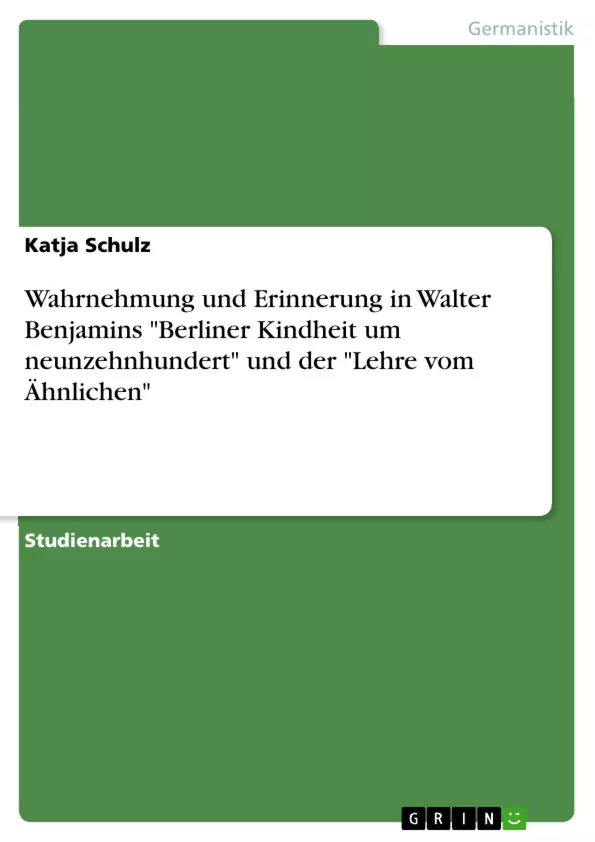Im Gegensatz zu der Unbekanntheit in seinen letzten Lebensjahren, die Walter Benjamin im Exil verbrachte, gehört sein Werk „mittlerweile zum Grundinventar der geisteswissenschaftlichen Diskurse“. Dabei wurde auf sehr unterschiedliche Weise versucht, der thematischen und formalen Heterogenität und Reichhaltigkeit in den Arbeiten Benjamins Rechnung zu tragen. In der Folge kam es zu einer breiten Auseinandersetzung mit Benjamin, die fast alle geisteswissenschaftlichen Fächer ergriff und dazu führte, dass sich die verschiedensten theoretischen Richtungen auf ihn berufen.
Die vorliegende Untersuchung wird die beiden eng zusammenhängenden Arbeiten Benjamins, die Berliner Kindheit um neunzehnhundert und die spätere Sprachphilosophie Lehre vom Ähnlichen und Über das mimetische Vermögen zum Gegenstand haben. In der Forschung wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass es Parallelen und Zusammenhänge zwischen diesen beiden Arbeiten gibt.
Es wird herausgearbeitet, wie die Auseinandersetzung Benjamins mit dem eigenen Schreiben im Zusammenhang mit der Berliner Kindheit zu der theoretischen Formulierung einer Sprachtheorie in der Lehre vom Ähnlichen geführt hat. Zu diesem Zwecke werde ich zunächst die Erkenntnisse von Sigmund Freud und Jean Piaget zusammenfassen, da diese großen Einfluss auf die Berliner Kindheit hatten. Im folgenden werde ich zeigen, inwiefern sich diese beiden Arbeiten auf die literarische Umsetzung der Kindheitserinnerungen ausgewirkt haben. Im letzten Abschnitt wird dann eine Brücke zur Sprachtheorie geschlagen, in der aufgrund der Diskrepanz zwischen der Erinnerung des Erwachsenen und der Wahrnehmung des Kindes eine ontogenetische Entwicklung des mimetischen Vermögens konstatiert wird. Diese Entwicklung findet nach Benjamin eine Entsprechung in der phylogentischen Dimension des mimetischen Vermögens und bildet somit einen Ansatz für die Sprachtheorie.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Das Werk Walter Benjamins
- 1.2. Gang der Arbeit
- 2. Entstehungshintergründe und Zusammenfassung
- 2.1. „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“
- 2.2. „Lehre vom Ähnlichen“ und „Über das mimetische Vermögen“
- 3. Erinnerung und Wahrnehmung nach Sigmund Freud und Jean Piaget
- 3.1. Erinnerung und Traum bei Freud
- 3.1.1. Der seelische Apparat
- 3.1.2. Die Traumarbeit
- 3.1.3. Die Traumanalyse
- 3.2. Sprachverhalten und Logik des Kindes nach Jean Piaget
- 3.2.1. Synkretistisches Denken
- 3.2.2. Verbaler Synkretismus
- 4. Darstellungsmerkmale der Kindheitserinnerungen
- 4.1. Erinnerungen des Erwachsenen
- 4.2. Wahrnehmungsweisen des Kindes
- 4.3. sprachliche Gestaltungsmerkmale
- 5. Die Lehre vom Ähnlichen vor dem Hintergrund der Berliner Kindheit
- 5.1. ontogenetische Dimension des mimetischen Vermögens
- 5.2. phylogenetische Dimension des mimetischen Vermögens
- 5.3. Magische Lektüre und Traumdeutung
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Walter Benjamins „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“ und seiner „Lehre vom Ähnlichen“. Ziel ist es, den Einfluss von Freuds und Piagets Theorien auf Benjamins literarische Darstellung von Kindheitserinnerungen aufzuzeigen und die daraus resultierende Entwicklung seiner Sprachtheorie zu beleuchten.
- Der Einfluss von Freud und Piaget auf Benjamins Werk
- Die Darstellung von Erinnerung und Wahrnehmung in „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“
- Die Entwicklung des mimetischen Vermögens: ontogenetische und phylogenetische Dimension
- Die Beziehung zwischen autobiographischem Schreiben und Sprachtheorie bei Benjamin
- Die literarische Umsetzung von Kindheitserinnerungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Werk Walter Benjamins und seine vielschichtige Rezeption in der Geisteswissenschaft. Es hebt die Komplexität seines Denkens hervor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“ und die „Lehre vom Ähnlichen“ in Beziehung setzt. Die heterogene Natur von Benjamins Werk und die unterschiedlichen Interpretationsansätze werden diskutiert, um den Kontext der vorliegenden Untersuchung zu etablieren.
2. Entstehungshintergründe und Zusammenfassung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte von Benjamins „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“ und der „Lehre vom Ähnlichen“. Es beschreibt die „Berliner Kindheit“ als eine Sammlung von kurzen Erinnerungsepisoden, die autobiografische, poetologische und gesellschaftskritische Elemente verbindet. Die „Lehre vom Ähnlichen“, als Sprachtheorie, wird im Kontext eines Briefes an Scholem erläutert, der die Entstehung dieser Theorie während der Arbeit an der „Berliner Kindheit“ beschreibt. Die Kapitel skizzieren also die genesis beider Werke und deren enge Verbundenheit.
3. Erinnerung und Wahrnehmung nach Sigmund Freud und Jean Piaget: Dieses Kapitel fasst die relevanten Theorien von Sigmund Freud (Erinnerung, Traum, seelischer Apparat) und Jean Piaget (Sprachverhalten und Logik des Kindes) zusammen. Es wird dargelegt, wie diese Theorien Benjamins Verständnis von Erinnerung und Wahrnehmung und damit seine literarische Darstellung der Kindheit beeinflusst haben. Die Kapitel befassen sich ausführlich mit Freuds Konzept der Traumarbeit und Piagets Erkenntnissen über das synkretische Denken von Kindern. Diese psychologischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen dienen als interpretatorische Werkzeuge für die nachfolgende Analyse von Benjamins Texten.
4. Darstellungsmerkmale der Kindheitserinnerungen: Dieses Kapitel analysiert die literarischen Merkmale der „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“, indem es die Perspektive des erwachsenen Erinnernden mit der Wahrnehmung des Kindes kontrastiert. Es untersucht, wie Benjamin sprachliche Mittel einsetzt, um die spezifischen Wahrnehmungsweisen des Kindes darzustellen. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachliche Gestaltung, um die besondere Art und Weise zu beleuchten, wie Benjamin Erinnerungen literarisch umsetzt und die spezifische Perspektive der Kindheit einfängt. Die Kapitel untersucht die Diskrepanz zwischen der Erinnerung des Erwachsenen und der Wahrnehmung des Kindes.
5. Die Lehre vom Ähnlichen vor dem Hintergrund der Berliner Kindheit: Dieses Kapitel stellt den zentralen Zusammenhang zwischen Benjamins „Berliner Kindheit“ und seiner „Lehre vom Ähnlichen“ her. Es analysiert, wie die Diskrepanz zwischen der Erinnerung des Erwachsenen und der Wahrnehmung des Kindes in der „Berliner Kindheit“ eine ontogenetische Entwicklung des mimetischen Vermögens impliziert. Diese Entwicklung wird dann in ihrer phylogenetischen Dimension untersucht, um den Bezug zur Sprachtheorie herzustellen. Das Kapitel zeigt somit, wie die literarische Auseinandersetzung mit der Kindheitserinnerung die theoretische Entwicklung der Sprachtheorie beeinflusst hat.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Berliner Kindheit um neunzehnhundert, Lehre vom Ähnlichen, mimetisches Vermögen, Erinnerung, Wahrnehmung, Sigmund Freud, Jean Piaget, Kindheit, Sprachtheorie, ontogenetische Entwicklung, phylogenetische Entwicklung, autobiographisches Schreiben, literarische Darstellung.
Häufig gestellte Fragen zu Walter Benjamins "Berliner Kindheit um neunzehnhundert" und der "Lehre vom Ähnlichen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Walter Benjamins autobiographischem Werk "Berliner Kindheit um neunzehnhundert" und seiner sprachtheoretischen Konzeption der "Lehre vom Ähnlichen". Sie analysiert den Einfluss von Freuds und Piagets Theorien auf Benjamins Darstellung von Kindheitserinnerungen und die daraus resultierende Entwicklung seiner Sprachtheorie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Darstellung von Erinnerung und Wahrnehmung in Benjamins "Berliner Kindheit", den Einfluss von Freud und Piaget auf sein Werk, die Entwicklung des mimetischen Vermögens (ontogenetisch und phylogenetisch), die Beziehung zwischen autobiographischem Schreiben und Sprachtheorie bei Benjamin, sowie die literarische Umsetzung von Kindheitserinnerungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einführung, ein Kapitel zu den Entstehungshintergründen von "Berliner Kindheit" und der "Lehre vom Ähnlichen", ein Kapitel zu den relevanten Theorien von Freud und Piaget, ein Kapitel zur Analyse der Darstellungsmerkmale der Kindheitserinnerungen in Benjamins Text, ein Kapitel zum zentralen Zusammenhang zwischen "Berliner Kindheit" und der "Lehre vom Ähnlichen", und abschließend eine Zusammenfassung.
Welche Rolle spielen Freud und Piaget in der Analyse?
Die Theorien von Sigmund Freud (Erinnerung, Traum, seelischer Apparat) und Jean Piaget (Sprachverhalten und Logik des Kindes) dienen als interpretatorische Werkzeuge. Die Arbeit untersucht, wie diese Theorien Benjamins Verständnis von Erinnerung und Wahrnehmung beeinflusst haben und sich in seiner literarischen Darstellung der Kindheit niederschlagen.
Was ist die "Lehre vom Ähnlichen"?
Die "Lehre vom Ähnlichen" ist eine sprachtheoretische Konzeption Benjamins, die in engem Zusammenhang mit seiner "Berliner Kindheit" steht. Die Arbeit beleuchtet, wie die Diskrepanz zwischen der Erinnerung des Erwachsenen und der Wahrnehmung des Kindes in der "Berliner Kindheit" eine ontogenetische und phylogenetische Entwicklung des mimetischen Vermögens impliziert, welche die Grundlage der "Lehre vom Ähnlichen" bildet.
Wie werden die Kindheitserinnerungen in der Arbeit analysiert?
Die Analyse der Kindheitserinnerungen konzentriert sich auf die literarischen Merkmale von Benjamins "Berliner Kindheit". Es wird die Perspektive des erwachsenen Erinnernden mit der Wahrnehmung des Kindes kontrastiert und die sprachliche Gestaltung der Erinnerungen untersucht, um die spezifische Art und Weise zu beleuchten, wie Benjamin die Perspektive der Kindheit literarisch umsetzt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt den engen Zusammenhang zwischen Benjamins autobiographischem Schreiben ("Berliner Kindheit") und seiner sprachtheoretischen Entwicklung ("Lehre vom Ähnlichen"). Sie verdeutlicht, wie die Auseinandersetzung mit Kindheitserinnerungen und die Berücksichtigung psychologischer und entwicklungspsychologischer Theorien (Freud, Piaget) Benjamins Sprachtheorie maßgeblich beeinflusst haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Walter Benjamin, Berliner Kindheit um neunzehnhundert, Lehre vom Ähnlichen, mimetisches Vermögen, Erinnerung, Wahrnehmung, Sigmund Freud, Jean Piaget, Kindheit, Sprachtheorie, ontogenetische Entwicklung, phylogenetische Entwicklung, autobiographisches Schreiben, literarische Darstellung.
- Quote paper
- Dipl.-Kauffrau Katja Schulz (Author), 2009, Wahrnehmung und Erinnerung in Walter Benjamins "Berliner Kindheit um neunzehnhundert" und der "Lehre vom Ähnlichen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134940