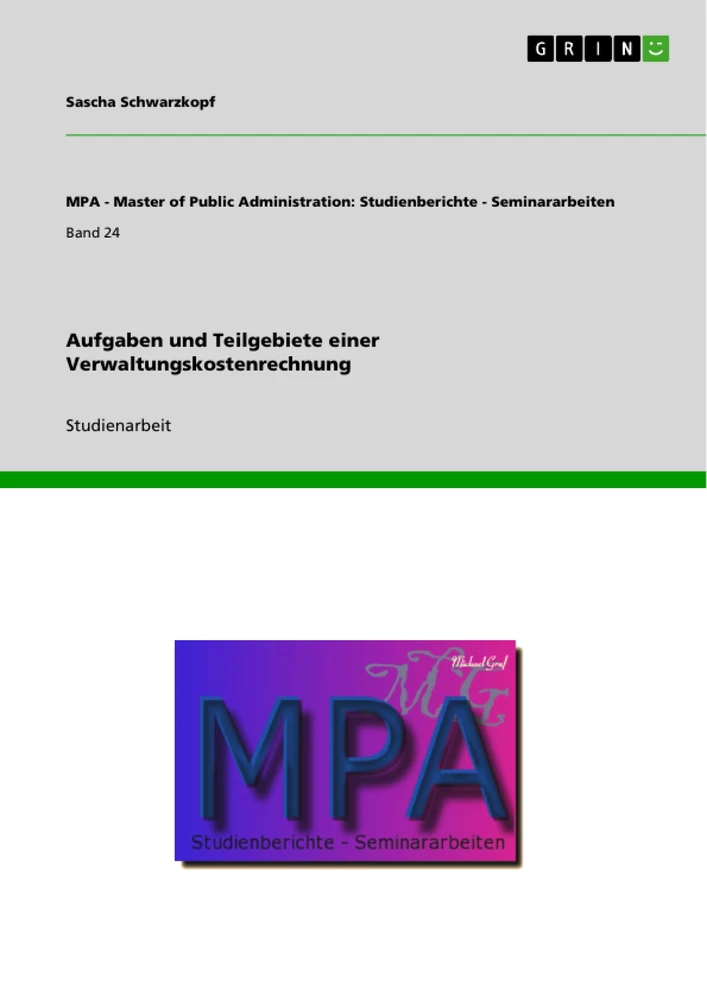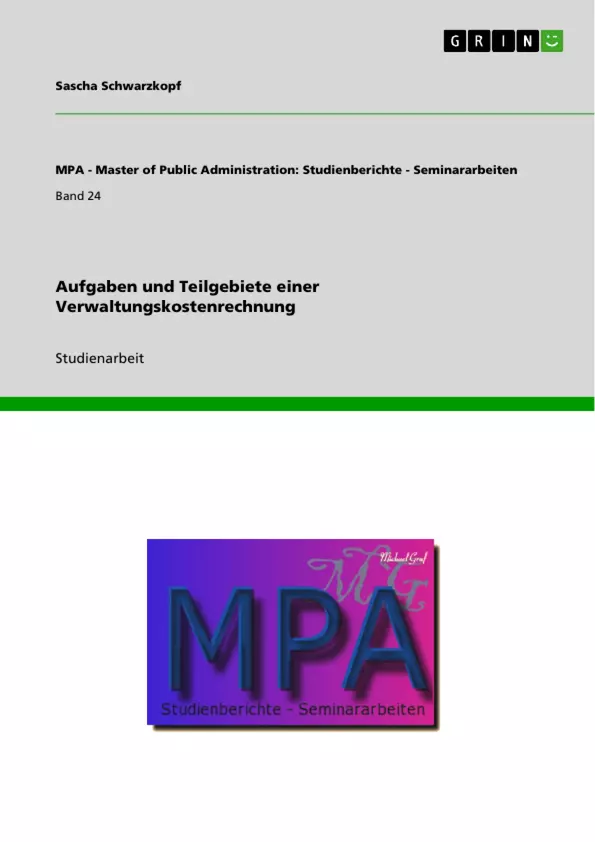Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Aufgaben und Teilgebieten der (Verwaltungs-)Kostenrechnung. Neben einer kurzen Einführung in die Thematik im Kontext der Entwicklungen auf diesem Gebiet seit den 1970er Jahren, werden die Aufgaben (Kostenermittlung der Verwaltungsleistungen, Ermittlung von Erfolgsbeiträgen, Wirtschaftlichkeitsüberwachung, Grundlage für Entscheidungen, Outputorientierte Budgetierung, Grundlage für eine Gebührenkalkulation) und die Teilgebiete der Kostenrechnung (Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Kostenrechnungssysteme) dargestellt. Die Ausführungen erscheinen im Kontext staatlichen Verwaltungshandelns
Inhaltsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis
1. Die Verwaltungskostenrechnung – Übel oder Notwendigkeit?
1.1 Einführung in die Problematik
1.2 Die (Verwaltungs-)Kostenrechnung – Was ist das?
1.3 Normative Aspekte einer Verwaltungskostenrechnung
2. Aufgaben der Verwaltungskostenrechnung
2.1 Kostenermittlung der Verwaltungsleistungen
2.2 Ermittlung von Erfolgsbeiträgen
2.3 Wirtschaftlichkeitsüberwachung
2.3.1 Zeitvergleich
2.3.2 Benchmarking
2.3.3 Plan-Ist-Vergleich
2.4 Grundlage für Entscheidungen
2.5 Outputorientierte Budgetierung
2.6 Grundlage für eine Gebührenkalkulation
3. Teilgebiete der Verwaltungskostenrechnung
3.1 Die Kostenartenrechnung
3.2 Die Kostenstellenrechnung
3.3 Die Kostenträgerrechnung
3.4 Kostenrechnungssysteme
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Abkürzungsverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Die Verwaltungskostenrechnung – Übel oder Notwendigkeit?
1.1 Einführung in die Problematik
Am Anfang einer wissenschaftlichen Arbeit steht immer die Problem- oder Fragestellung, dessen Beantwortung sich der Verfasser versucht zu bemühen. Im vorliegenden Fall gilt es eine arg gefestigte Grundannahme über das ökonomische und effiziente Leistungspotenzial der öffentlichen Verwaltung in der Öffentlichkeit auf den Prüfstand zu bitten. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Ausgestaltung, den Aufgaben und Teilgebieten einer Verwaltungskostenrechnung. Befasst man sich mit der für nicht Verwaltungs- oder Betriebswissenschaftler eher trocken anmutenden Materie genauer, so zeichnet sich recht schnell ein differenzierteres und durchaus facettenreiches Bild des Verwaltungshandelns, sofern die Instrumente der „Neuen Steuerung“ beherrscht und angewendet werden.
Bereits in den 1970er Jahren (und vermutlich auch früher[1] ) war der vermeintlich sinnlos den Staatshaushalt verschlingende Störfaktor als Hemmnis eines boomenden Aufschwungs schnell ausgemacht: die öffentliche Hand.
„Wie leistungsfähig ist nun dieser Krüppel ?“[2], war schon vor gut 35 Jahren die meist sarkastische und rhetorische Fragestellung in der Fachpresse. Mit Kritik wird im Allgemeinen nicht lange gezaudert, wenn man staatliches Handeln - und indirekt die Leistungsfähigkeit der die Staatsmacht ausführende Dienerschaft - polemisch beschreibt. So führt der in der gleichen zeitlichen Epoche anzusiedelnde Fachjournalist Hermann MARCUS aus:
„Der öffentliche Dienst entzieht in seinen heutigen Organisationsformen und seiner verschwenderischen Ausstattung mit Personal, in seiner mangelnden Koordination innerhalb und zwischen den Behörden und seinem starren Festhalten an überflüssigen Instanzen und Instanzenzügen wenigstens eine halbe Million, vielleicht sogar eine dreiviertel Million Vollarbeitskräfte einer produktiven Tätigkeit zum Schaden der gesamtwirtschaftlichen Leistung.“[3]
Diese Form von Kritik ist auch heute noch populär, selbst am Inhalt der Argumentationskette scheint sich nichts geändert zu haben. Hinzu kommt, dass bei kritischer Betrachtung der zahlreichen Verwaltungsmodernisierungsbemühungen in Deutschland und deren tatsächlichen Wirkungen der Anschein erweckt wirkt, dass Modernisierungsvorhaben der öffentlichen Verwaltung lediglich um des „Reformierungswillens“ initiiert werden und auf diese Weise versucht wird, sich selbst den Nimbus von Modernität zuzulegen[4].
Bei nüchterner Betrachtung stellt der aufmerksame Leser dieser Kommentare fest, dass die vorgebrachte Kritik pauschalisiert und zu wenig auf einzelne Verwaltungszweige bezogen wird. Diese Form der Kritik gibt keinen Hinweis darauf, an welcher Stelle es Optimierungsansätze im Einzelnen gäbe. Sie weckt lediglich bestimmte Emotionen und lässt den Rückschluss auf einen gewissen Grad von Populismus und Polemik zu[5]. Dabei scheint die öffentliche Verwaltung zum Teil selbst eine Mitschuld an diesem Dilemma zu haben. Lange Zeit verstand man sich selbst als Obrigkeitsverwaltung, ohne hierbei in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit Rechenschaft über das eigene Verwaltungshandeln und die Art und Weise der Prozesse zur Leistungserstellung darzulegen. Zu Zeiten voller Haushaltskassen mag dieses Verhalten nicht ins Gewicht fallen, jedoch nun um so mehr, als dass in den letzten beiden Jahrzehnten die öffentliche Verwaltung aufgrund von wachsender Ressourcenknappheit in den einzelnen betrieblichen Produktionsfaktoren und mangelhaften Kompetenz-ausgestaltungen der Mitarbeiter immer zentraler in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist. Verschärft wird dieser Aspekt noch um den Umstand der träge voranschreitenden Förderalismusreform.
Transparenz öffentlichen Handelns wird nun allerorten gefordert und selbst in der Kommunalpolitik täte ein Bürgermeister einer Gemeinde gut daran, geplante Maßnahmen - vor allem kostenintensive Vorhaben - transparent und nachvollziehbar der breiten Öffentlichkeit seiner Gemeinde offenzulegen. Dabei ist die vorgebrachte Systemkritik durchaus keine nationale Erscheinung. Überall auf der Welt wird am Nimbus des unfehlbaren Staates gerüttelt.
Doch sollte man nicht allzu vorschnell den Stab über die öffentliche Hand brechen, denn in den letzten Jahren hat die Verwaltungsmodernisierung in Deutschland zumindest das Bewusstsein ökonomischen und effizienten Handelns der Verantwortlichen geweckt. Moderne betriebswirtschaftliche Methoden werden nach und nach in den Bereich der öffentlichen Verwaltung adaptiert oder auf die Bedürfnisse staatlichen Handelns angepasst (z.B. Übergang von der Kameralistik zur Doppik, Neue Steuerungsmodelle, ganzheitliche Managementsysteme etc.). Eines dieser Systeme ist dagegen gar nicht so neu und eigentlich ein „alter Hut“, ohne jedoch dabei an Aktualität zu verlieren: die Verwaltungskostenrechnung.
1.2 Die (Verwaltungs-)Kostenrechnung - Was ist das?
Die Kostenrechnung „ist die systematisierte Erfassung und Darstellung der Kosten nach Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern. Den Kosten sind die Leistungen gegenüber zu stellen. Zusätzlich ist die Erfassung der Wirkungen durch eine Wirkungsrechnung erforderlich, weil erst damit beurteilt werden kann, ob die Verwaltung ihren Auftrag erfüllt und ihr Geld wert ist“[6].
Die Kostenrechnung ist Teil des innerbetrieblichen Rechnungswesens und erfasst den quantitativen und fiskalisch bewerteten Verzehr von Ressourcen. Sie ermöglicht den Entscheidungsträgern einer Unternehmung / einer Verwaltung die Erfassung, den Vergleich und die Analyse des Werteverzehrs. Mit ihrer Hilfe werden die bei den Geschäftsprozessen angefallenen Kosten systematisch erfasst und nach
- Kostenarten (Fragestellung: Welche Kosten sind angefallen?)
- Kostenstellen (Fragestellung: Wo sind die Kosten entstanden?)
- Kostenträgern (Fragestellung: Wofür sind die Kosten entstanden?)
dargestellt[7].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Abbildung 1: Übersicht über die Kostenrechnung) [8]
1.3 Normative Aspekte einer Verwaltungskostenrechnung
Gemäß § 7 Absatz 1 BHO (respektive LHO) in Verbindung mit § 6 Absatz 3 HGrG ist bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes auf den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu achten. Nach Absatz 2 dieser Vorschrift (BHO) sind für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen. Absatz 3 der Vorschrift bestimmt, dass in geeigneten Bereichen (der Verwaltung) eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einzuführen sei[9].
Eine explizit genannte Art und Weise der Ausgestaltung der Verwaltungskostenrechnung in den einzelnen Verwaltungszweigen bedingen diese Formulierungen indes nicht. Der Begriff des „geeigneten Bereiches“ zur Einführung der KLR in Absatz 3 ist nicht hinreichend bestimmt. Eine den Behörden selbstüberlassene Einschätzung, ob der eigene Verwaltungsbereich für dieses Instrument geeignet ist, erscheint nicht stringent und einheitlich zwingend genug. Ebenfalls wird nicht eindeutig definiert, was angemessene Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind und das hierbei die Kostenrechnung als Instrument anzuwenden sei. Es besteht somit die Gefahr, dass eine dezidierte Kostenbetrachtung, bzw. Selbstreflektion mit Hilfe dieses Dokumentations- und Steuerungsinstrumentes durch interne Widerstände in der Verwaltung verhindert wird. Mit der Kostenrechnung können zwar die ökonomischen Probleme bei der Leistungserstellung nicht beseitigt, jedoch durch Schaffung eines Kostenbewusstseins abgemildert werden[10].
Da eine ausdrücklich legal definierte Pflicht zu einer explizit genannten Kostenrechnung nicht existiert, ist es darüber hinaus teleologisch möglich, anhand des Rationalprinzips und des Wirtschaftlichkeitsprinzips eine Folgerung zur Anwendung der Kostenrechnung in der Verwaltung herzuleiten.
Unter dem Rationalprinzip versteht man „jedwedes menschliche Verhalten, welches auf das individuell gesetzte Ziel auf dem auf den Zweck angepassten Weg und mit dem Ziel erachteten dienlichen Mitteln ausgerichtet ist[11] .“
Dies erfordert einen ziel- bzw. zweckorientierten Mitteleinsatz, so LUHMANN, nach dem Grundsatz der maximierenden Rationalität[12]. Einfach ausgedrückt: Zwischen eingesetzten Ressourcen und angestrebtem Ergebnis soll im Idealfall ein optimales Verhältnis verwirklicht werden[13]. Dieses Prinzip findet insbesondere deshalb Anwendung, weil die zur Leistungserstellung benötigten Ressourcen nicht unendlich zur Verfügung stehen.
Auch im privaten Lebensbereich wird man in der Regel versucht sein, mit dem monatlich zur Verfügung stehenden Haushaltsgeld ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Somit ist das Rationalprinzip im übertragenen Sinne eine dem Menschen in Bezug zu seiner Lebensführung immanente Verhaltensweise, welche in die Verwaltungswirklichkeit grundsätzlich übertragbar wäre. Hieraus leitet sich wiederum eine gewisse Erwartungshaltung der Öffentlichkeit und des Gesetzgebers ab, dass die öffentliche Hand mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ökonomisch umgeht und für die Allgemeinheit und die Unternehmung (auch: Verwaltung) - gemessen an den Unternehmenszielen (respektive: Verwaltungszielen) - den größtmöglichen Nutzen erzielt[14].
Unter dem Wirtschaftlichkeitsprinzip versteht man den „Grundsatz der Wirtschaftstheorie, nach dem vernünftiges wirtschaftliches Handeln unter den Bedingungen knapper Mittel zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele erfolgen sollte. Entweder gilt es, mit gegebenen Mitteln einen möglichst großen Erfolg zu erzielen, oder es gilt, ein vorgegebenes Ziel mit möglichst geringem Aufwand zu erreichen. Die erste Handlungsweise wird auch als Maximalprinzip, die zweite als Minimalprinzip bezeichnet. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, das Verhältnis von Erfolg und Mitteleinsatz möglichst optimal zu gestalten (Extremumprinzip).“[15]
In der öffentlichen Verwaltung gilt die Begriffsbestimmung der Wirtschaftlichkeit nach dem Haushaltsrecht[16]. Hiernach ist Wirtschaftlichkeit eine Verhältnisbestimmung zwischen Nutzen (Ausmaß der Zielerreichung, Output) und Kosten (Ressourcenverbrauch, Wechselwirkungen). Das Gebot der Wirtschaftlichkeit erhält über Artikel 114 Absatz 2 GG Verfassungsrang und bindet somit die Verwaltung[17]. Verglichen werden in der öffentlichen Verwaltung bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die zur Disposition stehenden Alternativen im Planungs- und Entscheidungsprozess. Hierbei ist – vereinfacht – davon auszugehen, dass die wirtschaftlichste Alternative Aw diejenige ist, bei der der Quotient aus Nutzen N und Kosten K den maximalsten Wert hat[18]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist zu bedenken, dass diese kein Indikator der Rentabilität im Prozess der Leistungserstellung darstellt, sondern die Vorteilhaftigkeit einzelner Entscheidungsalternativen indiziert. Vorausgesetzt, dass man einen Marktwert der Leistung bestimmen kann, sind neben dem Vergleich des Ertrages und des Aufwandes auch die nachhaltigen Auswirkungen (Outcome) der Alternativen auf die Umwelt zu berücksichtigen[19]. Der Erfolg einer Alternative liegt somit nicht ausschließlich in der Erfüllung monetär bewerteter Zielsetzungen.
Aufgrund der dargelegten gesetzlichen Bestimmungen und den Ausführungen zu den Prinzipien täte eine effizient handeln wollende Verwaltung gut daran, sich mit der (Verwaltungs-)Kostenrechnung näher zu beschäftigen. Die Aufgaben und Teilgebiete einer Verwaltungskostenrechnung, unter Einbeziehung der Vor- und Nachteile, sowie Anwendbarkeit auf das Verwaltungshandeln, sollen im Folgenden näher erläutert werden.
2. Aufgaben der Verwaltungskostenrechnung
2.1 Kostenermittlung der Verwaltungsleistungen
Grundlage einer kostenseitigen Erfassung und Betrachtung der Verwaltungsleistung ist die Systematisierung der erbrachten Leistungen ihrer Typologisierung nach in einzelne Produktgruppen und Produkte. In der Praxis werden verschiedene Auslegungen darüber getroffen, was ein Produkt ist. Gemäß ISO 8402 ist ein Produkt „das Ergebnis von Tätigkeiten und Prozessen“[20]. Im Qualitätsmanagement ist ein Produkt „eine Leistung an einen externen Kunden“[21]. Nach dem Handbuch der Standard-KLR des Bundes ist ein Produkt "[…] das Ergebnis einer bestimmten Abfolge von vorher definierten Aktivitäten, mit einem definierbaren Wert oder Nutzen für den Empfänger. Zusätzlich soll ein Produkt für die Steuerung der Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Behörde sinnvoll und geeignet sein."[22]
Zur Ermittlung der Kosten einzelner Leistungen werden die Kosten im Verwaltungsbereich in der Regel den verschiedenen Geschäftsvorfällen zugeordnet. Diese müssen durch vorher definierte Kriterien von einander abgrenzbar und bei, in ihrem Wesen gleichartigen Leistungen, auch zuordbar sein. Leistungen können je nach Portfolio der Verwaltung z.B. in
- die Passausstellung,
- das Einwohner-Meldewesen,
- die Bearbeitung von Bauanträgen,
- das Erlassen von Bußgeldbescheiden,
- die Abwicklung von Mietangelegenheiten,
- die Überprüfung eines Gewerbes
- […]
unterteilt werden. Im Wesentlichen geht es darum, zu ermitteln, welche einzelnen Kosten für jede der Leistungen hervorgerufen wurden (Selbstkosten). In der Betriebswirtschaft nennt man diese zu ermittelnden Größen „Stückkosten“, das heißt, es werden die Kosten jeder einzelnen Leistung ermittelt. Die Stückkosten, wie auch andere Kostenarten, lassen sich wiederum in Fixkosten und variable Kosten unterscheiden.
Fixkosten sind ein Teil der Gesamtkosten eines Produktes, welche in einem bestimmten Zeitraum konstant bleiben (z.B. Mietkosten)[23]. Diese Kosten können durch Division mit der erstellten Menge an Leistungen zu den einzelnen Gesamtkosten addiert werden. Dies setzt jedoch eine planerische Grundlage voraus, wobei planerisch mit einer bestimmten Zahl von Geschäftsvorfällen in einem gewissen zukünftigen Zeitraum gerechnet werden muss. Genau wie bei der Personalbedarfsberechnung muss mittels Schätzverfahren ein erwartetes Kostenmodell erstellt werden. Dies ist nicht unproblematisch, da diese Kosten mit der Anzahl der erbrachten Leistungen in keinem ursächlichen Zusammenhang stehen. So bleiben die Mietkosten für ein Gebäude gleich, egal ob darin 5.000 oder 10.000 Geschäftsprozesse getätigt werden. Zudem kommt man bei der Anwendung der Methoden der Zurechnung von Kosten nach dem
- Verursachungsprinzip,
- dem Beanspruchungsprinzip, oder
- dem Finalprinzip
[...]
[1] Aufgrund der Kürze der Arbeit soll hier nicht näher darauf eingegangen werden. Die dargelegten Beispiele sollten für eine einführende Betrachtung der Problematik ausreichen.
[2] o.V.:„Besoldungsrepublik Deutschland“, In: Wirtschaftswoche, Zeitschriftenreihe, Nr. 30 / 1974, 28. Jahrgang, S.26
[3] MARCUS, Hermann: „Die faule Gesellschaft – Wie die Deutschen arbeiten“, 4. Auflage, Düsseldorf 1974, S. 95 ff.
[4] AST, Susanne: „Verwaltungsreform ohne Ziel? - Zur Notwendigkeit eines ganzheitlichen Planungs- und Steuerungsansatzes bei der Einführung des Neuen Steuerungsmodells“, In: Verwaltungsarchiv, 100. Jahrgang 2003, Heft 4/2003, S. 574-592
[5] GORNAS, Jürgen: „Grundzüge einer Verwaltungskostenrechnung“, In: Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, Band 13, 2. Auflage, Baden-Baden 1992, S.7 f.
[6] Quelle: www.olev.de, Online-Verwaltungslexikon, Stichwort: Kostenrechnung, Zugriff: 02.03.2009, 14:35 Uhr
[7] HASELBÖCK, Marko: „Aufgaben und Teilgebiete einer Verwaltungskostenrechnung“, Norderstedt 2008, S. 3
[8] MUNDHENKE, Erhard: „Controlling / KLR in der Bundesverwaltung – Was man dazu wissen sollte“, Schriftenreihe der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Band 34, Brühl 2003, Vgl. hierzu auch: http://streaming.fh.bund.de/bibliothek/klr/mundhenke/index.htm, Folie 48
[9] Vgl.: Bundeshaushaltsordnung, § 7Absatz 1, in der aktuell gültigen Fassung, vom 13.12.2007 (BGBl. I S. 2897)
[10] GORNAS, Jürgen 1992: S. 57
[11] FORKER, Hans-Joachim: „Das Wirtschaftlichkeitsprinzip und das Rentabilitätsprinzip, ihre Eignung zur Systembildung“, In: Die Unternehmung im Markt, Band 6, Berlin 1960, S. 15
[12] LUHMANN, Niklas: „Kann die Verwaltung wirtschaftlich handeln?“, In: Verwaltungsarchiv, 51. Jahrgang 1960, S. 97 ff.
[13] GORNAS, Jürgen 1992, S. 56
[14] DANZ, Burkhard: „Transparenz kommunaler Finanzen: Zu einer Kritik und Neukonzeption der Rechnungslegung kommunaler Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik Deutschland“, Dresdner Beiträge zu Revision und Steuerlehre, Band 24, Dresden 2000, S. 37-42
[15] DUDEN: „Wirtschaft von A bis Z. Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag“, 2. Auflage, Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, Mannheim 2004, S. 239 f.
[16] Quelle: www.olev.de, Online-Verwaltungslexikon, Stichwort: Wirtschaftlichkeit, Zugriff: 04.03.2009, 17:45 Uhr
[17] REINERMANN, Heinrich: „Neues Politik- und Verwaltungsmanagement: Leitbild und theoretische Grundlagen“, 2. Auflage, Speyerer Arbeitshefte, Band 130, Speyer 2000, S. 6; Siehe auch: http://www.hfv-speyer.de/Rei/PUBLICA/online/spah130.pdf
[18] Quelle: www.olev.de, Online-Verwaltungslexikon, Stichwort: Wirtschaftlichkeit, Zugriff: 04.03.2009, 18:15 Uhr
[19] Quelle: www.olev.de, Online-Verwaltungslexikon, Stichwort: Wirtschaftlichkeit, Zugriff: 04.03.2009, 18:20 Uhr
[20] International Organization for Standardization: „ISO 8402”, Genf 1994, Siehe: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=20115
[21] International Organization for Standardization: „ISO 9000 ff.”, Genf 2000, Siehe:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000.htm
[22] Bundesministerium der Finanzen: „Handbuch zur Standard-KLR in der Bundesverwaltung“, Berlin 2008
[23] GORNAS, Jürgen 1992: S. 206
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Verwaltungskostenrechnung?
Die Verwaltungskostenrechnung dient der Kostenermittlung von Verwaltungsleistungen, der Wirtschaftlichkeitsüberwachung und als Grundlage für Gebührenkalkulationen und Entscheidungen.
Welche Teilgebiete umfasst die Kostenrechnung in der Verwaltung?
Sie gliedert sich klassisch in die Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung.
Gibt es eine gesetzliche Pflicht zur Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)?
Gemäß § 7 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) soll in geeigneten Bereichen der Verwaltung eine KLR eingeführt werden, um die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen.
Was versteht man unter dem Rationalprinzip?
Das Rationalprinzip bezeichnet ein Handeln, bei dem Ressourcen so eingesetzt werden, dass zwischen Aufwand und angestrebtem Ergebnis ein optimales Verhältnis besteht.
Was ist der Unterschied zwischen Kostenstellen und Kostenträgern?
Kostenstellen beantworten die Frage, wo im Betrieb die Kosten entstanden sind, während Kostenträger klären, wofür (für welches Produkt oder welche Leistung) sie angefallen sind.
- Quote paper
- Diplom - Verwaltungswirt (FH) Sascha Schwarzkopf (Author), 2009, Aufgaben und Teilgebiete einer Verwaltungskostenrechnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134963