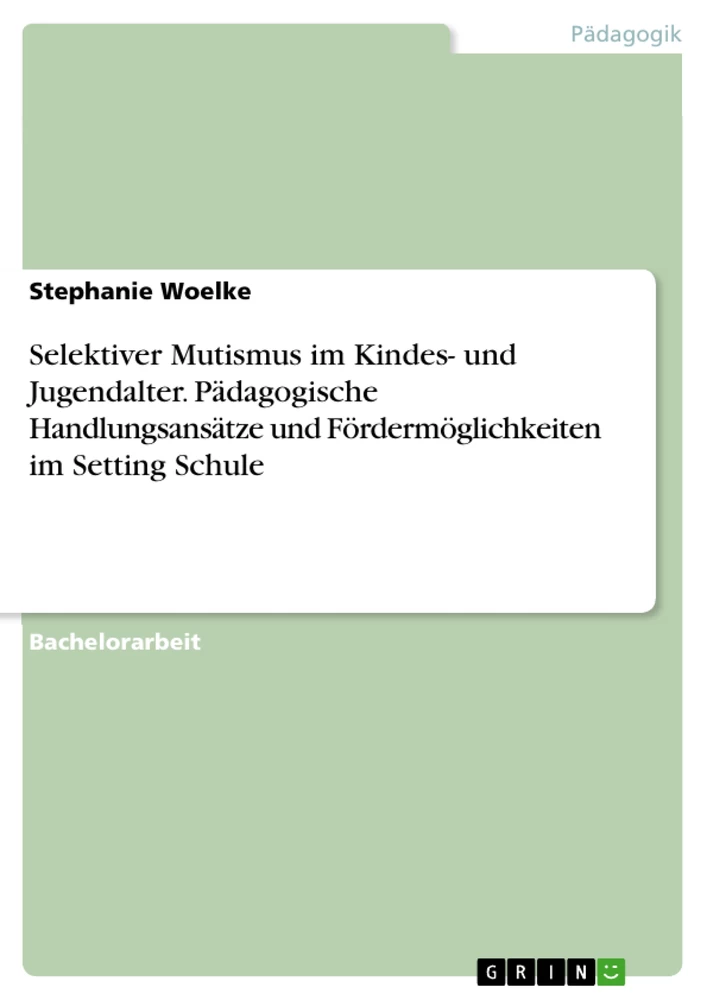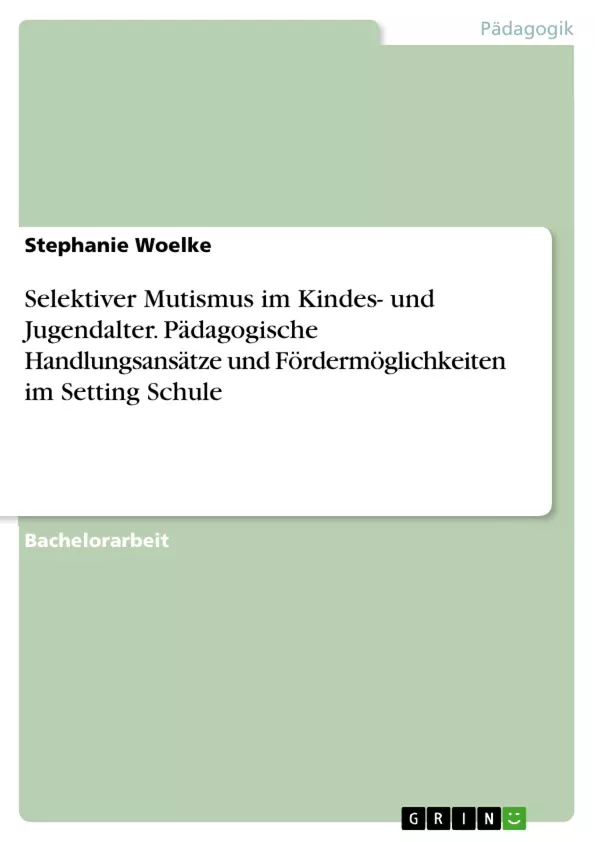Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist herauszufinden, welche Probleme und Hintergründe sich hinter der Sprachhemmung verbergen, ob und welchen Leidensdruck die Betroffenen empfinden und welche Auswirkungen das Schweigen nicht nur auf ihre eigene Person, sondern auch auf weitere Bezugspersonen hat. Das Akzeptieren und Annehmen des Schweigens ist indessen für pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, Elternteile und weitere Bezugspersonen nicht einfach. Warum fällt es so schwer, das Schweigen der Kinder zu ertragen? Für das Umfeld der Betroffenen ist es eine Herausforderung, die viel Geduld, Verständnis und Erkenntnis hinsichtlich des Störungsbildes bedarf, um das Schweigen zu verstehen.
Besonders im Hinblick darauf, dass Mutismus für viele Menschen ein unbekannter Begriff ist, soll diese Ausarbeitung einen Beitrag dazu leisten, dieses Störungsbild nicht nur bekannter und damit frühzeitig erkennbar, sondern auch begreifbar zu machen. Bei erstmaligem Kontakt mit einer mutistischen Person, löst das Schweigen Verunsicherung hinsichtlich einer angebrachten Umgehensweise aus. Die Motivation sich diesem Thema in der Abschlussarbeit zu widmen, ergab sich für die Autorin aus eigener Primärerfahrung durch Konfrontation mit einem mutistischen Kind an einer Schule für psychisch kranke Jugendliche, die unzählige verwirrende Fragen aufwarf und ratlos machte. Unsicherheiten aus pädagogischer wie auch aus persönlicher Sicht ergeben sich maßgeblich durch mangelndes Hintergrundwissen über dieses Phänomen. Sofern kein exakter Grund für das Schweigen einer Person erkennbar ist, wird dies, mehr oder weniger unterbewusst, sogleich kritisch in Frage gestellt. In unserer Kultur sind wir es gewohnt, fast ununterbrochen miteinander zu reden. Es gibt nur wenige Situationen, beispielsweise im Trauerfall, in denen das Schweigen für uns als angemessen erachtet wird. Bereits nach wenigen Sekunden wird es als irritierend, merkwürdig, unfreundlich oder sogar störend empfunden. Damit Begegnungen mit mutistischen Personen nicht diese Gefühle bei dem Gegenüber auslösen, soll aufgedeckt werden, dass selektiver Mutismus nicht lediglich bedeutet, dass die betroffenen Personen gerade nicht sprechen möchten, sondern schwerwiegenderer Gründe hinter dem Schweigen stehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Mutismus
- 2.2 Selektiver Mutismus
- 2.3 Totaler Mutismus
- 2.4 Akinetischer Mutismus
- 3. Phänomenologie
- 3.1 Allgemeines Erscheinungsbild
- 3.2 Symptomatik
- 3.2.1 Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale
- 3.2.2 Intelligenz
- 3.3 Erscheinungsformen
- 4. Diagnostik
- 4.1 Diagnostische Kriterien nach ICD-10
- 4.2 Diagnostische Kriterien nach DSM-5
- 4.3 Kritik an den (differential-) diagnostischen Kriterien der zwei Klassifikationssysteme
- 4.4 Häufige Fehldiagnosen
- 4.5 Instrumente der Diagnostik
- 5. Epidemiologie - Auftreten
- 5.1 Prävalenz - Häufigkeit und Geschlechterverteilung
- 5.2 Erstmanifestation und Dauer
- 6. Ätiologie - Ursachen und Risikofaktoren
- 7. Wie Mutismus das Leben verändert
- 7.1 Allgemeine Auswirkungen auf die Betroffenen
- 7.2 Auswirkungen speziell in der Schule
- 8. Therapieansätze unterschiedlicher Professionen und Disziplinen
- 8.1 Psychotherapie
- 8.2 Pharmakotherapie/Psychiatrie
- 8.3 Familien-/Spieltherapie
- 8.4 Sprachtherapie
- 8.5 Systemische Mutismus-Therapie (SYMUT)
- 9. Pädagogische Handlungsansätze und Fördermöglichkeiten im Setting Schule
- 9.1 Pädagogische Handlungsprinzipien in der Schule
- 9.2 Schulische Rahmenbedingungen
- 9.3 Aktive Teilhabe an einem koordinierten Helfer-Netzwerk
- 9.4 Akzeptanz durch Aufklärung aller Beteiligten
- 9.5 Integration und Inklusion der Kinder in den Klassenverband - Konfliktebenen
- 9.6 Alternative Kommunikationsformen und Interventionsmöglichkeiten
- 10. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen des selektiven Mutismus im Kindes- und Jugendalter. Ziel ist es, die Ursachen, Auswirkungen und Möglichkeiten der pädagogischen Handlungs- und Förderansätze im schulischen Umfeld zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung des selektiven Mutismus
- Symptome, Erscheinungsformen und Diagnostik
- Ursachen und Risikofaktoren
- Auswirkungen auf Betroffene und ihr soziales Umfeld
- Pädagogische Handlungsansätze und Fördermöglichkeiten in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz der sprachlichen Kommunikation sowie die spezifischen Herausforderungen des selektiven Mutismus. Die Kapitel 2 und 3 definieren den selektiven Mutismus, beschreiben seine Phänomenologie und die damit verbundenen Symptome. Kapitel 4 konzentriert sich auf die diagnostischen Kriterien und Instrumente. Die Kapitel 5 und 6 analysieren die Häufigkeit und die Ursachen des selektiven Mutismus. Kapitel 7 untersucht die Auswirkungen des Mutismus auf das Leben der Betroffenen, insbesondere im schulischen Kontext. Kapitel 8 stellt verschiedene Therapieansätze und Disziplinen vor.
Kapitel 9 bildet den Kern der Arbeit und widmet sich den pädagogischen Handlungsansätzen und Fördermöglichkeiten im Setting Schule. Es werden Prinzipien, Rahmenbedingungen und konkrete Interventionsmöglichkeiten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Selektiver Mutismus, Sprachentwicklung, Kindheit, Jugend, Schule, pädagogische Handlungsansätze, Fördermöglichkeiten, Diagnostik, Therapie, Inklusion, Kommunikation, soziales Umfeld, Familientherapie, systemische Mutismus-Therapie.
- Citation du texte
- Stephanie Woelke (Auteur), 2018, Selektiver Mutismus im Kindes- und Jugendalter. Pädagogische Handlungsansätze und Fördermöglichkeiten im Setting Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1351010