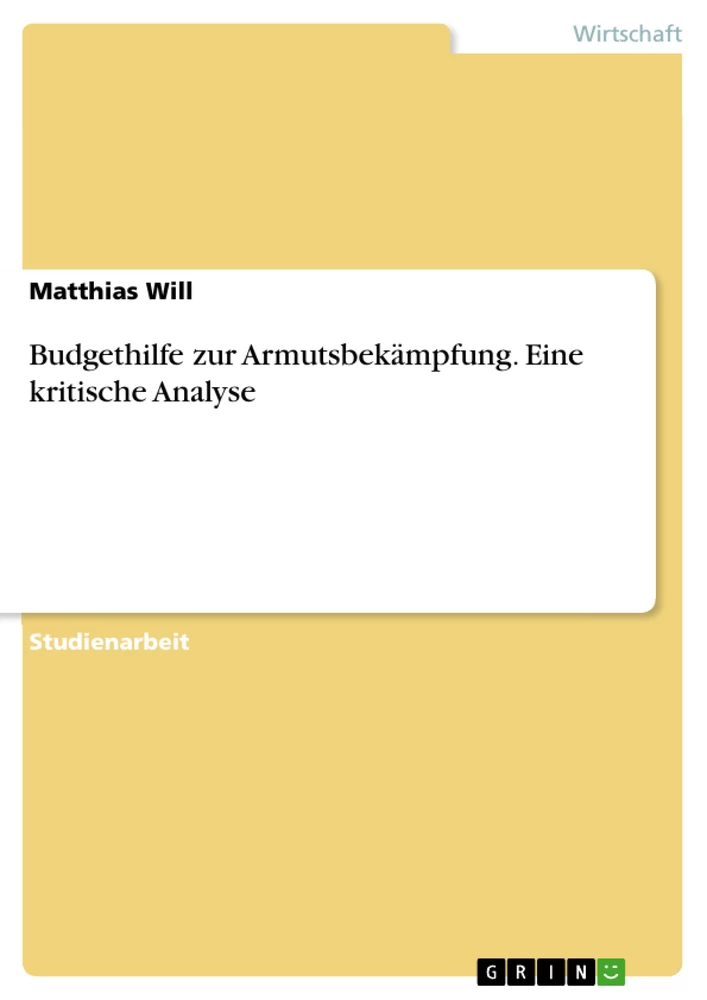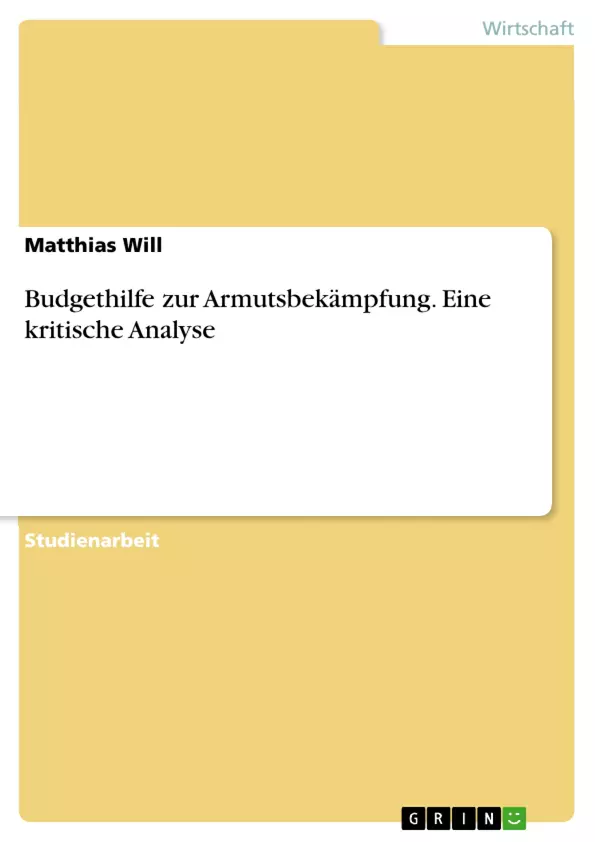Budgethilfe ist vom Ansatz ein gut durchdachtes Instrument, das theoretisch darauf abzielt die komplexen Ursachen der Armut zu bekämpfen. Die ersten kritischen Erfahrungsberichte legen jedoch dar, dass dieser theoretische Ansatz erstens nur schwer umsetzbar ist und zweitens bestenfalls wirkungslos ist, oft aber sogar negative Konsequenzen hat. Zentrale Armutsursache in den Entwicklungsländern ist nicht das Fehlen von Finanzmitteln, wie es viele neoklassische Modelle analysieren. Ursache der Armut sind mangelhafte gesellschaftliche/ staatliche Institutionen. Gerade die Eliten in den Entwicklungsländern profitieren aber aus diesen unzureichenden Institutionen (z. B. durch Korruption, staatliche Monopole). Hier entsteht ein unlösbarer Zielkonflikt zwischen Ownership und Verbesserung des institutionellen Rahmenfeldes.
Neben der Armutsbekämpfung haben sowohl die Geber- als auch die Nehmerländer vielfältige Interessen. Für die Nehmerländer ist vor allem der Bestandserhalt der Eliten aufzuführen. Auf anderer Seite sind politische wie wirtschaftliche Absichten zu nennen, aber auch Medienwirksamkeit und die Einhaltung haushaltsrechtlicher Bestimmungen. Es werden sich also Hilfsmaßnahmen herausbilden, bei denen sowohl eine faktische Konditionalisierung weiterhin besteht als auch Ownership dazu dient, die Interessen der Eliten zu wahren. Bezüglich der Armutsbekämpfung sind beide Ausprägungen als äußerst kritisch anzusehen.
Der implizierte Managementansatz der Budgethilfe ist wegen fehlender Strukturen ineffektiv und ineffizient. So fehlen in der Planungsphase Kapazitäten in den Behörden der Nehmerländer, was auch nicht durch die Geber kompensiert werden kann. Die Umsetzung der Hilfsmaßnahmen wird erschwert durch fehlende Kooperation unter den Gebern und durch unzureichende Verantwortungszuweisungen in den Bürokratien der Nehmer. Darüber hinaus fehlt es an einer objektiven Evaluierung, wenn diese wegen fehlender Daten überhaupt möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Armut als ein komplexes Problem
2. Ziele der Entwicklungshilfe
3. Budgethilfe als Weiterentwicklung klassischer Entwicklungshilfe
4. Grenzen der Budgethilfe
4.1 Schlechte Regierungsführung als Armutsursache
4.2 Grenzen des ownership-Gedankens
4.3 Eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten der Zielgruppenorientierung
4.3.1 Ex ante: Kapazitätsengpässe, Fehlanreize und kulturelle Verständigungsschwierigkeiten in der Planungsphase
4.3.2 Ex tunc: Schwierige Abstimmung unter Geberländern und fehlende Verantwortlichkeit
4.3.3 Ex post: Schranken der Evaluierung
4.4 Fehlanreize durch eine Erhöhung der Entwicklungshilfe
5. Resümee: Differenzierende Lösungen für komplexe Probleme erforderlich
Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung : Armut als ein komplexes Problem
Armut ist nicht nur das Fehlen materieller Güter; Armut hat viele Dimensionen: Gesundheitszustand, Zugang zu Bildung, politische und gesellschaftliche Partizipation und auch Emanzipation.[1] Gerade für breite Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern ist aber festzustellen, dass Armut immer impliziert, dass sowohl materielle als auch gesellschaftliche Armutsfaktoren eng miteinander verbunden sind.
Armut kann auch als das Fehlen von Lebensqualität bezeichnet werden. Qualität ist immer eine Wertung eines Zustandes durch Individuen. Die Beurteilung von Lebensumständen kann aber unterschiedlich wahrgenommen werden und ist auch kulturell abhängig.[2] Abgesehen von kulturellen Unterschieden, wie Armut empfunden wird, ist Armut noch mehr als nur Mangel. Wenn Armut Mangel wäre, dann würde nichts dagegen sprechen, wenn sich die Armen ihre Mangelbedürfnisse selbst befriedigen würden. Die Multidimensionalität der Armut und die lokale Häufung in Entwicklungsländern führen aber zu prekären Verhältnissen, aus denen sich die Betroffenen nicht selbst befreien können.[3]
Kern dieser Arbeit ist die Vorstellung eines neuen Ansatzes in der Entwicklungshilfe: die Budgethilfe. Dieser wird von Seiten nationaler und multinationaler Institutionen eine hohe Bedeutung beigemessen zur Lösung der Armutsprobleme. Jedoch hat dieser Ansatz einige systemimmanente Probleme, wodurch eine zielorientierte Beseitigung der Armut mittels Budgethilfe äußerst schwierig ist.
2. Ziele der Entwicklungspolitik
Im Rahmen der Millenniumszielvereinbarung[4] wurden im Jahr 2000 von der UN Ziele verabschiedet, um weltweite Armut zu bekämpfen. Folgenden strategischen Zielen sollte dabei Priorität eingeräumt werden: Bekämpfung extremer Armut und Hungers; Grundschulbildung für alle; Gleichheit der Geschlechter und Stärkung der Frauenrechte; Senkung der Kindersterblichkeit und der Sterblichkeit junger Mütter; Kampf gegen AIDS, Malaria und Seuchen; Förderung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit und Aufbau einer globale Entwicklungspartnerschaft.[5]
Die Millenniumsziele haben als Adressaten die einzelnen Nationalstaaten. Zur Verbesserung der Entwicklungshilfe in Bezug auf die Erreichung dieser Ziele kam es 2005 zur Paris Declaration on Aid Effectiveness.[6] Ergebnis dieses Treffens von Industrie- und Entwicklungsländern war eine Zielvereinbarung, die die Effektivität und die Effizienz von Entwicklungshilfe erhöhen sollte. Folgende Kernpunkte der Vereinbarung sind besonders hervorzuheben:
- Die Geberländer orientieren sich an den Entwicklungsstrategien der Entwicklungsländer und arbeiten mit diesen verstärkt partnerschaftlich zusammen.
- Entwicklungshilfe ist outputorientiert zu steuern und die Strategien dementsprechend zu evaluieren.
- Die Entwicklungsländer verpflichten sich, die Leistungsfähigkeit, Transparenz und Verantwortung ihrer Institutionen zu verbessern und die Geberländer vertrauen diesen soweit wie möglich.
- Die Geberländer streben eine mehrjährige Zusammenarbeit an und versuchen die Mittel so zu vergeben, dass sie planbar sind.
- Die Geberländer versuchen untereinander in der Entwicklungshilfe zusammenzuarbeiten mit dem Ziel Hilfe aus einer Hand anzubieten.
Die Umsetzung der Paris Declaration on Aid Effectiveness erfolgt primär mittels der allgemeinen Budgethilfe.[7]
3. Budgethilfe als Weiterentwicklung klassischer Entwicklungshilfe
Entwicklungshilfe geht grundsätzlich – so auch die Budgethilfe – vom Ansatz aus, dass sich die Ärmsten Länder in einer prekären Situation befinden, aus der sie sich nicht befreien können. Ziel muss es daher sein, mittels Entwicklungshilfe den Stillstand zu überwinden und auf einen Wachstumspfad zu gelangen.[8] Problematisch an der Wirksamkeitsanalyse von Budgethilfen ist, dass diese noch recht neue Instrumente sind und daher noch kaum aussagekräftige Studien vorliegen.[9] Budgethilfen als eine Art des Transfers von Geld in Entwicklungsländer sind im Ergebnis eine Weiterentwicklung traditioneller Transfers von Geberländern. Daher wird an dieser Stelle der Einfluss traditioneller Entwicklungshilfe auf das Wachstum eines Landes näher untersucht. So kommt David Roodman in seinem Workingpaper, in welchem er einige Studien zur Entwicklungshilfe empirisch untersucht hat, zu dem Ergebnis, dass nicht die Entwicklungshilfe entscheidenden Einfluss auf das Wachstum hat, sondern nationale Ersparnisse, Gleichheit und die Qualität der staatlichen Institutionen.[10] Ein noch drastischeres Bild zeichnet Easterly: „Enwicklungshilfe [bringt] kein Wachstum hervor[…].“[11] Entwicklungshilfe hat Einfluss auf den Konsum, aber nicht auf die Investitionstätigkeit.[12] So wurde die Entwicklungshilfe in den afrikanischen Ländern in den letzten Jahrzehnten immer stärker ausgeweitet, jedoch sind die Pro-Kopf-Waschstumsraten seit 1984 beständig unter 0 %.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Wahrscheinlichkeit, dass durch Entwicklungshilfe Wachstum entsteht, ist nicht höher wie bei Ländern ohne Entwicklungshilfe.[13] So unterschieden sich die asiatischen Länder China, Hongkong, Indien, Indonesien, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand hinsichtlich der geleisteten Entwicklungshilfe deutlich. Der Beginn der Wachstumsperiode zwischen 1950 und 1975 erfolgte jedoch bei allen Ländern.[14]
4. Grenzen der Budgethilfe
4.1 Schlechte Regierungsführung als Armutsursache
Eine breite Literatur kommt zu dem Ergebnis, dass die primäre Armutsursache schlechte Regierungsführung ist.[15] Unter schlechter Regierungsführung wird allgemein ein Demokratiedefizit, Korruption, staatliche Willkür, fehlender Eigentumsschutz und dergleichen verstanden.[16]
Klassische Entwicklungshilfe hat erfolglos versucht, unter diesen widrigen Umständen zu wirken. So waren im Jahr 2002 die 15 am stärksten unterstützten Länder, unter den 25% der Länder mit der schlechtesten Regierungsführung. Auch konnte kein Nachweis erbracht werden, dass korrupte Staaten weniger unterstützt werden. Tatsächlich wurden diese in der Vergangenheit sogar stärker unterstützt. Eine Trendwende war bis 2002 nicht ersichtlich.[17] Besonders korrupte und demokratiedefizitäre Länder zeichnen sich darüber hinaus noch mit sehr geringen Wachstumsraten aus.[18] Für Entwicklungshilfe bedeutet dies, dass Transfers in Länder mit schlechter Regierungsführung nur einen sehr geringen Einfluss auf das Wachstum haben. Darüber hinaus lässt sich empirisch nachweisen, dass Entwicklungshilfe, wenn sie 8 % des BIP des Nehmerlandes übersteigt, sogar eher nachteilig auf das Wachstum wirkt und bis zu dieser Schwelle der Grenznutzen der Hilfe abnehmend ist.[19]
Budgethilfe kann Armut nur dann bekämpfen, wenn sie dazu beiträgt, die nationalen Institutionen zu verbessern. Dieser Gedanke wurde auch in der Pariser Erklärung aufgenommen, denn die Geberländer sollen unterstützend dazu beitragen, dass die Institutionen der Entwicklungsländer sich verbessern. Die Unterstützung soll aber ohne Konditionalität erfolgen.[20] Hierin liegt aber ein Zielkonflikt, was als prinzipielles Problem der Budgethilfe verstanden werden kann. Besonders die Eliten in Entwicklungsländern haben kein Eigeninteresse die vorhandenen Institutionen zu verbessern, denn sie profitieren von den für die Gesellschaft mangelhaften Institutionen.[21] Eine Vergabe von Geldern in einem institutionell mangelhaften Umfeld führt aber dazu, dass die eigentliche Armutsursache nicht bekämpft wird. Budgethilfe bringt in diesem Fall sowohl für das Wachstum, als auch für die Verbesserung nationaler Institutionen keine Lösung zur Armutsreduzierung. Budgethilfe setzt zumindest ein Mindestmaß an politischer Kultur und funktionierenden Institutionen voraus. Selbst dann sind die Erfolge, wie z.B. in Mosambik, aber nur befriedigend.[22]
[...]
[1] The Millenium Development Report 2008 (2008); S. 5.
[2] Frank Bliss in Neue Ansätze der Entwicklungstheorie (1999, Hg. R. E. Thiel); S. 76ff.
[3] World Development Report 2004 (2004); S. 1 ff.
[4] United Nations A/RES/55/2 (2000).
[5] The Millenium Development Report 2008 (2008); S. 6 ff.
[6] OECD, http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html ; 30.05.09.
[7] Schilder, Martens (2006), S. 73.
[8] Easterly (2006), S. 47; so auch Hemmer (2002), S. 929.
[9] Langthaler (2006), S. 14; so auch Schilder, Martens (2006), S. 66.
[10] Roodman (2007), S. 18; ähnliches Ergebnis in Hemmer (2002), S. 993.
[11] Easterly (2006), S. 55; diesen äußerst kritischen Schluss könnte wohl auch H. Hemmer unterstützen (Hemmer (2002), S. 993).
[12] Easterly (2006), S. 57.
[13] Easterly (2006), S. 63.
[14] Easterly (2006), S. 62.
[15] so z. B. North et al (2007) S.4 ff.
[16] Easterly (2006), S. 122 ff. insbesondere auch Fußnote 24 im 4. Kapitel.
[17] Easterly (2006), S. 124.
[18] Easterly (2006), S. 53.
[19] Easterly (2006), S. 61 f
[20] Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005), S. 3 f.
[21] North et al (2007), S. 11
[22] So auch Schilder, Martens (2006), S. 70: Kurzfristig führt Budgethilfe nicht zur Armutsreduzierung. Zwar wird häufig zwar die Bereitstellung öffentlicher Güter ausgeweitet, dies aber verbunden mit einer Verschlechterung der Qualität und Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Budgethilfe in der Entwicklungspolitik?
Budgethilfe ist ein Instrument, bei dem Finanzmittel direkt in den Staatshaushalt eines Entwicklungslandes fließen, anstatt einzelne Projekte zu finanzieren. Ziel ist es, die Eigenverantwortung (Ownership) zu stärken.
Warum wird Budgethilfe oft kritisch gesehen?
Kritiker bemängeln, dass Budgethilfe in Ländern mit schlechter Regierungsführung wirkungslos bleiben oder sogar Korruption und den Machterhalt korrupter Eliten fördern kann.
Was ist der „Ownership-Gedanke“?
Ownership bedeutet, dass die Partnerländer selbst die Verantwortung für ihre Entwicklungsstrategien übernehmen. Problematisch wird dies, wenn die Interessen der Eliten nicht mit der Armutsbekämpfung übereinstimmen.
Welche Rolle spielt die „Paris Declaration on Aid Effectiveness“?
Diese Vereinbarung von 2005 zielt darauf ab, die Effizienz der Entwicklungshilfe durch bessere Koordination der Geber und stärkere Ausrichtung an den Strategien der Nehmerländer zu erhöhen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Entwicklungshilfe und Wachstum?
Einige Studien zeigen, dass hohe Entwicklungshilfe allein kein Wachstum garantiert; entscheidender sind oft die Qualität der staatlichen Institutionen und nationale Ersparnisse.
- Citar trabajo
- Diplom-Verwaltungswirt (FH) Matthias Will (Autor), 2009, Budgethilfe zur Armutsbekämpfung. Eine kritische Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135102