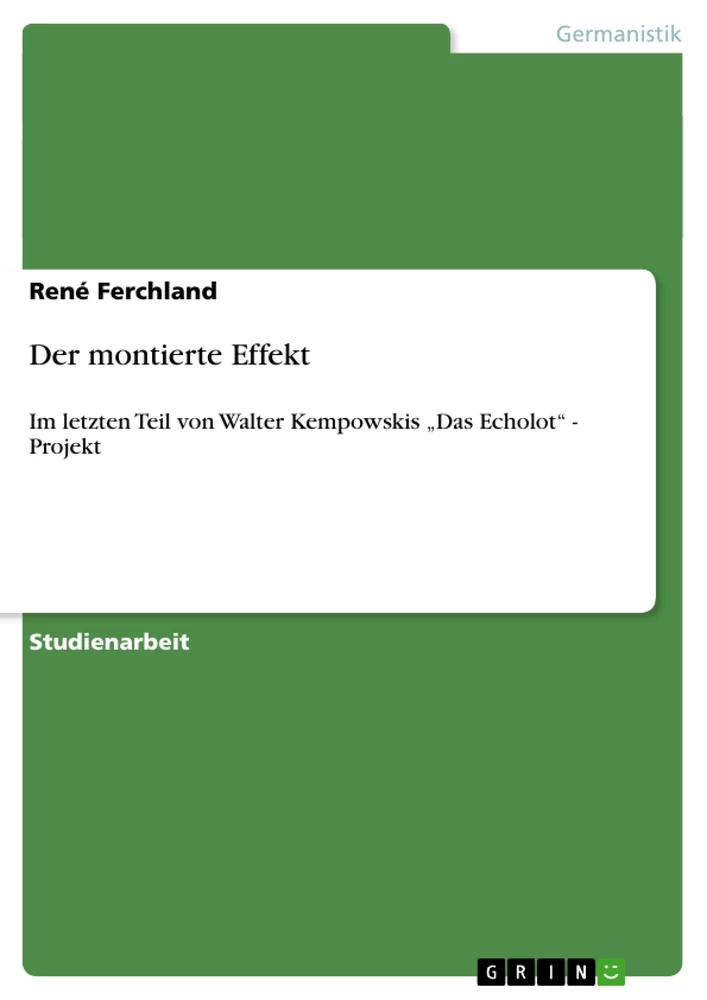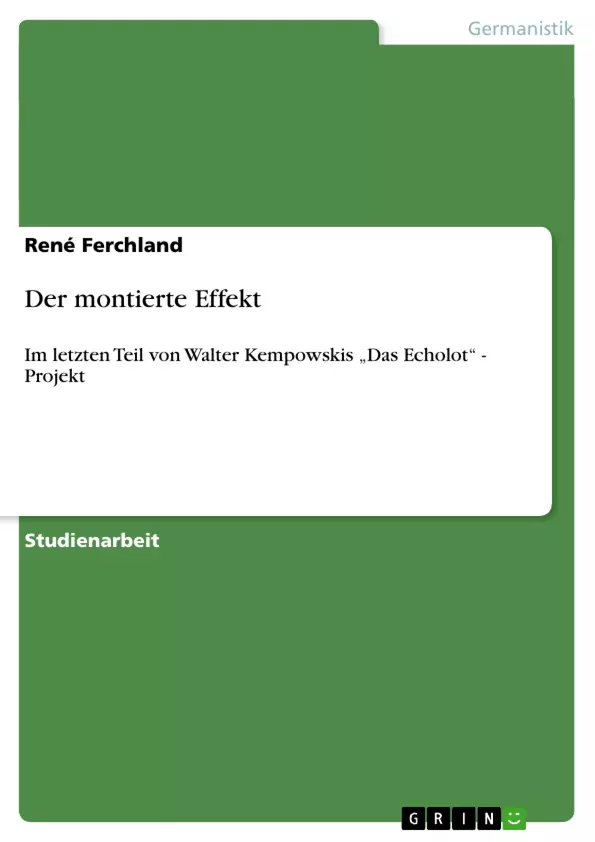Für diesen letzten Teil des großen kollektiven Tagebuchs erwählte Kempowski die Tage 20. April, 25. April, 30. April und schließlich 8./9. Mai 1945, es handelt sich um geschichtsträchtige Tage wie sie in jedem Schullehrbuch erwähnt werden, doch geht es Walter Kempowski bei der Darstellung von Hitlers 56. Geburtstag bis zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands nicht um eine weitere objektiv-faktische Darstellung, sondern vielmehr um die Betroffenen, wie sie diese Tage subjektiv erlebt haben und beurteil(t)en. Sein persönliches Credo lautete: „Wir müssen uns bücken und aufheben, was nicht vergessen werden darf: Es ist unsere Geschichte, die da behandelt wird“.
Im Folgenden wird das Augenmerk darauf gerichtet, wie Kempowski diese große Arbeit bewältigte – und ob er seine Idee der Montage intentionsgetreu umsetzen konnte. Zudem werden sowohl die para- und intertextuellen Verknüpfungen, als auch Kempowskis Verfahrensweise an einigen zentralen Punkten wie Hitlers Geburtstag beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Rolle des Abgesangs ’45 im „Echolot“ – Projekt
2. „Das Echolot“ als montierte Dokumentation
3. Para- und Intertextualität in der literarischen Montage
3.1 Verwendung von Fotografien / Paratextuelle Aspekte
3.2 Intertextualität als Grundbaustein der Montage
4. Abgesang ’45
4.1 Hitlers Geburtstag – Rekonstruktion eines „Trauertages“
4.2 Dialog von Subjekten als Objektivitätskriterium
4.3 Die Kapitulation – Abgesang ’45
Quellen
1. Die Rolle des Abgesangs ’45 im „Echolot“ – Projekt
„Es war in München, wo [Walter Kempowski] sich im Oktober 1988 [...] aufhielt, als er un-verhofft den Titel fand und mit Bleistift auf den Rand einer Zeitung schrieb: ‚Echolot’. (ein kollektives Tagebuch)“1 – der Titel eines extrem großen Projektes, dessen grundlegende Idee ihn ungefähr ein Jahr zuvor auf einer Reise nach Ostpreußen gepackt hatte. Das Echolot ist eigentlich ein Gerät zum Messen von Entfernungen und Tiefen mittels Schallwellen2, seine Verwendung findet dieser Begriff hier aber eher als metaphorischer Wiederhall der histori-schen Ereignisse. Kempowski, Jahrgang 1929, der von 1948 an acht Jahre lang der Spionage beschuldigt im Zuchthaus verbracht hatte, begann im Anschluss an diese schwere Zeit seine täglichen Tagebuchaufzeichnungen, schrieb sogar einen Haftbericht. Dreißig Jahre nach der Zuchthauserfahrung konzipierte er ein Manifest, das die kriegsträchtigen Jahre 1943 bis 1948 festhalten sollte. Nach Art seiner collagierten Hörspiele „ordnete [er] das Material dialogisch oder verstärkte Eindrücke durch Häufung, ließ Themen abwechseln, wiederkehren, variierte sie“3. Im „Echolot“ – Projekt erschien 1993 dann der erste Teil „Barbarossa ’41“, 1999 der zweite Teil, der den Zeitraum vom 1.1.43 bis 28.2.43 umfasst, der dritte Teil „Fuga Furiosa – Winter 1945“ erschien im Jahr 2002 und pünktlich zum Jahrestag der deutschen Kapitulation dann im Jahre 2005 der „Abgesang ’45“. Nach dem ersten Teil schon wurde Kempowski als Ethnologe und auch als Künstler gefeiert, sein Werk erhielt international Anerkennung.
Schon viele Jahre vor dem ersten Teil hatte er sein Augenmerk auf das Jahr gerichtet, in dem der Krieg endete – er meinte dazu: „Zentrum des Werks muss das Jahr 1945 sein, der Schlund des Trichters, auf den alles zudringt“4. Für diesen letzten Teil des großen kollektiven Tage-buchs erwählte er die Tage 20. April, 25. April, 30. April und schließlich 8./9. Mai 1945, es handelt sich um geschichtsträchtige Tage wie sie in jedem Schullehrbuch erwähnt werden, doch geht es Walter Kempowski bei der Darstellung von Hitlers 56. Geburtstag bis zur bedin-gungslosen Kapitulation Deutschlands nicht um eine weitere objektiv-faktische Darstellung, sondern vielmehr um die Betroffenen, wie sie diese Tage subjektiv erlebt haben und beur-teil(t)en. Sein persönliches Credo lautete: „Wir müssen uns bücken und aufheben, was nicht vergessen werden darf: Es ist unsere Geschichte, die da behandelt wird“5.
Im Folgenden wird das Augenmerk darauf gerichtet, wie Kempowski diese große Arbeit be-wältigte – und ob er seine Idee der Montage intentionsgetreu umsetzen konnte. Zudem wer- den sowohl die para- und intertextuellen Verknüpfungen, als auch Kempowskis Verfahrens-weise an einigen zentralen Punkten wie Hitlers Geburtstag beleuchtet.
2. „Das Echolot“ als montierte Dokumentation
In „Das Echolot – Abgesang ’45“, einem vierhundertfünfzig Seiten starkem Buch, hat Walter Kempowski gerade einmal drei Seiten selbst geschrieben – da stellt sich offenbar die Frage, worum es sich hierbei also handelt. Es ist ein Buch, über dessen Titel sein Name steht, aber ist er der Autor? Er ist Schriftsteller, aber hat er hier Schrift gestellt? Ist das Literatur?
Der Literaturbegriff unterscheidet auf der einen Seite fiktionale Texte, also ausgedachte Tex-te, die nur bedingt einen Wirklichkeitsanteil beinhalten und auf der anderen Seite Sach- bzw. Gebrauchstexte, Fachtexte, die auf Wahrheit und Wirklichkeit beruhen, aber zur Nicht-Literatur zu zählen sind. Walter Kempowski hat allein in diesem Teil des umfangreichen Pro-jekts über sechshundertdreißig Beiträge gesammelt, die im Kontext der letzten Tagen des zweiten Weltkrieges stehen und sie in diesem Buch vereint – demnach liegt die Annahme, dass es sich hierbei um einen Sachtext handelt, sehr nahe. Es sind Beiträge von vielen Men-schen verschiedener Herkunft und verschiedenen Alte]rs, Kriegsbeteiligte, sogar Adolf Hitler selbst versammelt, die alle auf den ersten Blick nur eines eint: die Teilnahme am, bzw. die aktive oder passive Involvierung in den zweiten Weltkrieg.
Auch beim Film werden fiktive Filme von beispielsweise Dokumentationen unterschieden, letzteren wird als Hauptmerkmal der hohe, fast absolute Wahrheitsgrad zugesprochen, denn die Dokumentation ist eigentlich eine Sammlung und Nutzbarmachung von Dokumenten, z.B. Zeitschriftenartikeln, Büchern, Urkunden6 und genau hier finden wir die Beschreibung des Werkes von Kempowski. Er setzte Artikel aus der FAZ, Berichte aus Geschichtsbüchern, Briefbänden, Tagebuchblättern zusammen, bewahrte ihren Wahrheitsgehalt und setzte sie in Beziehung.
Aber in Anbetracht des allgemeinen Literaturbegriffs entspricht dies nur einem weiten Defini-tionsrahmen, denn abgesehen von dem Inhalt der einzelnen Beiträge sind dem Gesamttext einige Aspekte der Literatur nicht zweifelsohne zuzuschreiben. Neben der Sprachlichkeit und Textualität nämlich fehlt ihm die Fiktionalität, weswegen wir „Das Echolot“ ja eher Sachtex-ten zuzuordnen im Begriff wären. Vielleicht aber gehört dieses Werk zu den literarischen Texten, „die eindeutig nicht fiktional sind, da sie keine erfundenen Figuren, Gegenstände, Ereignisse enthalten“7 – es gibt also nicht-fiktionale Literatur, d.h. Literatur, die dem vollen Wirklichkeitsanspruch Genüge tut und trotzdem einen bestimmten Grad der Literarizität in sich birgt, womit ein Konsens gefunden wäre zwischen des Textes Anspruch auf Wirklichkeit und der künstlerischen Umsetzung der Montage.
Dem Werk haftet als Merkmal demnach eine gewisse Literarizität, etwas Künstlerisches an. In einem Sachbuch hätte man mit Sicherheit keine Röntgenaufnahme von Hitlers Schädel zwischen Epilog und Anhang gesetzt – was dieser beispielhaften Montage Kempowskis aber Rechnung trägt, ist der gewollte künstlerische Effekt (der durch den Kontrast zu faktisch dar-gestellten Dokumenten kenntlich wird), Effekte, die wir im „Echolot“ – Projekt zuhauf antref-fen und die dasselbe auf eine neue Stufe der persönlich-politischen, literarischen Auseinan-dersetzung mit dem zweiten Weltkrieg stellen.
[...]
1 Hempel, Dirk: Walter Kempowski. Eine bürgerliche Biografie, München: btb 2004, S. 198.
2 Vgl. Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung, München: Wissen Media Verlag GmbH 2003.
3 Hempel, S. 200.
4 www.kempowski.info
5 „Statt eines Vorworts“ In: Das Echolot. 1.1.43 - 28.2.43, München: Albrecht Knaus 21993.
6 Vgl. Wahrig
7 H.L. Arnold, H. Detering (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv 62003, S. 25
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Projekt „Das Echolot“ von Walter Kempowski?
Es ist ein monumentales „kollektives Tagebuch“, das aus Tausenden von Briefen, Tagebuchnotizen und Dokumenten die Geschichte des Zweiten Weltkriegs aus subjektiver Sicht montiert.
Was bedeutet der Begriff „Montage“ bei Kempowski?
Kempowski schreibt kaum eigenen Text, sondern setzt vorhandene Dokumente so zusammen, dass durch deren Kontrast und Reihung ein neues künstlerisches und historisches Gesamtbild entsteht.
Welchen Zeitraum umfasst der „Abgesang ’45“?
Dieser Teil fokussiert sich auf die geschichtsträchtigen Tage vom 20. April (Hitlers Geburtstag) bis zur Kapitulation am 8./9. Mai 1945.
Ist „Das Echolot“ Literatur oder ein Sachtext?
Obwohl es auf Fakten und Dokumenten basiert, besitzt es durch die künstlerische Montage eine hohe Literarizität und wird als nicht-fiktionale Literatur eingeordnet.
Welches Ziel verfolgte Kempowski mit diesem Werk?
Sein Ziel war es, die Geschichte durch die Stimmen der Betroffenen vor dem Vergessen zu bewahren und ein subjektives Echo der Ereignisse zu erzeugen.
- Citar trabajo
- René Ferchland (Autor), 2007, Der montierte Effekt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135140