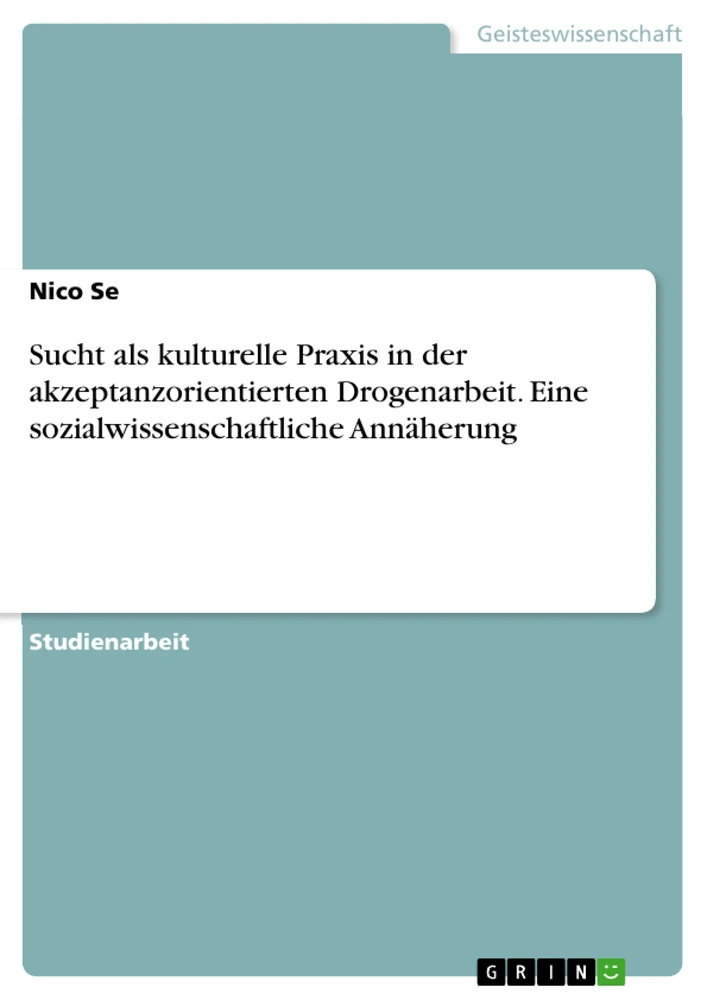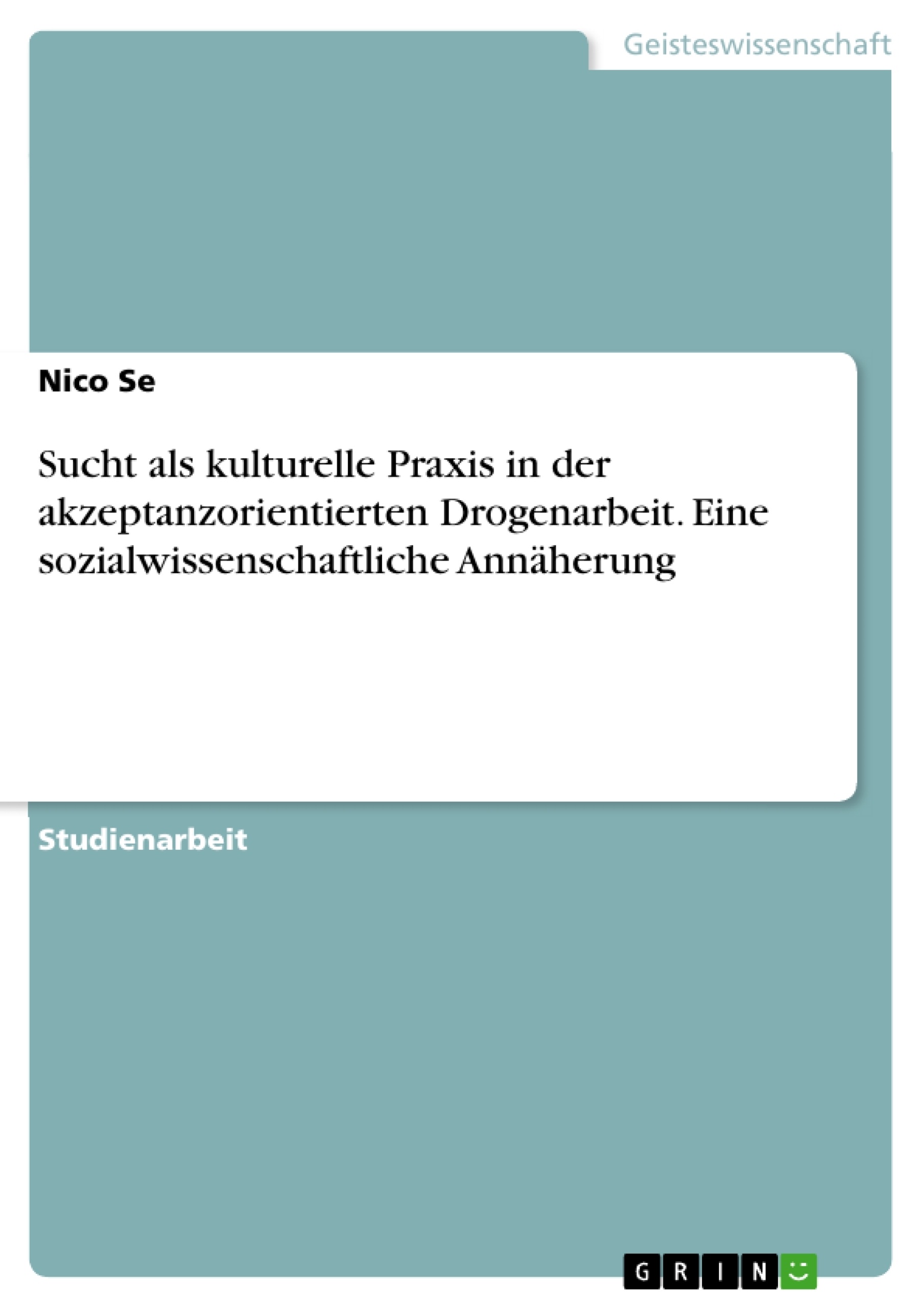Die vorliegende Hausarbeit möchte sich mit der Theorie der Sucht, ihrer Entwicklungen und mit Handlungsoptionen in der Drogenhilfe im Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit auseinandersetzen. Dabei wird im ersten Teil versucht den Begriff des Rausches näher zu beleuchten, um dann über die medizinisch geprägten Begriffe der Droge bzw. Substanz und der Abhängigkeit sich dann der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung des Drogenkonsums zu nähern. Diese stellen die Grundlage der vorliegenden Arbeit dar und definiert dabei Sucht als kulturelle Praxis. Im Besonderen soll hier der Labeling-Ansatz betrachtet werden. Es wird im weiteren Verlauf ein Bogen zur akzeptanzorientierten Drogenarbeit geschlagen und die wichtigsten Grundlagen und Positionen skizziert. Eine Fokussierung auf eine abstinenzorientierte Drogenarbeit findet nicht statt, da diese als ineffektiv zu beschreiben ist, Abhängige pathologisiert und dadurch Selbsthilfepotentiale der betroffenen Personen oft außer Acht lässt.
In dem zweiten Teil der Hausarbeit wird überblicksartig das Modell der Lebensweltorientierung dargestellt. Das Konzept „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ nähert sich der Nutzer:innen in der Sozialen Arbeit über die Begriffe der Alltäglichkeit und der alltäglichen Lebenswelt und einer Abkehr von medizinisch geprägten Hilfsformen der Sozialen Arbeit. Diese Begrifflichkeiten haben in der akzeptanzorientierten Drogenarbeit einen hohen Stellenwert. Self-Empowerment oder Harm-Reduction der Nutzer:innen werden erst durch Konzepte wie Dialogfähigkeit, Niedrigschwelligkeit, Alltagsnähe oder einer strukturierten Offenheit möglich. Daraus ergibt sich eine Arbeitshypothese, dass den sozialwissenschaftlichen Ansatz „Sucht als kulturelle Praxis“ als Grundlage der Sucht begreift und daraus schlussfolgernd eine akzeptanzorientierten Drogenpolitik in Verbindung mit einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit als notwendige Drogenpolitik annimmt. Im letzten Kapitel soll dies anhand der Aufsuchenden Sozialen Arbeit überprüft werden, denn diese bedient sich in der Praxis der Konzepte der akzeptanzorientierte Drogenpolitik in Verbindung mit einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie der Sucht
- Konsum, Rausch, Droge, Abhängigkeit - eine medizinisch & begriffliche Annäherung
- Eine Sozialwissenschaftliche Suchttheorie
- Akzeptanzorientierte Drogenarbeit
- Lebensweltorientierung und Aufsuchende Soziale Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit der Theorie der Sucht, ihrer Entwicklungen und mit Handlungsoptionen in der Drogenhilfe im Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit auseinander. Dabei wird der Begriff des Rausches beleuchtet und sich über die medizinisch geprägten Begriffe der Droge bzw. Substanz und der Abhängigkeit der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Drogenkonsum genähert.
- Entwicklung der Theorie der Sucht
- Medizinische und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Rausch und Abhängigkeit
- Akzeptanzorientierte Drogenarbeit als Handlungsansatz
- Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit
- Aufsuchende Soziale Arbeit als Beispiel für akzeptanzorientierte Drogenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Diskrepanz zwischen der deutschen Drogenprävention, die von einem "Sag Nein zu Drogen"-Mantra geprägt ist, und einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die von Schuldzuweisungen, Verdrängung und Stigmatisierung geprägt ist. Die Arbeit stellt die Bedeutung des Rausches als existenzielle Erfahrung heraus und kritisiert die Reduktion von Sucht auf ein medizinisches Problem.
Theorie der Sucht
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Suchttheorie vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Es beleuchtet den Wandel vom Krankheitsmodell, das Sucht als individuelles Problem betrachtet, hin zu einem sozial-historischen Verständnis, das soziale Faktoren in den Blick nimmt. Es wird zudem die Kritik an der medizinischen Pathologisierung von Rausch und Abhängigkeit sowie die Bedeutung des Labeling-Ansatzes diskutiert.
Akzeptanzorientierte Drogenarbeit
In diesem Kapitel wird die akzeptanzorientierte Drogenarbeit als Gegenmodell zur abstinenzorientierten Drogenarbeit vorgestellt. Die Arbeit kritisiert die Ineffektivität und Pathologisierung von Abhängigen in der abstinenzorientierten Drogenarbeit und stellt die Bedeutung von Selbsthilfepotentialen in den Vordergrund.
Lebensweltorientierung und Aufsuchende Soziale Arbeit
Das Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit wird hier erläutert. Dieser Ansatz fokussiert auf die Alltagswelt der Nutzer:innen und strebt eine Abkehr von medizinisch geprägten Hilfsformen an. Die Bedeutung von Self-Empowerment und Harm-Reduction sowie Konzepte wie Dialogfähigkeit, Niedrigschwelligkeit und Alltagsnähe werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Sucht, Rausch, Droge, Abhängigkeit, Akzeptanz, Drogenpolitik, Lebensweltorientierung, Aufsuchende Soziale Arbeit, Labeling-Ansatz, Harm-Reduction, Selbsthilfe, und Selbstbestimmung.
- Quote paper
- Nico Se (Author), 2021, Sucht als kulturelle Praxis in der akzeptanzorientierten Drogenarbeit. Eine sozialwissenschaftliche Annäherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1351713