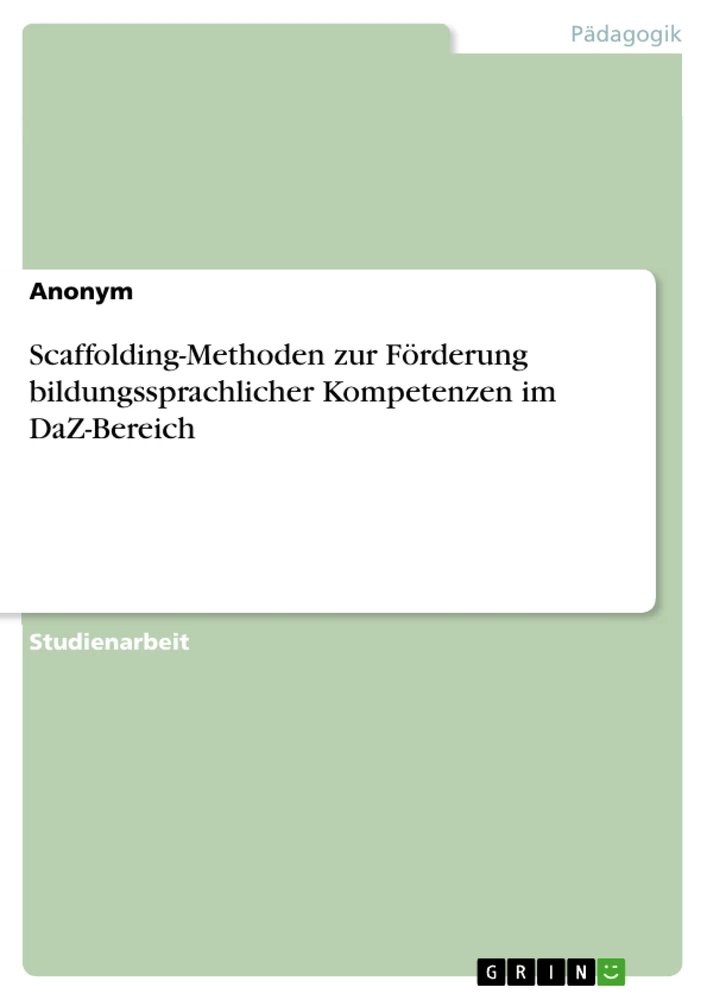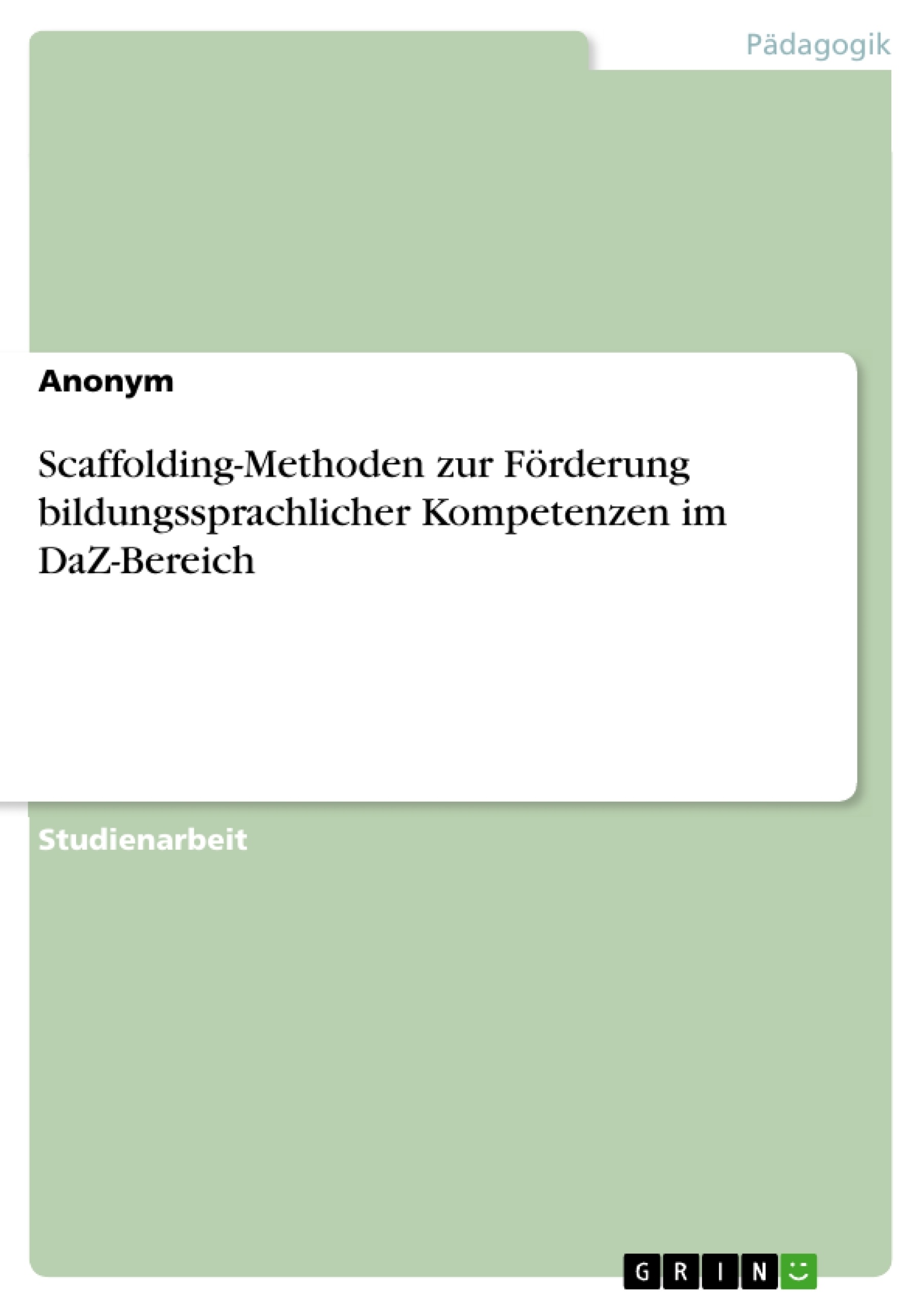Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, zu ermitteln, wie das gezielte Einsetzen von Scaffolding-Methoden der Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen von Grundschüler:innen mit Deutsch als Zweitsprache dienen kann. Um dies beantworten zu können, muss zuvor eine Reihe von begrifflichen Klärungen und Differenzierungen vorgenommen werden. Hierfür wird auf den Begriff der Bildungssprache näher eingegangen, um später dessen Problematik zu thematisieren. Dabei wird der Einfluss, den die Erst- oder Zweitsprache von Schüler:innen auf deren jeweilige bildungssprachliche Kompetenzen haben, dargestellt. Darauf folgt eine nähere Betrachtung des Scaffoldings, wobei die Idee an sich und die einzelnen Formen vorgestellt wird. Auf Basis dieser theoretischen Grundlagen folgt der praktische Teil dieser Arbeit, indem ein Umsetzungskonzept des Scaffoldings von Quehl und Trapp (2013) bezüglich der einzelnen zuvor erläuterten Aspekte der Scaffolding-Methoden analysiert und dabei Antworten zur gestellten Forschungsfrage formuliert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutsch als Zweitsprache in Deutschland
- Begriffsbestimmungen und Abgrenzung
- Die Problematik der Bildungssprache
- Scaffolding-Methoden als möglicher Lösungsansatz
- Begriffsbestimmung und Merkmale des Scaffoldings
- Arten von Scaffolding
- Scaffolding-Methoden im Unterricht
- Vorgehen und Material
- Ergebnisse und Diskussion
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einsatz von Scaffolding-Methoden zur Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Grundschulkindern mit Deutsch als Zweitsprache. Die Arbeit klärt zunächst begriffliche Grundlagen, insbesondere den Begriff der Bildungssprache und seine Problematik. Anschließend wird das Scaffolding-Konzept im Detail vorgestellt. Der praktische Teil analysiert ein Umsetzungskonzept und diskutiert dessen Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage.
- Die Bedeutung der Bildungssprache für den Schulerfolg
- Herausforderungen für Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache
- Scaffolding als methodischer Ansatz zur Sprachförderung
- Analyse eines konkreten Scaffolding-Konzepts
- Zusammenhang zwischen Scaffolding und bildungssprachlicher Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Sprache, insbesondere der Bildungssprache, für den Lernerfolg. Sie führt in die Thematik der sprachlichen Herausforderungen von Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache ein und formuliert die Forschungsfrage der Arbeit: Inwiefern kann der gezielte Einsatz von Scaffolding-Methoden zur Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen dieser Schüler*innengruppe beitragen? Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil, der sich mit der Analyse eines konkreten Scaffolding-Konzepts befasst.
Deutsch als Zweitsprache in Deutschland: Dieses Kapitel klärt zunächst die Begriffe Erst- und Zweitsprache sowie die Abgrenzung zu Fremdsprachen. Es wird zwischen medialer und konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit differenziert, um die Besonderheiten der Bildungssprache zu verdeutlichen. Die Bildungssprache wird als dekontextualisierte, komplexe Sprache mit spezifischem Wortschatz und Satzbau beschrieben. Abschließend wird die Problematik der Bildungssprache im Schulunterricht beleuchtet, wobei die Schwierigkeiten von Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache im Umgang mit dieser Sprache hervorgehoben werden. Die mangelnde explizite Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen wird als zentrale Herausforderung identifiziert.
Scaffolding-Methoden als möglicher Lösungsansatz: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Scaffolding" und beschreibt dessen Merkmale im Kontext der sprachlichen Förderung. Es werden die verschiedenen Arten von Scaffolding erläutert und der Ansatz von Pauline Gibbons vorgestellt, die Makro- und Mikro-Scaffolding mit den dazugehörigen Bausteinen (Bedarfsanalyse, Lernstandsanalyse, Unterrichtsplanung und Unterrichtsinteraktion) unterscheidet. Der Fokus liegt auf der Verbindung von fachlichem und sprachlichem Lernen durch Scaffolding-Methoden.
Schlüsselwörter
Bildungssprache, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Scaffolding, Sprachförderung, Grundschule, konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit, sprachliche Kompetenzen, Lernmethoden, interkulturelle Kompetenz, Chancengleichheit
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Scaffolding-Methoden zur Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Grundschulkindern mit Deutsch als Zweitsprache
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einsatz von Scaffolding-Methoden zur Verbesserung der bildungssprachlichen Kompetenzen von Grundschulkindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Sie analysiert, wie Scaffolding-Methoden dazu beitragen können, die sprachlichen Herausforderungen dieser Schüler*innen zu bewältigen und ihren Lernerfolg zu fördern.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Begriffsbestimmungen (Bildungssprache, DaZ), die Problematik der Bildungssprache für DaZ-Schüler*innen, die Definition und verschiedene Arten von Scaffolding-Methoden, die Anwendung von Scaffolding im Unterricht (inkl. Vorgehen und Material), eine Analyse der Ergebnisse und eine Diskussion der Forschungsfrage: Inwiefern kann Scaffolding die bildungssprachliche Kompetenz von DaZ-Schüler*innen verbessern?
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern kann der gezielte Einsatz von Scaffolding-Methoden zur Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen von Grundschulkindern mit Deutsch als Zweitsprache beitragen? Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Scaffolding und bildungssprachlicher Kompetenz und analysiert ein konkretes Scaffolding-Konzept.
Welche Methoden werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit der Analyse eines praktischen Umsetzungskonzepts von Scaffolding-Methoden im Unterricht. Es werden die Ergebnisse dieses Konzepts diskutiert und im Hinblick auf die Forschungsfrage ausgewertet.
Welche Arten von Scaffolding werden beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene Arten von Scaffolding und konzentriert sich insbesondere auf den Ansatz von Pauline Gibbons, der Makro- und Mikro-Scaffolding mit Bausteinen wie Bedarfsanalyse, Lernstandsanalyse, Unterrichtsplanung und Unterrichtsinteraktion unterscheidet.
Welche Bedeutung hat die Bildungssprache in dieser Arbeit?
Die Bildungssprache wird als zentrale Herausforderung für DaZ-Schüler*innen identifiziert. Die Arbeit betont die Bedeutung der expliziten Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen für den Schulerfolg und untersucht, wie Scaffolding-Methoden dabei helfen können, diese Lücke zu schließen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bildungssprache, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Scaffolding, Sprachförderung, Grundschule, konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit, sprachliche Kompetenzen, Lernmethoden, interkulturelle Kompetenz und Chancengleichheit.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu DaZ in Deutschland (inkl. Begriffsbestimmungen und der Problematik der Bildungssprache), zu Scaffolding-Methoden als Lösungsansatz, zu Scaffolding-Methoden im Unterricht (Vorgehen, Material, Ergebnisse und Diskussion), ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Die Kapitelzusammenfassungen geben einen detaillierten Überblick über die Inhalte der einzelnen Abschnitte.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Lehrende, Studierende der Pädagogik und Sprachwissenschaft, sowie alle, die sich für Sprachförderung, insbesondere im Kontext von DaZ, interessieren. Sie bietet wertvolle Einblicke in die Anwendung von Scaffolding-Methoden im Unterricht und deren Wirksamkeit.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Scaffolding-Methoden zur Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen im DaZ-Bereich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1352056