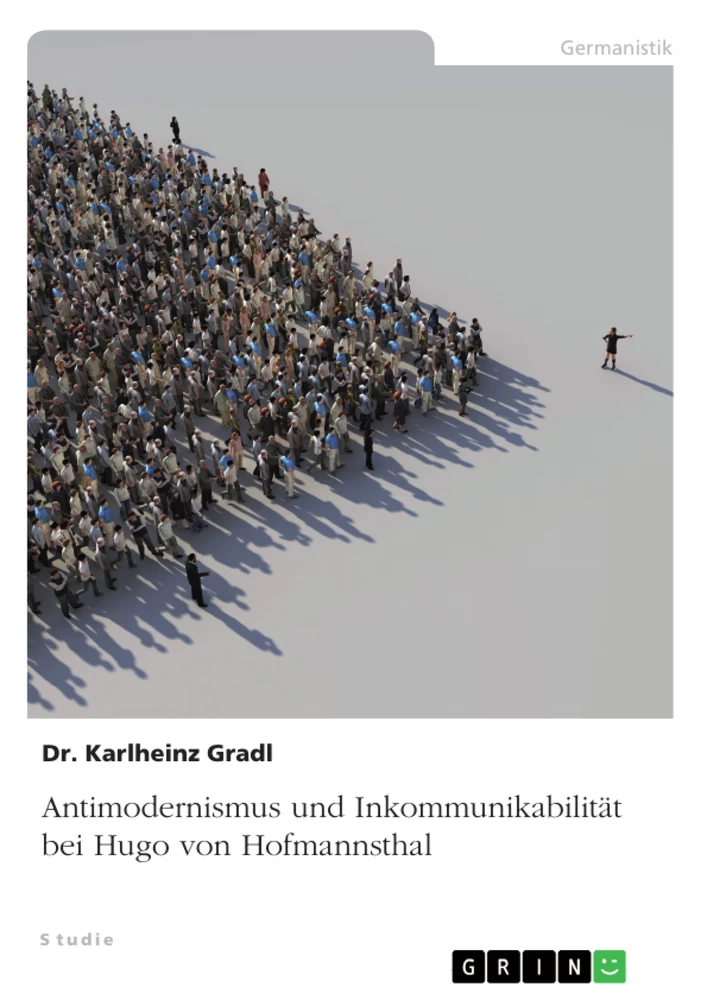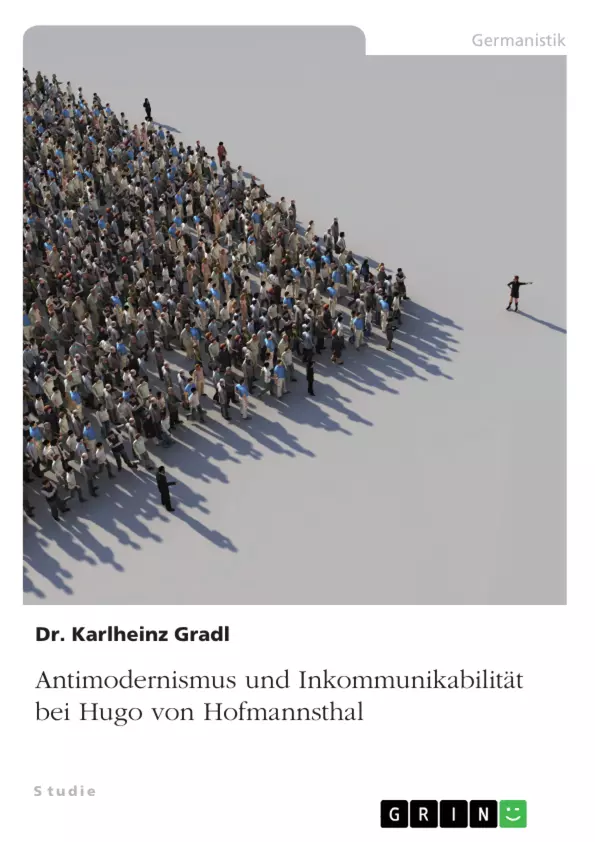Das zeitgeschichtliche Phänomen eines „zur Kultur Werden der Kultur“ hat Adorno als Symptom beginnenden Zerfalls eines kulturell reflektierten gesellschaftlichen Bewusstseins beschrieben, „denn in der Zurücknahme auf sich selbst“ dichtet Kultur sich ab „gegenüber der Fatalität des Lebensprozesses“ im Versuch, die „Idee der Reinheit“ zu bewahren“. Diese Idee, die nach dem Verlust des Absolutheitsanspruchs der (christlichen) Religion im Säkularisierungsprozess der Neuzeit die Funktion einer metaphysischen Instanz übernimmt, führt bei denen, die sie auf kultureller Ebene repräsentieren, zur Distanzierung von der kontingenzbehafteten Realität sowie zur Fixierung auf ein Verständnis von Kultur als Reservoire vermeintlich zeitlos gültiger Werte und Einsichten. Eng verknüpft mit dem Prozess aber ist ein Weltbild, das sich auf der Ebene gesellschaftlichen Bewusstseins im Widerstand gegen eine, jene „Reinheit“ kontinuierlich in Frage stellende Moderne artikuliert.
Moderne, gesellschaftstheoretisch definiert, ist der von der Aufklärung in Gang gebrachte Prozess der „Enttraditionalisierung“ von Weltbildern im Hinblick auf deren Eigenschaft, „Vertrautheit, Transparenz und Zuverlässigkeit“ im kommunikativen Handeln der Subjekte gewährleisten zu können. Der Vorgang führt im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einer Autonomisierung verschiedener Bereiche gesellschaftlichen Lebens und dementsprechend zur Konstituierung multipler, nicht mehr zwangsläufig religiöser und damit ganzheitlich begründeter Weltbildkonstruktionen. In Abgrenzung zu den Lebenswelten der sogenannten „Masse“, wird das Bildungsbürgertum dabei zur bevorzugten sozialen Trägerschicht einer Weltanschauung, deren „reines“, Ganzheitlichkeit ausschließlich auf der Ebene des Kulturellen verwirklichendes Ethos wesentlich bestimmt wird von der nach 1800 in den Rang eines „deutschen Mythos“ auf- gestiegenen literarischen Hochkultur Weimars. Der damit erhobene intellektuelle „Anspruch auf Verallgemeinerung“ eines den Kontingenzen des Sozialen enthobenen, exklusiven Weltbilds aber erlaubt es dem Bildungsbürgertum, den eigenen gesellschaftlichen Status kontinuierlich „nach unten hin abzugrenzen“.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Oper
- Ariadne auf Naxos
- Drama
- Rede
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die antimodernistische Haltung Hugo von Hofmannsthals und die damit verbundene Inkommunikabilität. Er beleuchtet die Wurzeln dieses Denkens im Kontext des Bildungsbürgertums und des Wiener Ästhetizismus. Dabei geht es um die Frage, wie Hofmannsthal die „Idee der Reinheit“ als Gegenentwurf zur Moderne und ihren vermeintlichen Zerfallsphänomenen konzipierte.
- Antimodernismus und die „Idee der Reinheit“ als Reaktion auf den Zerfall des kulturellen Bewusstseins
- Inkommunikabilität als Resultat der Distanzierung von der modernen Gesellschaft
- Die Rolle des Mythos in Hofmannsthals Werken als Reservoir vermeintlich zeitloser Werte
- Die Konstruktion einer geschlossenen Weltanschauung und ihre Abgrenzung gegenüber der „Masse“
- Die Darstellung von Beziehungen und Ehe im Kontext des Bildungsbürgertums und der „Idee der Reinheit“
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung
Der Abschnitt beleuchtet die Entstehung des Antimodernismus als Reaktion auf die „Enttraditionalisierung“ und „Autonomisierung“ von Weltbildern in der Moderne. Die „Idee der Reinheit“ wird als Versuch beschrieben, den Verlust des Absolutheitsanspruchs der Religion zu kompensieren und eine geschlossene Weltanschauung zu etablieren.
Oper
Die Analyse von Hofmannsthals Libretto für Ariadne auf Naxos zeigt die Konstruktion einer idealisierten Beziehung zwischen Bacchus und Ariadne, die als Modell für eine dauerhafte, göttlich legitimierte Verbindung zwischen Mann und Frau dient. Die „Frau, die nur einmal liebt“ steht im Kontrast zur „Frau, die viele Male sich gibt“ und die Dauerhaftigkeit der Beziehung hängt von Ariadnes „Treue“ und der Bewährung in der „Verwandlung“ ab.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Analyse zu Hugo von Hofmannsthal?
Die Arbeit untersucht den Antimodernismus und die Inkommunikabilität bei Hofmannsthal als Reaktion auf den gesellschaftlichen Zerfall kulturellen Bewusstseins.
Was wird unter der „Idee der Reinheit“ verstanden?
Sie dient als metaphysische Instanz, die nach dem Verlust religiöser Gewissheiten eine Distanzierung von der Realität und eine Fixierung auf zeitlose kulturelle Werte ermöglicht.
Wie definiert der Text die „Moderne“?
Moderne wird als Prozess der Enttraditionalisierung von Weltbildern beschrieben, der zur Autonomisierung verschiedener Lebensbereiche führt.
Welche Rolle spielt das Bildungsbürgertum in diesem Kontext?
Das Bildungsbürgertum nutzte die literarische Hochkultur, um seinen gesellschaftlichen Status nach unten abzugrenzen und ein exklusives, ganzheitliches Weltbild zu bewahren.
Wie wird „Ariadne auf Naxos“ in die Argumentation einbezogen?
Anhand der Oper wird die Konstruktion idealisierter, göttlich legitimierter Beziehungen analysiert, die als Gegenentwurf zur modernen Beliebigkeit dienen.
- Citation du texte
- Dr. Karlheinz Gradl (Auteur), 2023, Antimodernismus und Inkommunikabilität bei Hugo von Hofmannsthal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1352220