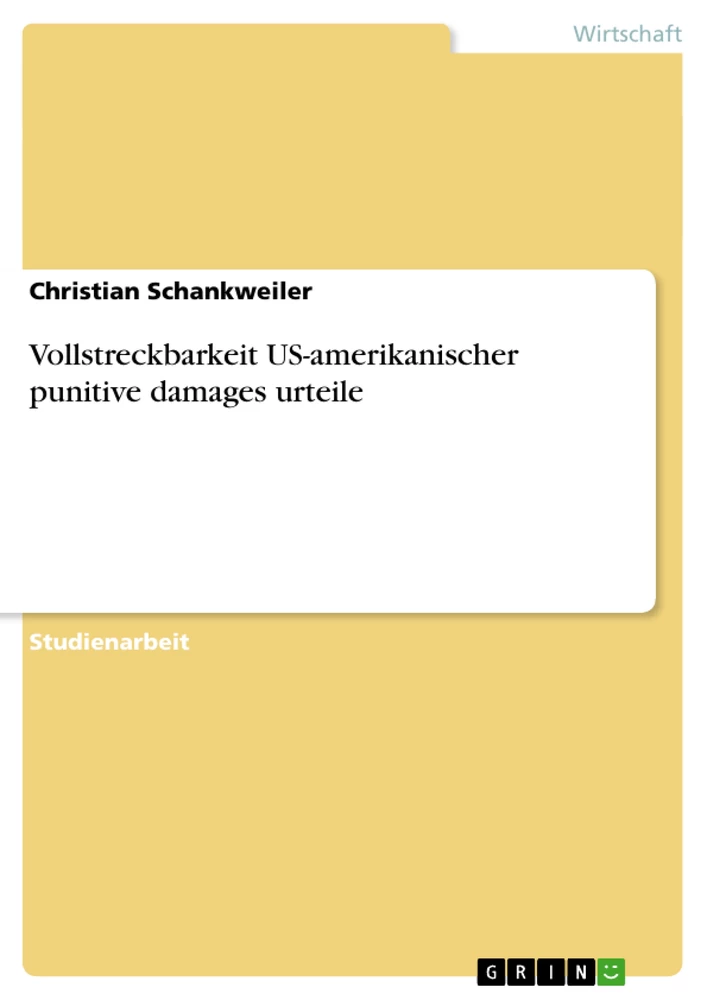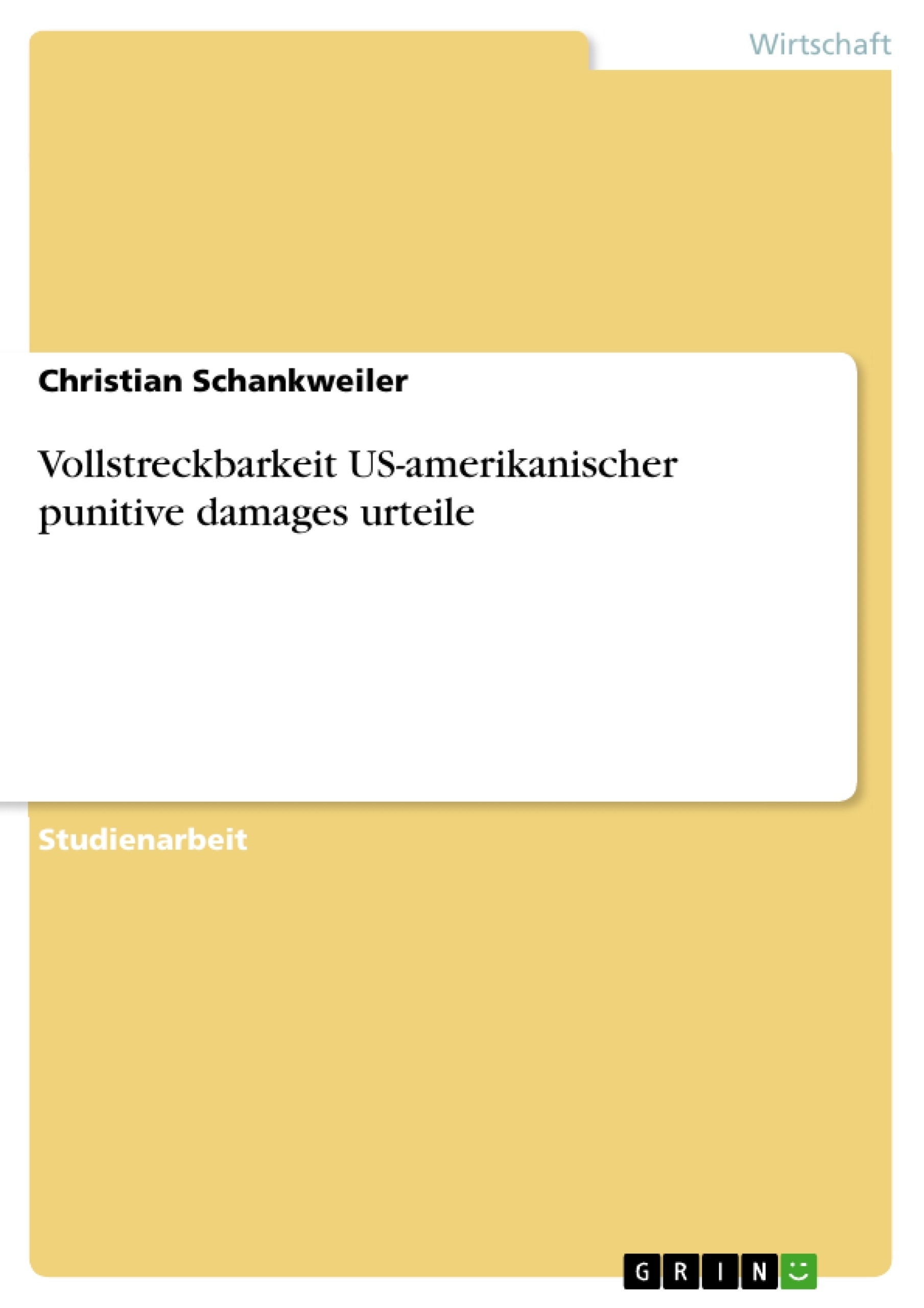In der Vergangenheit haben amerikanische Schadensersatzurteile wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. So verklagte eine amerikanische Kundin das Fast-food-Restaurant McDonalds. Die Klägerin hatte sich an einem Drive-In-Schalter einen Kaffee gekauft, den sie während der Fahrt verschüttete und dadurch Verbrühun-gen an den Beinen erlitt. Die Klägerin argumentierte, daß der Kaffee besonders heiß gewesen sei und deshalb besonders schwere Verbrühungen verursacht wur-den. Das Gericht gab der Klägerin Recht und verurteilte McDonalds zur Zahlung eines Geldbetrages in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar. Zwar wurde der Betrag später auf 480.000 US-Dollar herabgesetzt, er erscheint jedoch im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit zumindest bedenklich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- US-amerikanisches Schadensersatzrecht
- Nominal damages
- Compensatory damages
- Punitive damages
- Funktionen
- Voraussetzungen
- Höhe
- Rechtsordnung in Deutschland
- Öffentliches Recht
- Privatrecht
- Vollstreckbarkeit
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Gesetzliche Grundlagen
- Rechtsprechung
- Problematik
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage der Vollstreckbarkeit von US-amerikanischen "punitive damages"-Urteilen in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf den Besonderheiten des amerikanischen Schadensersatzrechts im Vergleich zum deutschen Rechtssystem. Darüber hinaus werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Vollstreckbarkeit von ausländischen Urteilen in Deutschland sowie die damit verbundene Problematik diskutiert.
- US-amerikanisches Schadensersatzrecht: "punitive damages" und ihre Funktionsweise
- Vergleich des amerikanischen Schadensersatzrechts mit dem deutschen Rechtssystem
- Rechtliche Grundlagen für die Vollstreckbarkeit von ausländischen Urteilen in Deutschland
- Problematik der Vollstreckbarkeit von "punitive damages"-Urteilen
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen der Vollstreckbarkeit von ausländischen Urteilen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz von "punitive damages"-Urteilen im Kontext internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Am Beispiel von McDonalds und BMW wird verdeutlicht, warum deutsche Unternehmen von solchen Urteilen betroffen sein können.
- US-amerikanisches Schadensersatzrecht: Dieses Kapitel beleuchtet die drei Arten von Schadensersatzansprüchen im US-amerikanischen Recht: "nominal damages", "compensatory damages" und "punitive damages". Besonderes Augenmerk liegt auf der Erklärung der Funktion und der Voraussetzungen von "punitive damages".
- Rechtsordnung in Deutschland: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über das deutsche Rechtssystem im Vergleich zum US-amerikanischen Recht. Es zeigt auf, wie das deutsche Rechtssystem mit dem Problem der Vollstreckbarkeit von ausländischen Urteilen umgeht.
- Vollstreckbarkeit: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Vollstreckbarkeit von US-amerikanischen "punitive damages"-Urteilen in Deutschland. Es beleuchtet die geltenden Gesetze und die Rechtsprechung, die im Zusammenhang mit der Vollstreckbarkeit von ausländischen Urteilen relevant sind.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: "punitive damages", Schadensersatzrecht, internationales Privatrecht, Vollstreckung, Gerichtsbarkeit, Rechtsvergleichung, USA, Deutschland, "compensatory damages", "nominal damages", Rechtssystem, Rechtsvergleichung, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „punitive damages“?
Es handelt sich um „Strafschadensersatz“ im US-Recht, der über den eigentlichen Schaden hinausgeht, um den Schädiger zu bestrafen und abzuschrecken.
Können US-Urteile zu punitive damages in Deutschland vollstreckt werden?
In der Regel nicht, da sie dem deutschen „Ordre Public“ widersprechen; das deutsche Recht kennt Schadensersatz primär nur als Ausgleich, nicht als Strafe.
Was ist der Unterschied zu „compensatory damages“?
Compensatory damages dienen dem tatsächlichen Ausgleich des entstandenen Schadens (z. B. Arztkosten), was auch im deutschen Recht anerkannt ist.
Warum sind deutsche Unternehmen von diesen Urteilen betroffen?
Wenn deutsche Firmen in den USA tätig sind oder Produkte dorthin exportieren, können sie vor US-Gerichten auf Millionenbeträge verklagt werden.
Welche Rolle spielt der „Ordre Public“?
Er schützt die grundlegenden Werte der deutschen Rechtsordnung vor der Vollstreckung ausländischer Urteile, die diesen Werten massiv widersprechen.
- Quote paper
- Christian Schankweiler (Author), 2002, Vollstreckbarkeit US-amerikanischer punitive damages urteile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13525