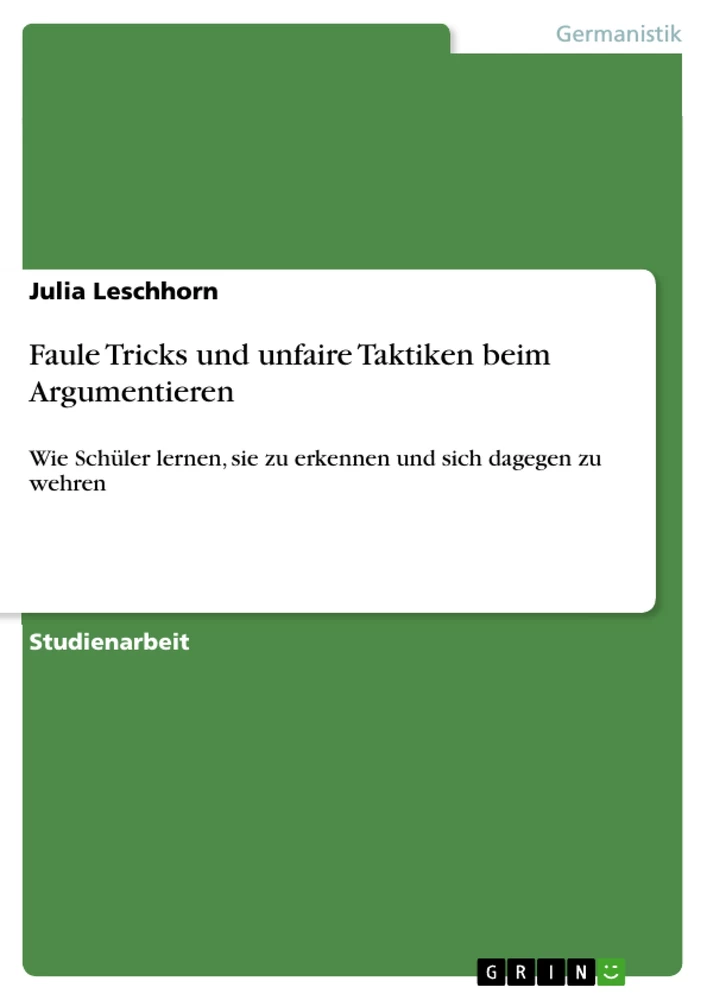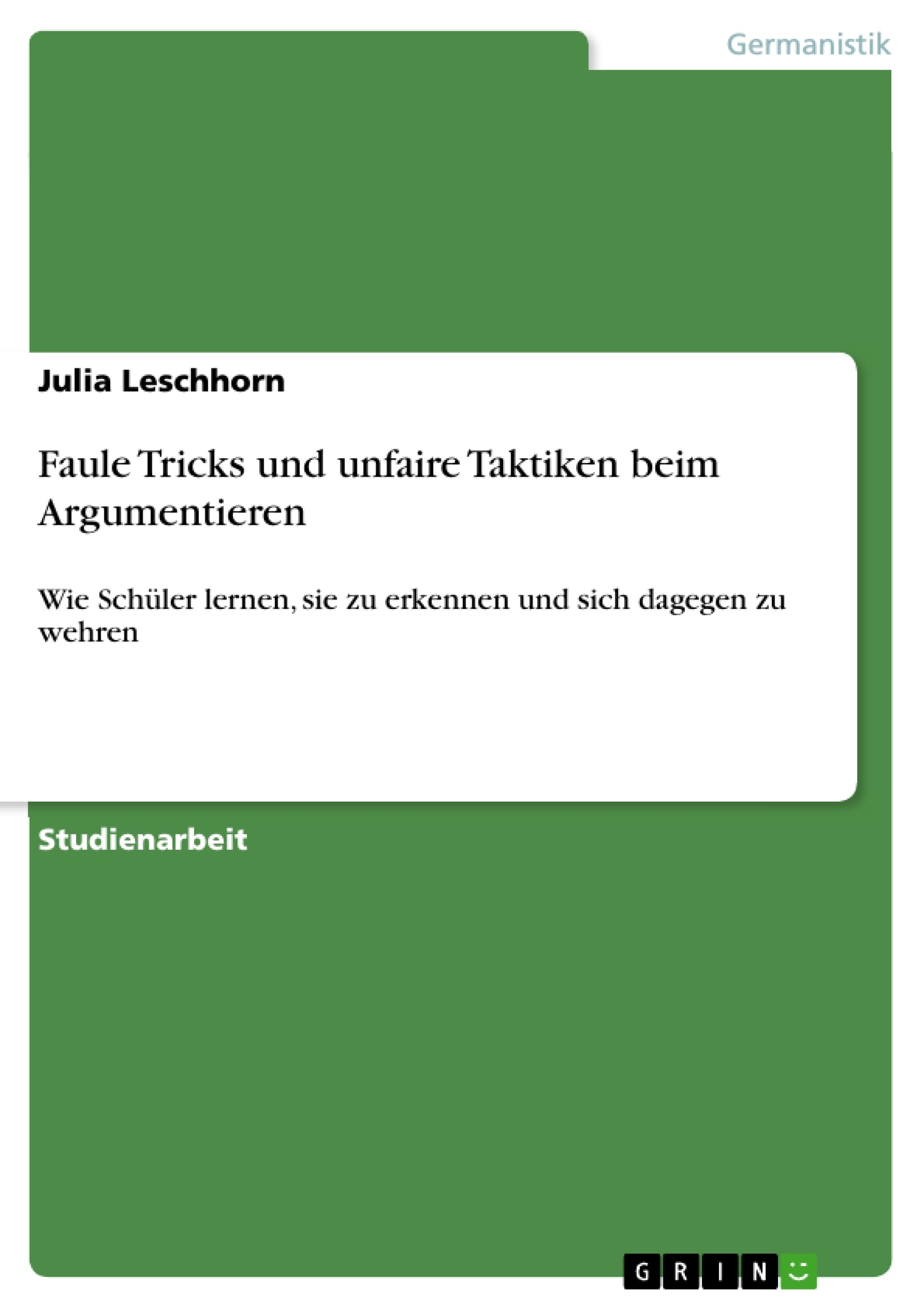Argumentieren ist eine Handlung, die man jeden Tag – auch häufig unbewusst - vornimmt. Es handelt sich dabei um eine gewaltfreie Lösung von Konflikten. Man versucht, „durch Austausch von Argumenten eine gemeinsame Sprache und damit eine gemeinsame Sicht der Welt zu finden oder wiederherzustellen.“ Ob in der Politik, in der Schule oder einfach in der Familie und unter Freunden, überall wird argumentiert und diskutiert. Meist argumentiert man, wenn Erwartungen enttäuscht wurden oder unterschiedliche Ansichten aufeinanderprallen.
Viele Argumentationen verlaufen nicht immer ganz fair. Häufig, besonders, wenn wir keine Lust zum diskutieren haben oder wir uns in einer Diskussion in auswegslosen Lagen befinden, in denen wir nicht eingestehen wollen, dass unser Argumentationspartner doch im Recht ist, wenden wir unfaire Taktiken und Tricks an. Mit diesen unterdrücken wir eine faire Argumentation.
Jeder von uns kennt solche Situationen. Wie soll man sich verhalten, wenn der Argumentationspartner den anderen nicht zu Wort kommen lässt oder wie, wenn man persönlich angegriffen wird?
Schnell ist man sprachlos, wenn der Argumentationspartner solche unfairen Taktiken zur Anwendung bringt. Man schaut hilflos dabei zu, wie es der Gegner schafft, einen selbst in Widersprüche zu verstricken, verunsichert und schließlich dazu bringt, ihm zuzustimmen, nur weil er die bessere Taktik besitzt oder mehr Kniffs und Tricks kennt. Man glaubt, den Argumenten des anderen gewachsen zu sein und scheitert dennoch an dessen Verteidigungstricks.
Auch wenn man in der Schule einiges über das Argumentieren lernt, bekommt man doch zu selten erklärt, wie man sich gegen unfaire Taktiken und faule Tricks wehren kann, da in Schulen häufig die konsensorientierte Diskussion bevorzugt geübt wird.
Hier soll diese Arbeit ansetzen. Es sollen am Beispiel politischer Flugblätter, Zeitungen und Fernsehdebatten einige solcher fauler Tricks und unfairer Taktiken aufgezeigt werden. Zudem wird erklärt, wie man sich dagegen wehren kann. Anschließend sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man in der Schule lehren kann, unfaire Taktiken in Argumentationen zu erkennen und sich dagegen zu wehren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Unfaire Taktiken und faule Tricks
2.1 Scheinalternativen
2.2 Persönliche Diffamierungen
2.3 Verdrehung der gegnerischen Argumentation
3. Argumentieren in der Schule
3.1 Wie man sich gegen unfaire Taktiken wehren kann
3.2 Argumentationsübungen für den Unterricht
4. Resümee
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Argumentieren ist eine Handlung, die man jeden Tag – auch häufig unbewusst - vornimmt. Es handelt sich dabei um eine gewaltfreie Lösung von Konflikten.[1] Man versucht, „durch Austausch von Argumenten eine gemeinsame Sprache und damit eine gemeinsame Sicht der Welt zu finden oder wiederherzustellen.“[2] Ob in der Politik, in der Schule oder einfach in der Familie und unter Freunden, überall wird argumentiert und diskutiert. Meist argumentiert man, wenn Erwartungen enttäuscht wurden oder unterschiedliche Ansichten aufeinanderprallen.[3]
Viele Argumentationen verlaufen nicht immer ganz fair. Häufig, besonders, wenn wir keine Lust zum diskutieren haben oder wir uns in einer Diskussion in auswegslosen Lagen befinden, in denen wir nicht eingestehen wollen, dass unser Argumentationspartner doch im Recht ist, wenden wir unfaire Taktiken und Tricks an. Mit diesen unterdrücken wir eine faire Argumentation.
Jeder von uns kennt solche Situationen. Wie soll man sich verhalten, wenn der Argumentationspartner den anderen nicht zu Wort kommen lässt oder wie, wenn man persönlich angegriffen wird?
Schnell ist man sprachlos, wenn der Argumentationspartner solche unfairen Taktiken zur Anwendung bringt. Man schaut hilflos dabei zu, wie es der Gegner schafft, einen selbst in Widersprüche zu verstricken, verunsichert und schließlich dazu bringt, ihm zuzustimmen, nur weil er die bessere Taktik besitzt oder mehr Kniffs und Tricks kennt. Man glaubt, den Argumenten des anderen gewachsen zu sein und scheitert dennoch an dessen Verteidigungstricks.
Auch wenn man in der Schule einiges über das Argumentieren lernt, bekommt man doch zu selten erklärt, wie man sich gegen unfaire Taktiken und faule Tricks wehren kann, da in Schulen häufig die konsensorientierte Diskussion bevorzugt geübt wird.
Hier soll diese Arbeit ansetzen. Es sollen am Beispiel politischer Flugblätter, Zeitungen und Fernsehdebatten[4] einige solcher fauler Tricks und unfairer Taktiken aufgezeigt werden. Zudem wird erklärt, wie man sich dagegen wehren kann. Anschließend sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man in der Schule lehren kann, unfaire Taktiken in Argumentationen zu erkennen und sich dagegen zu wehren.
2. Unfaire Taktiken und faule Tricks
Es gibt eine ganze Reihe von unfairen Taktiken und faulen Tricks, die beim Argumentieren zur Anwendung kommen können. Besonders wer seinen Argumentationspartner beeindrucken oder manipulieren will, wendet unfaire Tricks an, aber auch, um sich selbst zu verteidigen oder um die Argumente des anderen zu entkräften.[5]
In einer sachlichen Diskussion sollten solche Absichten allerdings nicht dazu verführen, sich unfair zu verhalten.[6] Vielmehr sollte man seine Argumente gemeinsam prüfen und sie daher sachlich formulieren, was das Verständnis erleichtert.[7]
Da es dennoch häufig vorkommt, dass unfaire Tricks in Argumentationen verwendet werden, sollen im Folgenden einige davon vorgestellt werden.
2.1 Scheinalternativen
Nicht selten werden in einer Diskussion nur zwei Antworten zur Wahl gestellt, obwohl mehrere denkbar wären.[8] Man spricht hier von Scheinalternativen, falschen Alternativen oder auch von der Entweder-Oder-Taktik.
Die Entweder-Oder-Taktik beruht auf „eine[r] grobe[n] Vereinfachung der tatsächlichen Verhältnisse“.[9] Der Argumentierende stellt lediglich zwei Möglichkeiten vor, obwohl meist wesentlich mehr erdenklich wären.[10] Damit will er erzwingen, dass man einem seiner beiden Lösungsvorschläge zustimmt.[11] Eine der beiden vorgeschlagenen Möglichkeiten ist zudem meist indiskutabel, so dass damit vom Argumentierenden erreicht werden soll, dass man sich dessen Ausführungen anschließt.[12]
Bsp.: Joschka Fischer in einer „Information zur Bundestagswahl am 18.September 2005“:
Sie entscheiden, ob es mit den Erneuerbaren Energien vorwärts geht – oder zurück zur Atomkraft von Angela Merkel. Ob Verbraucherschutz und Agrarwende auf der Tagesordnung bleiben – oder ob die alte Industrielle Agrarpolitik wiederkehrt.“[13]
Das Schema der Scheinalternativen ist ganz klar zu erkennen. Hier werden indirekte Fragen gestellt. Entweder Erneuerbare Energien oder Atomkraft. Entweder Verbraucherschutz und Agrarwende oder die alte Industrielle Agrarpolitik. Besonders in der letzten Frage - ob Verbraucherschutz und Agrarwende oder die alte Industrielle Agrarpolitik – wird deutlich, durch welche Mittel erreicht werden soll, dass man sich für die erste Alternative (Verbraucherschutz und Agrarwende) entscheiden soll. Das Wort „alte“ vor Industrielle Agrarwende soll assoziieren, dass das alte ausgedient hat und schlechter ist.
Nicht immer werden allerdings die beiden auf diesen Trick hinweisenden Wörter „entweder“ und „oder“ verwendet.[14]
Bsp.: Kristin Sager (MdB) in einer „Information zur Bundestagswahl am 18.September 2005“:
„Nur wenn wir viele gut ausgebildete Menschen in diesem Land haben, ist auch die deutsche Wirtschaft langfristig international wettbewerbsfähig.“[15]
Bei diesem Zitat handelt es sich um eine klassische Wenn-dann-Beziehung. Wenn wir ausgebildete Menschen im Land haben, dann ist auch die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig. Also wird auch hier eine Scheinalternative formuliert.
Zurückweisen kann man diesen faulen Trick des Argumentierenden, indem man die zahlreichen anderen Möglichkeiten aufzählt, die es noch gibt, z.B. durch ein „Es wäre aber auch möglich, dass,…“ oder ähnlichem.[16]
Zu bedenken ist allerdings, dass die Scheinalternativen nicht immer in der Absicht aufgezeigt werden, seinen Gegenspieler der Argumentation mit einem faulen Trick seine Auffassung aufzuzwingen.[17] Manchmal wird einfach übersehen, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt.[18]
Wichtig ist, dass man sich nicht erpressen lässt und leichtfertig eine der beiden Antwortvorschläge des Argumentierenden annimmt.[19] Die Entweder-oder-Taktik verliert schnell ihre Wirkung, wenn sie erstmal durchschaut ist.[20]
2.2 Persönliche Diffamierungen
Die persönliche Diffamierung ist ein beliebtes Mittel in Diskussionen, um einen Gegner aus dem Konzept zu bringen.[21] Es handelt sich bei solchen Unterstellungen um eine der häufigsten Störungen und den am meisten auftretenden Fehler in Diskussionen.[22] Durch die Angriffe auf die Person „sollen indirekt deren Argumente getroffen“ und somit außer Kraft gesetzt werden.[23]
Bsp.: Diskussion zwischen Bundeskanzler Schröder und dem Moderator Brender in der Berliner Runde (ZDF):[24]
Brender: Herr Bundeskanzler…
Schröder: Das ist aber nett, dass sie mich so nennen.
Brender: Sind sie etwa schon zurückgetreten?
Schröder: Nein, nein.
Brender: Also ich sage noch mal: Herr Bundeskanzler, denn das sind sie ja
noch…
Schröder: Ja, das bleib ich auch.
Brender: …bis zur Neuwahl eines neuen Kanzlers…
Schröder: Das bleib ich, auch wenn sie dagegen arbeiten.
Brender: Ob wir dagegen arbeiten? Sie haben von Medienmacht und Medienkampagne geredet. Ich weise sie darauf hin, dass der ARD und dem ZDF dies nicht vorzuwerfen ist. Nicht alles, was ihnen nicht passt, ist Medienkampagne.
[...]
[1] Vgl. Kienpointner, Manfred, Vernünftig argumentieren. Regeln und Techniken der Diskussion, Hamburg 1996, S. 7.
[2] Siehe ebd.
[3] Vgl. Völzing, Paul-Ludwig, Begründen, Erklären, Argumentieren. Modelle und Materialien zu einer Theorie der Metakommunikation, Heidelberg 1979, S. 19.
[4] Alle politischen Flugblätter und Zeitschriften, wie auch die Fernsehdebatten erschienen im Rahmen der Bundestagswahl 2005.
[5] Vgl. Weidenmann, Bernd, Diskussionstraining. Überzeugen statt überreden, argumentieren statt attackieren, Hamburg 1975, S. 89.
[6] Vgl. ebd.
[7] Vgl. ebd.
[8] Vgl. ebd., S. 94.
[9] Siehe Alt, Jürgen August, Miteinander diskutieren. Eine Einführung in die Praxis vernünftiger Argumentation, Frankfurt am Main 1994, S. 95.
[10] Vgl. ebd.
[11] Vgl. Alt, Jürgen August, Richtig argumentieren oder wie man in Diskussionen Recht behält, 3. Auflage, München 2000, S. 76.
[12] Vgl. Alt, Miteinander diskutieren, S. 95.
[13] Siehe Fischer, Joschka, Grüne Zeitung. Informationen zur Bundestagswahl am 18. September 2005.
[14] Vgl. Alt, Richtig argumentieren, S. 76.
[15] Siehe Sager, Katrin, Grün macht schlau. Bildung ist die zentrale Gerechtigkeitsfrage, in: Grüne Zeitung. Informationen zur Bundestagswahl am 18. September 2005, S. 5
[16] Vgl. Weidenmann, S. 94.
[17] Vgl. Alt, Miteinander diskutieren, S. 95.
[18] Vgl. ebd.
[19] Vgl. ebd.
[20] Vgl. ebd., S. 96.
[21] Vgl. Alt, Richtig argumentieren, S. 66.
[22] Vgl. Alt, Miteinander diskutieren, S. 85.
[23] Siehe ebd.
[24] Siehe ZDF Berliner Runde. Die Spitzenkandidaten der Parteien diskutieren den Ausgang der Wahl, www.zdf.de/ZDFmediathek/inhalt/12/0,4070,2376653-0.00.html
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Scheinalternativen" beim Argumentieren?
Dabei werden nur zwei Wahlmöglichkeiten präsentiert (Entweder-oder-Taktik), obwohl es in Wirklichkeit wesentlich mehr Optionen gäbe.
Wie wehrt man sich gegen persönliche Diffamierungen in Diskussionen?
Man sollte den persönlichen Angriff als solchen benennen, sachlich bleiben und darauf bestehen, zum eigentlichen Sachthema zurückzukehren.
Warum werden unfaire Taktiken in der Politik oft angewendet?
Sie dienen dazu, den Gegner zu verunsichern, ihn in Widersprüche zu verstricken oder die eigene Position durch Manipulation als alternativlos darzustellen.
Was lernt man in der Schule über faires Argumentieren?
Oft wird die konsensorientierte Diskussion geübt, jedoch kommt das Erkennen und Abwehren von "faulen Tricks" im Unterricht häufig zu kurz.
Was ist eine "Verdrehung der gegnerischen Argumentation"?
Hierbei wird die Aussage des Partners absichtlich falsch oder extrem verkürzt wiedergegeben, um sie leichter entkräften zu können.
- Arbeit zitieren
- Julia Leschhorn (Autor:in), 2005, Faule Tricks und unfaire Taktiken beim Argumentieren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135464