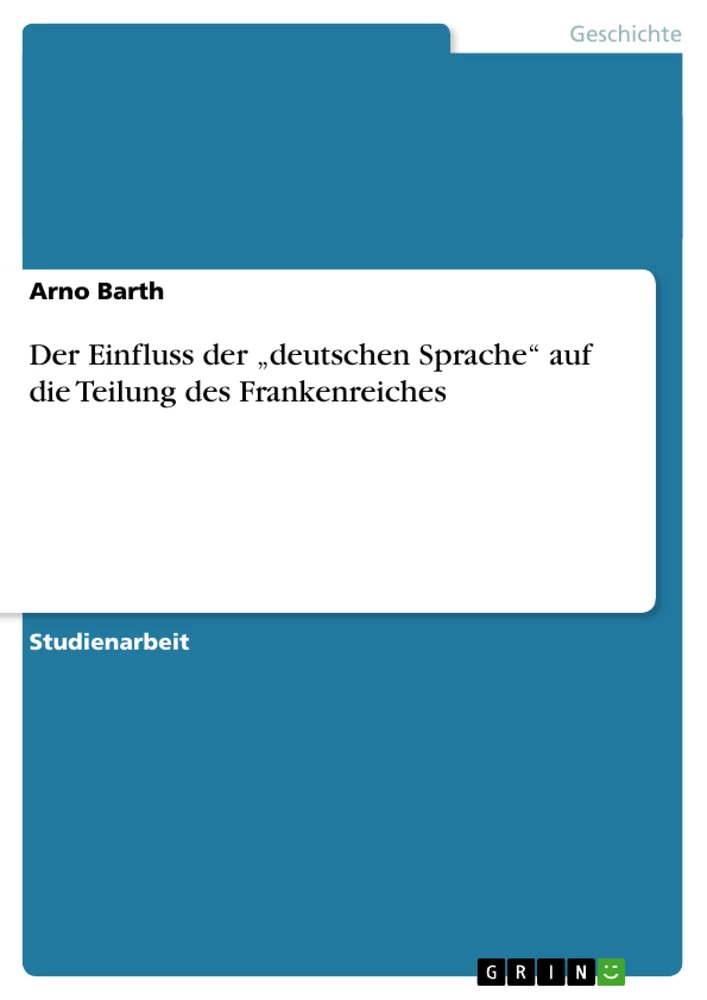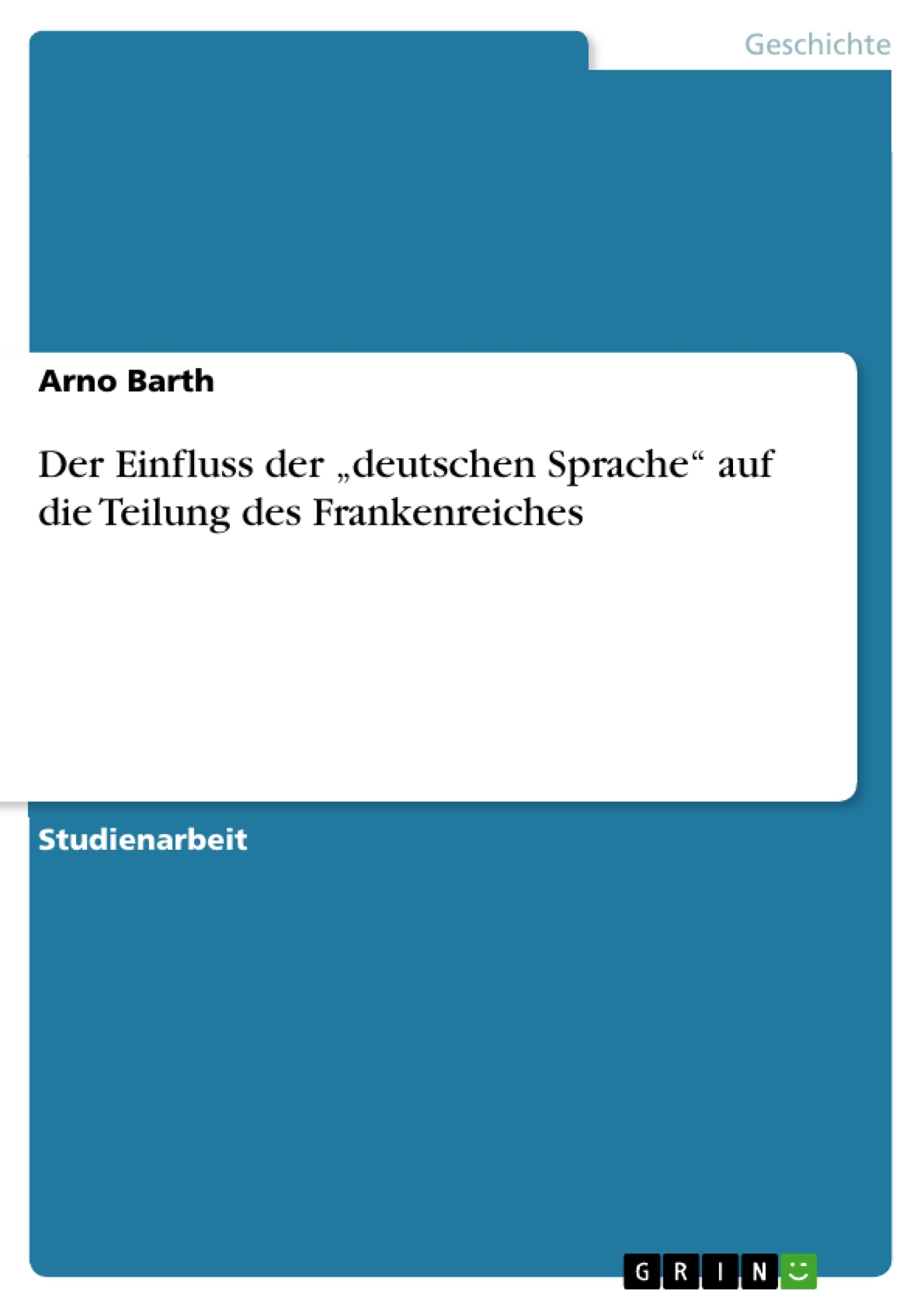Der Frage nach dem Anfang kommt im geschichtswissenschaftlichen Diskurs stets eine besondere Rolle zu. Insbesondere die deutsche Geschichte hat eine bemerkenswerte Brandbreite „virtueller Anfangspunkte“ zu bieten. Von populärwissenschaftlichen
Konstruktionen wie der Varusschlacht des neunten Jahres n. Chr. reicht das diesbezügliche Spektrum über kulturelle Ansatzpunkte, wie dem modernen Nationalbewusstsein von Romantik und Französischer Revolution, bis zur Reichsgründung vom 18. Januar 1871.
Auch eine Reihe von mittelalterlichen Ereignissen bieten sich als Beginn deutscher Geschichte an. Klassischerweise galt die Thronerhebung Heinrichs I. im Jahre 919 als „Gründung des Deutschen Reiches“, nicht zuletzt weil im konkurrierenden Gegenkönigtum des Baiernherzogs Arnulf womöglich erstmals der Begriff regnum teutonicum auftaucht. Doch auch das Reich Heinrichs ist nicht ohne Vorgeschichte. In chronologischer
Rückwärtsbewegung kommt man von ihm über das Jahr 911 mit der Wahl des ersten Nicht-Karolingers Konrads I. zum ostfränkischen König zu der Frage, wie denn dieses Gebilde, das zunächst ohne Karolinger, wenig später mit Sachsen an der Spitze regiert wurde und einst tatsächlich ein Reich „deutscher Nation“ werden sollte, entstanden ist. Unstrittig ist, dass es sich hier um Teilungsobjekt des regnum francorum handelt und auch, dass diese Teilung durch einen Vertrag zwischen verschiedenen karolingischen Thronanwärtern im Jahre 843 in Verdun eingeleitet wurde. Ob dessen Teilungsmodalitäten jedoch dem Zufall entsprangen
oder wenn nicht, warum so und nicht anders aufgeteilt wurde, ist Gegenstand historischer Kontroverse.[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Verduner Reichsteilung von 843
- a. Teilungsobjekt (Das großfränkische Reich)
- b. Teilungsverlauf
- c. Ein Teilungsprodukt: Das Deutsche Reich?
- III. Theodisca lingua
- a. Ursprung im Dunkeln, Mündung im Deutschen
- b. Britischer Erstbeleg
- c. Fränkische Integrationspolitik
- d. Kirchliche Sprachgrenzen
- e. Italienische Substantivierung
- f. Dichterische Freiheiten
- g. Straßburger Eide
- IV. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis der „theodisca lingua“ zur Reichsteilung von Verdun im Jahr 843. Die Hauptfragestellung lautet: War die „theodisca lingua“ ein Faktor bei der Teilung des Frankenreiches? Die Arbeit beleuchtet sowohl den historischen Kontext der Teilung als auch die sprachlichen Aspekte, insbesondere den Begriff „theodiscus“. Die Untersuchung analysiert Quellen, in denen der Terminus vor der Reichsteilung verwendet wird, um zu ergründen, ob und wie die Verwendung des Begriffes eine Rolle bei der Vorbereitung der Teilung spielte.
- Die Verduner Reichsteilung von 843 und ihre Hintergründe
- Der Begriff „theodiscus“ und seine historische Entwicklung
- Die sprachliche Situation im Frankenreich vor 843
- Der Einfluss von Sprache auf politische Prozesse
- Die Rolle der „deutschen“ Sprache in der Entstehung des Ostfrankenreiches
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung diskutiert die Problematik der Bestimmung eines „Anfangs“ der deutschen Geschichte und führt die Reichsteilung von Verdun 843 als einen möglichen Ausgangspunkt ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen der „theodisca lingua“ und der Reichsteilung und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die Frage, ob ein Volk einen Staat schafft oder umgekehrt, wird als Hintergrund der Untersuchung präsentiert. Der Begriff „theodiscus“ wird als zentrales Forschungsobjekt hervorgehoben.
II. Die Verduner Reichsteilung von 843: Dieses Kapitel beschreibt das großfränkische Reich zur Zeit Karls des Großen, dessen Ausdehnung und Integration verschiedener Völker. Es beleuchtet die Herrschaft Karls des Großen und seine Bedeutung für die kulturelle Entwicklung des Reiches (Karolingische Renaissance). Die Kaiserkrönung Karls wird als bedeutender Wendepunkt dargestellt. Der Abschnitt zur Reichsteilung von Verdun selbst wird in diesem Kapitel nur kurz angerissen, da die detailliertere Betrachtung der Teilung der Hauptfokus der Arbeit ist. Die Bedeutung dieser Teilung als Ausgangspunkt für die deutsche Geschichte wird als Ausgangspunkt für die weiterführende Untersuchung hervorgehoben.
III. Theodisca lingua: Dieses Kapitel widmet sich einer eingehenden Analyse des Begriffs „theodisca lingua“. Es untersucht den Ursprung und die Entwicklung des Terminus, beginnend mit einer Diskussion über die Unsicherheit über dessen exakten Ursprung und Bedeutung. Es analysiert Quellen, in denen der Begriff „theodiscus“ vor 843 verwendet wird, um dessen Bedeutung im Kontext der fränkischen Integrationspolitik, kirchlicher Sprachgrenzen, und literarischer Darstellungen zu untersuchen. Die Straßburger Eide werden als bedeutende Quelle betrachtet. Die Analyse des Kapitels dient dazu, die Frage zu beantworten, inwiefern der Begriff "theodisca lingua" als Indikator für eine sich entwickelnde deutsche Identität gesehen werden kann und ob diese Identität eine Rolle bei der Reichsteilung gespielt hat.
Schlüsselwörter
Theodisca lingua, Reichsteilung von Verdun, Frankenreich, Karolinger, deutsche Sprache, Sprachgeschichte, Nationalidentität, Ostfrankenreich, Frühmittelalter, Gentes, historische Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die „theodisca lingua“ und die Reichsteilung von Verdun
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der „theodisca lingua“ (der deutschen Sprache im Frühmittelalter) und der Reichsteilung von Verdun im Jahr 843. Die Hauptfrage lautet: Spielte die „theodisca lingua“ eine Rolle bei der Teilung des Frankenreiches?
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verduner Reichsteilung von 843, den Begriff „theodiscus“ und seine historische Entwicklung, die sprachliche Situation im Frankenreich vor 843, den Einfluss von Sprache auf politische Prozesse und die Rolle der „deutschen“ Sprache in der Entstehung des Ostfrankenreiches. Sie analysiert Quellen, in denen der Terminus „theodiscus“ vor der Reichsteilung verwendet wird, um dessen Bedeutung und eventuelle Rolle bei der Vorbereitung der Teilung zu ergründen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Einleitung: Diskussion der Problematik der Bestimmung eines „Anfangs“ der deutschen Geschichte, Einführung der Reichsteilung von Verdun als möglicher Ausgangspunkt und Formulierung der zentralen Forschungsfrage. Die Verduner Reichsteilung von 843: Beschreibung des großfränkischen Reiches, Herrschaft Karls des Großen und die Reichsteilung selbst. Theodisca lingua: Eingängige Analyse des Begriffs „theodisca lingua“, Untersuchung des Ursprungs und der Entwicklung des Terminus, Analyse von Quellen vor 843. Fazit und Ausblick: Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Wie wird der Begriff „theodiscus“ in der Arbeit behandelt?
Der Begriff „theodiscus“ ist das zentrale Forschungsobjekt. Die Arbeit untersucht seinen Ursprung, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der fränkischen Integrationspolitik, kirchlicher Sprachgrenzen und literarischer Darstellungen. Die Analyse soll klären, ob und wie der Begriff als Indikator für eine sich entwickelnde deutsche Identität und deren Rolle bei der Reichsteilung gesehen werden kann.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert Quellen, in denen der Begriff „theodiscus“ vor 843 verwendet wird. Konkrete Quellen werden im Haupttext genannt (z.B. Straßburger Eide). Der Fokus liegt auf der Analyse der Verwendung des Terminus in verschiedenen Kontexten, um seine Bedeutung zu ergründen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Fazit der Arbeit enthalten und werden hier nicht vorweggenommen. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet jedoch einen Einblick in die Richtung der Argumentation.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Theodisca lingua, Reichsteilung von Verdun, Frankenreich, Karolinger, deutsche Sprache, Sprachgeschichte, Nationalidentität, Ostfrankenreich, Frühmittelalter, Gentes, historische Sprachentwicklung.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler und Studierende im Bereich der Geschichtswissenschaft, Sprachwissenschaft und des Frühmittelalters gedacht. Sie ist auf eine akademische Zielgruppe ausgerichtet, die sich mit der Entstehung des deutschen Sprachraumes und der deutschen Geschichte auseinandersetzt.
- Citar trabajo
- Arno Barth (Autor), 2009, Der Einfluss der „deutschen Sprache“ auf die Teilung des Frankenreiches, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135472