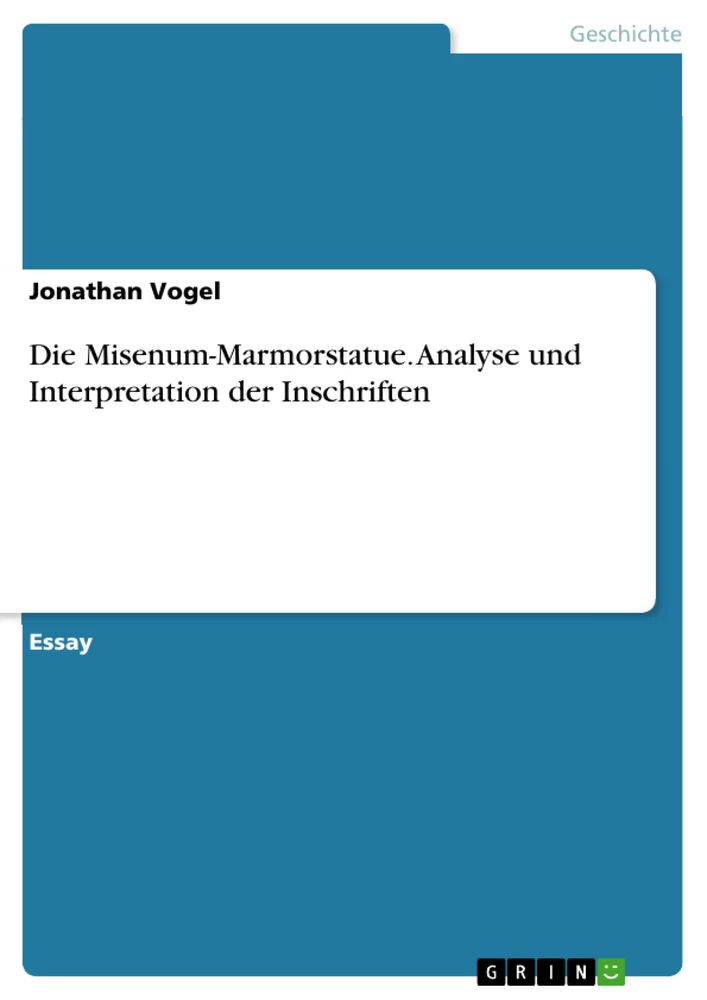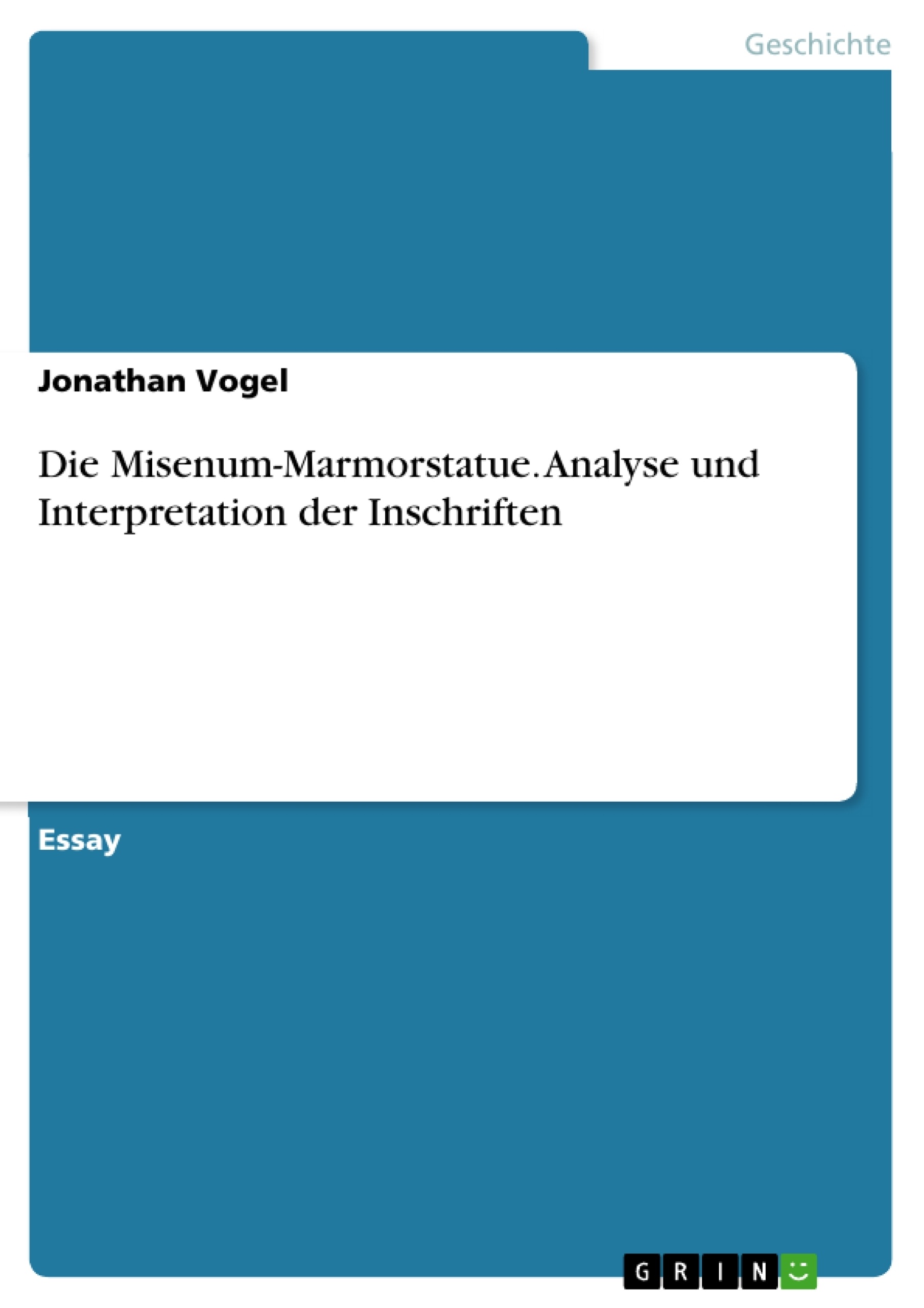Der zu untersuchende Gegenstand ist eine Marmorstatue aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., entdeckt von dem italienischen Archäologen Alfonso De Franciscis in Misenum, Neapel. Die Statue misst 138 cm in der Höhe, 73 cm in der Breite und 58 cm in der Länge und trägt drei Inschriften. Für die Analyse werden die Inschriften auf der Vorderseite und der rechten Seite herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Die zu analysierende Quelle besteht aus zwei Inschriften auf einer Statue, die von Alfonso De Franciscis, einem italienischen Archäologen, in Misenum bei Neapel gefunden und 1993 geborgen wurde und in die Jahre um 147-149 nach Christus datiert wird.
- Die Marmorstatue ist 138cm hoch 73cm breit und 58cm lang.
- Die drei Inschriften, die darauf zu sehen sind, befinden sich auf der Vorderseite und an den beiden Seiten.
- Gegenstand der Interpretation werden nur die Inschrift auf der Vorderseite und der rechten Seite sein.
- Die Statue wurde von Nymphidia Monime, der Ehefrau des Cominius Abascantus errichtet und in einer Vorhalle im Bezirk der Augustales aufgestellt.
- Thema der Inschriften ist das testamentarische Vermächtnis des Cominius Abascantus an den Verein der Augustales und die Bedingungen, die damit verbunden sind.
- In dem ersten Absatz finden wir das Gedächtnis der Ehefrau and ihren Gatten.
- Er trug den Namen Q. Cominius Abascantus, das praenomen ist also nicht vollständig bekannt.
- Wenn man davon ausgeht, dass dieser Mann ein Freigelassener war, worauf ich in Kürze eingehen werde, dann ist das praenomen und der Familienname Cominius von dem ehemaligen Besitzer des Freigelassenen übernommen.
- Abascantus, das cognomen, entspricht dem ehemaligen Sklavennamen.
- Dass dieser Mann ein Freigelassener ist, lässt sich dadurch vermuten, dass er mit dem Ehrenzeichen der Dekurionen geehrt wurde und Geschäftsführer der Augustales auf Lebenszeit war.
- Diese Würde wurde denen zu Teil, die es wegen ihrer unfreien Geburt nicht möglich war in den ordo decurionum aufzusteigen.
- Die Augustales bildeten eine Art \"zweiten Stand\" neben den Dekurionen und genossen ebenfalls hohes Ansehen.
- Ursprünglich waren sie als Priester für die kultische Verehrung der Herrscher zuständig, doch ihr Grundbesitz und ihre finanziellen Aufgaben unterschieden sich häufig nicht von denen der Dekurionen, worauf ich später noch mal eingehen werde.
- Dieser Q. Cominius Abascantus ließ zwei Statuen auf dem Forum errichten.
- Eine für den Genius, den Schutzgeist der Gemeinde und eine für den Schutz der Flotte.
- Da Misenum zur Kaiserzeit ein der wichtigsten Flottenstützpunkte war und die stärkste römische Flotte, die classis praetoria Misenensis, dort stationiert war, ist dies nicht verwunderlich.
- Interessant ist jedoch, dass die Statuen im Forum errichtet wurden.
- Das Forum war als Mittelpunkt der Stadt oftmals ein Zentrum des öffentlichen Interesses und ein Ort zivilen Wettkampfes.
- Deswegen war es der örtlichen Elite, den Dekurionen vorbehalten hier zu bauen, was die Genehmigung des Rater benötigte.
- Wenn es Q. Cominius Abascantus erlaubt war zwei Statuen im Forum zu errichten, dann zeugt dies von seinem Einfluss, seinem Ansehen und seinem Status in Misenum.
- Im Folgenden findet man die Geldverteilung von 20.000 Sesterzen, die jährlich am Tag der Einweihung der Statuen erfolgen sollte.
- Bei dieser Verteilung sollte alles nach Rang ablaufen.
- Die Dekurionen als Spitze der lokalen Elite sollten 20 Sesterzen erhalten, die im Verein organisierten Augustales zwölf Sesterzen, die nicht im Verein sind acht Sesterzen.
- Dieser Verein, lat. corpus Augustalium, bestand vermutlich aus 100 Personen, ebenso wie der lokale Dekurionenstand.
- Dies lässt sich dadurch berechnen, dass die jährliche Abgaberate zu dieser Zeit bei sechs Prozent lag, worauf ich später nochmals eingehen werde.
- Sechs Prozent von den 20.000 Sesterzen sind 1.200 Sesterzen.
- Wenn jeder der im Verein organisierten Augustales 12 Sesterzen bekommen sollte, kommt man auf 100 Personen.
- Die nicht im Verein organisierten Augustales sind vermutlich solche, die formell nicht zum Verein gehören, aber eine Reserve bilden, damit, wenn ein Platz im Verein frei wird, er direkt wider gefüllt werden kann.
- Außerdem bekamen die frei geborenen Vereinsmitglieder sechs Sesterzen.
- Diese Leute waren wahrscheinlich solche, die nicht Teil der Augustales waren, aber durch ihr Vermögen trotzdem Mitglieder des Vereins waren.
- Die normalen Bürger der Stadt, die keine öffentlichen Ämter bekleideten, aber das römische Bürgerrecht besaßen, bekamen vier Sesterzen.
- Es ist auffallend, dass jeder der Beträge, mit Ausnahme der sechs Sesterzen für die frei geborenen Vereinsmitglieder, vier oder ein Vielfaches von vier beträgt.
- Dies lässt darauf schließen, dass der Silberdenar, der vier Sesterzen entsprach, zu dieser Zeit in dieser Region das finanzielle Geschehen dominierte.
- Zudem gab er den Dekurionen 110.000 Sesterzen zur Beschaffung von Wein für sie und das Volk, am 17. Dezember, seinem Geburtstag.
- Wenn man diese Summe betrachtet und die übrigen Summen noch dazurechnet, kommt darauf, dass sich dieser Freigelassene, was das Finanzielle angeht, sich nicht von den meisten Dekurionen unterschied.
- In größeren römischen Städten lag das Mindestvermögen bei 100.000 Sesterzen, in kleineren Städten, wie zum Beispiel in afrikanischen Provinzen betrug es manchmal nur 20.000 Sesterzen.
- Q. Cominius Abascantus könnte von seinem Vermögen her also schon dem Dekurionenstand angehören.
- In seltenen Fällen konnte ein Freigelassener sogar bis in den Ritterstand aufsteigen.
- Er gab dem Verein der Augustales 10.000 Sesterzen, ebenfalls zur Beschaffung von Wein.
- Am Ende des ersten Abschnitts finden wir zum ersten mal den Errichter der Statue erwähnt, seine Ehefrau Nymphidia Monime.
- Sie lässt bei ihrer Erwähnung hinzufügen, dass sie bei der Einweihung jedem der im Verein organisierten Augustales acht Sesterzen und ein Essen gab.
- Dies ist nichts Ungewöhnliches, da die Erbauer oftmals nicht nur die Freigiebigkeit der Personen zeigen wollen, denen die Statue gewidmet ist, sondern auch ihre eigene.
- Da ihr Name kein typisch römischer Name ist, lässt sich auch bei ihr eine unfreie Herkunft vermuten.
- In dem zweiten Abschnitt findet man das Vermächtnis beziehungsweise das Testament des Verstorbenen.
- Empfänger des Erbes ist der Verein der Augustales, der ebenfalls darauf achten soll, dass der Wille des Verstorbenen ausgeführt werden soll, das heißt, dass sein Geld nicht zu einem anderen Zweck benutzt wird, als es aufgeführt ist.
- Q. Cominius Abascantus gibt im Folgenden 14 verschiedene Verwendungszwecke für einen Teil seines Geldes an.
- Er verfügt, dass jedes Jahr acht Sesterzen verwendet werden sollen, um die beiden Statuen für den Genius der Gemeinde und für den Schutz der Flotte zu reinigen und zu salben.
- Außerdem sollen sie mit Veilchen und mit Rosen geschmückt werden, für jeweils 16 Sesterzen.
- Diese Blumen werden häufig in Verbindung mit Gedenkfeiern erwähnt.
- Am Tag seiner Totenfeier, die gewöhnlich zwischen dem 13. und 21. Februar gefeiert wurde (lat. Parentalia), sollten zudem zehn Paare von Ringern auftreten.
- Die Gewinner der Kämpfe erhielten acht Sesterzen, die Verlierer vier Sesterzen.
- Es war normal, das Spiele veranstaltet wurden, dennoch war es besonders, dass die Ringer je nach Sieg oder Niederlage unterschiedlich bezahlt wurden.
- Für die Veranstaltung der Spiele fielen noch weitere Kosten an, nämlich 16 Sesterzen für Salb-Öl, 60 Sesterzen für hausgeborene Sklaven und acht Sesterzen für den Lieferanten des Sandes, der für Ringkämpfe notwendig war.
- Außerdem sollte sein Grab ebenfalls mit Blumen geschmückt werden, und zwar mit den gleichen Blumen, wie die beiden, von ihm errichteten, Statuen für jeweils 16 Sesterzen.
- Dies lässt darauf schließen, das der Schmuck seines Grabes etwas prachtvoller war, als der der beiden Statuen, da die gleiche Menge Blumen verwendet wird, aber nur ein Grab geschmückt werden musste.
- Auch die Tatsache, dass Cominius 24 Sesterzen für Nardenöl ausgibt, das über seine Überreste ausgeschüttet werden sollte, zeigt, dass seine persönliche Ehrung ihm sehr wichtig war.
- Dies wird dadurch verstärkt, dass für das Salb-Öl für die Ringer nur 16 Sesterzen ausgegeben werden sollten, obwohl 20 Sportler damit eingerieben werden sollten, aber er sich das teure und wertvolle Nardenöl 24 Sesterzen kosten ließ, um es über sich alleine ausschütten zu lassen.
- Weitere 100 Sesterzen sollten für ein Gastmahl im Triclinium ausgegeben werden, zu dem die im Amt befindlichen Magistrate und die curatores der Augustales geladen werden sollten.
- Man kann von einer Personengruppe zwischen sechs bis acht Personen ausgehen, da das Triclinium normalerweise für neun Personen ausgelegt war.
- Dieser Speisesaal bestand aus drei Liegesofas, auf denen jeweils drei Leute Platz finden konnten.
- Außerdem sollten 60 Sesterzen für das Opfer für den Verstorbenen an diesem Tag ausgegeben werden.
- Es ist auffallend, dass Cominius fast doppelt so viel für das Opfer, als für die Blumen ausgab.
- Dies lässt darauf schließen, dass ihm der Götterkult, beziehungsweise \"Totenkult\" sehr wichtig war.
- Der Verstorbene stellte zudem 140 Sesterzen bereit, um den Grabgarten wiederherzustellen, sooft es nötig war.
- Wenn man diese Zahlen addiert, kommt man auf eine Summe von 600 Sesterzen.
- Hier finden wir wieder diese jährliche Rate von sechs Prozent, da Cominius dem Verein der Augustales bei Erfüllung seines Testaments 10.000 Sesterzen bezahlen wollte.
- Und sechs Prozent dieser 10.000 Sesterzen sind 600 Sesterzen, die jedes Jahr zur Erfüllung des Willen des Verstorbenen nötig waren.
- Diese Inschrift unterscheidet sich in ihrem Charakter nicht von vielen anderen Inschriften, da Cominius und seine Ehefrau sich dem \"epigrahic habit\" dieser Zeit anpassen.
- Es gab für Freigelassene oftmals keine andere Möglichkeiten sich zu verewigen, als Statuen von sich oder ihren Familienmitgliedern errichten zu lassen.
- Die meisten Freigelassenen führten diese Praxis deshalb noch lange fort, obwohl die lokale Elite sie schon abgelegt hatte.
- Typisch für solche Inschriften ist, dass die Großzügigkeit und Freigiebigkeit der Personen herausgestellt werden, denen die Monumente geweiht sind.
- Bei unserer Quelle wird dieser Aspekt besonders durch die peinlich genaue Beschreibung des Testaments, also der Verwendungszwecke des Geldes des Verstorbenen, hervorgehoben.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text zielt darauf ab, die römische Gesellschaft im Spiegel ihrer Inschriften zu analysieren. Die Inschriften auf einer Statue, die in Misenum gefunden wurde, dienen als primäre Quelle, um Erkenntnisse über die Lebenswelt, den Status und das testamentarische Vermächtnis eines Freigelassenen namens Cominius Abascantus zu gewinnen.
- Soziale Hierarchien und Statussymbole in der römischen Gesellschaft
- Die Rolle und der Einfluss von Freigelassenen
- Testamentarische Vermächtnisse und ihre Bedeutung
- Die Bedeutung von Kult und Ritual in der römischen Gesellschaft
- Finanzielle Verhältnisse und Vermögen in der römischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text analysiert zwei Inschriften auf einer Statue aus Misenum, die um 147-149 n. Chr. entstanden sind. Die Inschriften dokumentieren das testamentarische Vermächtnis des Cominius Abascantus, einem ehemaligen Sklaven, der durch seine Freilassung zu Wohlstand und Ansehen gelangte.
Der erste Teil des Textes beleuchtet die Biografie des Cominius Abascantus und seine soziale Stellung. Er war Mitglied der Augustales, einer Gruppe von Freigelassenen, die im öffentlichen Leben eine wichtige Rolle spielten. Trotz seiner ehemaligen Sklavenstellung konnte er durch seine Leistungen und sein Vermögen ein hohes Ansehen erlangen und sogar zwei Statuen auf dem Forum von Misenum errichten.
Der zweite Teil des Textes widmet sich dem testamentarischen Vermächtnis des Cominius Abascantus. Er hinterließ seinem Vermögen den Augustalen und verfügte über die Verwendung seines Geldes für verschiedene Zwecke, wie die Reinigung und Pflege der Statuen, die Ausrichtung von Ringkämpfen und die Finanzierung eines Gastmahls.
Der Text zeigt, wie Inschriften als Quelle für die Erforschung der römischen Gesellschaft genutzt werden können. Sie liefern detaillierte Informationen über die Lebensweise, die sozialen Strukturen und die Werte der Menschen in der römischen Antike.
Schlüsselwörter
Inschriften, römische Gesellschaft, Freigelassene, Augustales, Dekurionen, testamentarisches Vermächtnis, Vermögen, Status, Kult, Ritual, Misenum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Misenum-Marmorstatue?
Es handelt sich um eine 138 cm hohe Marmorstatue aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., die 1993 in Misenum (nahe Neapel) entdeckt wurde. Sie trägt bedeutende Inschriften über ein testamentarisches Vermächtnis.
Wer war Q. Cominius Abascantus?
Abascantus war vermutlich ein wohlhabender Freigelassener, der als Geschäftsführer der Augustales in Misenum zu großem Ansehen gelangte und bedeutende Geldsummen für die Stadt stiftete.
Was war der Inhalt des Vermächtnisses auf der Statue?
Das Vermächtnis regelte die Verteilung von 20.000 Sesterzen jährlich an verschiedene soziale Gruppen (Dekurionen, Augustales, Bürger) sowie Mittel für Weinspenden und Grabpflege.
Welche Rolle spielten die Augustales in Misenum?
Die Augustales waren eine Priesterschaft, die primär aus wohlhabenden Freigelassenen bestand. Sie bildeten eine Art "zweiten Stand" unterhalb der Dekurionen und waren für den Kaiserkult zuständig.
Warum ist die Erwähnung der Flotte in der Inschrift wichtig?
Misenum war der wichtigste Stützpunkt der römischen Flotte (classis praetoria Misenensis). Abascantus stiftete Statuen zum Schutz der Flotte, was seinen hohen sozialen Status und Einfluss unterstreicht.
Was verraten die Inschriften über römische Bestattungsrituale?
Die Inschriften erwähnen die Nutzung von Rosen und Veilchen zur Schmückung des Grabes sowie Ringkämpfe (Parentalia) zu Ehren des Verstorbenen, was Einblicke in den antiken Totenkult gibt.
- Quote paper
- Jonathan Vogel (Author), 2018, Die Misenum-Marmorstatue. Analyse und Interpretation der Inschriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1354975