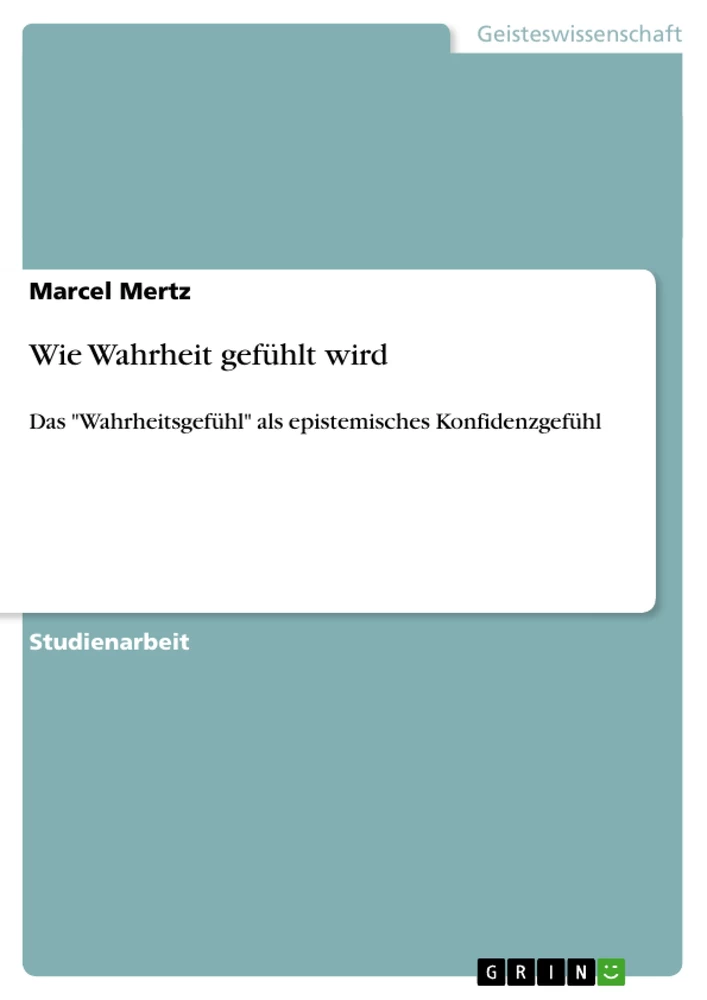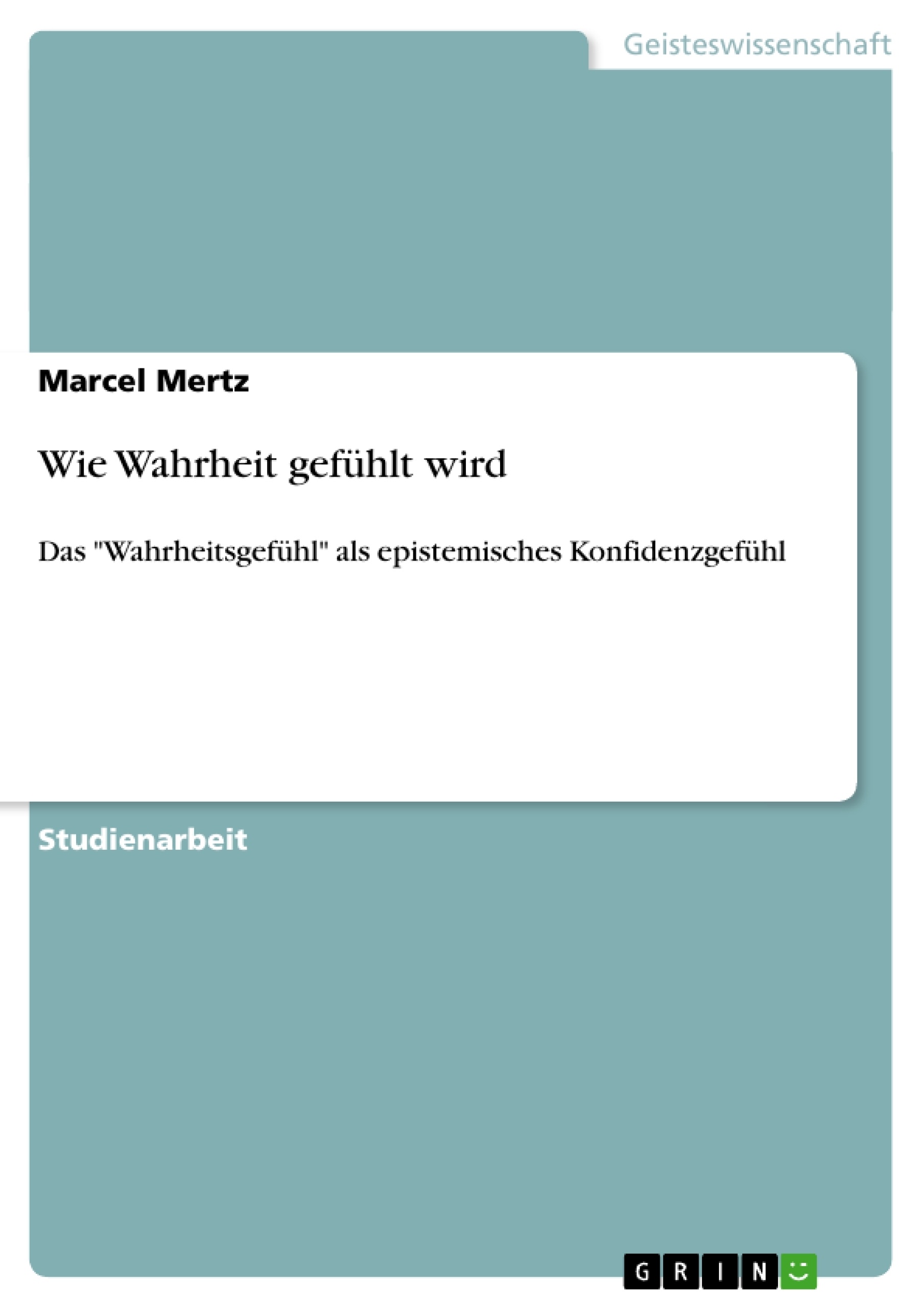Gefühle werden eher selten in einem positiven Zusammenhang mit Wahrheit und Erkenntnis gebracht, zumindest in der wissenschaftlichen, v.a. empirischen Methodologie und der (analytischen) Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Gefühle sind vielmehr Störfaktoren, welche mögliche Erkenntnis grundsätzlich erschweren, Ergebnisse verzerren und intersubjektive Nachvollziehbarkeit verunmöglichen. Überhaupt sind sie „bloss subjektiv“ und müssen mittels wissenschaftlichen Methoden kontrolliert oder neutralisiert werden.
Vor so einem Hintergrund wirkt die Rede von einem „Wahrheitsgefühl“, also eines affektiven Zustandes, welcher einigermassen sicher auf Erkenntnis hinweist, geradezu methodologisch uninformiert – oder erweckt sogar den Eindruck irgendwelcher esoterischer „New Age“-Vorstellungen. In der Tat können manche historischen Beschreibungen eines solchen „Wahrheitsgefühls“, die vom „Spüren der Wahrheit“ oder „Erkennen der Wahrheit ohne Bewusstsein des Grundes“ sprechen, derartige Assoziationen provozieren.
Der Entwurf eines Ansatzes, welcher kognitivistische Gefühlstheorie mit responsibilistischer Tugendepistemologie kombiniert, kann entgegen solcher erster Intuitionen aber deutlich machen, dass die Existenz eines „Wahrheitsgefühls“ im Sinne eines sog. epistemischen Konfidenzgefühls (kurz: ein berechtigtes Gefühl des Vertrauens in unsere epistemischen Leistungen) zumindest plausibel denkbar und voraussichtlich theoretisch rechtfertigbar ist. Ein solches Konfidenzgefühl muss dabei keineswegs im Widerspruch zu methodologischen und epistemologischen Überlegungen und v.a. Normen stehen, sondern hängt mitunter von diesen ab. Für einen solchen kombinatorischen Ansatz ist es jedoch erforderlich, überhaupt erst zu präzisieren, was „Wahrheitsgefühl“ bedeuten und worauf dieser Ausdruck referieren soll, d.h. auch zu klären, welche Begriffe sich von einem (modernen) epistemologischen Standpunkt aus für die vorgesehene Aufgabe eignen werden und welche nicht.
Beides, der Entwurf eines solchen Ansatzes und die (erste) Präzisierung des Ausdrucks „Wahrheitsgefühl“, ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
INHALT
1. Ein vergeblich gesuchter Ausdruck
2. Erkenntnisinteresse und Vorgehen
3. Theoretische Voraussetzungen
3.1. Die „Rehabilitierung des Gefühls“ – Gefühlstheorien
3.2. Tugend als epistemisches Vermögen – Tugendepistemologie
3.3. „Phänomenale Präsupposition“? – Zur Existenz eines „Wahrheitsgefühls“
4. Das „Wahrheitsgefühl“: Mögliche Deutungen
5. Die Relevanz des Wahrheitsbegriffes
6. Adäquatheitsbedingungen
7. Das Wahrheitsgefühl als epistemisches Konfidenzgefühl
7.1. Wahrheitsgefühl als „Erkenntnisgefühl“
7.2. Wahrheitsbegriff als epistemologischer Begriff
7.3. Kognitivistische Gefühlstheorie mit „kognitiven Sets“
7.4. Responsibilistische Tugendepistemologie
7.5. Epistemische Tugend und Gefühl – Eine erste Annäherung
7.6. Epistemische Tugend und Gefühl – Eine zweite Annäherung
7.7. Eigenschaften des epistemischen Konfidenzgefühls
7.8. Konfidenzgefühl und „epistemische Stimmungen“
8. Schlussfolgerungen
9. Literatur
1. EIN VERGEBLICH GESUCHTERAUSDRUCK
Der Ausdruck „Wahrheitsgefühl“ ist in der philosophischen Terminologie nicht sonderlich verbreitet. In der MITTELSTRASS’SCHEN Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie (2004) – im deutschsprachigen Raum wohl gegenwärtig ein Abbild des State-of-the-Art unserer Disziplin – sucht man den Ausdruck vergeblich, findet aber viele andere Ausdrü-cke mit dem Wahrheits-Präfix (Wahrheitskriterium, Wahrheitsbegriff, Wahrheitsbedingung...). Auch im kleineren Philosophielexikon von HÜGLI/LÜBCKE (2003) findet man keinen Hinweis auf das „Wahrheitsgefühl“, ebenso wenig in dem deutschen Online-Philosophiewörterbuch Phillex (2007). Durch das Philosophische Wörterbuch (SCHISCH-KOFF 1991), das seit 1912 herausgegeben wird, wird man auch nicht klüger. Das etwas ältere Meyers Grosses Taschenlexikon (in 24 Bänden) (1987) scheitert ebenfalls aufgrund der Abwesenheit eines Eintrags darin, dem Leser verständlich zu machen, was das „Wahrheitsgefühl“ ist. Und selbst in Wikipedia (2007), dem (in zweierlei Sinne) populärsten Internet-Nachschlagewerk, muss man sich mit dem Kommentar „Es wurden keine pas-senden Seiten gefunden“ zufrieden geben.
Doch anscheinend ist der Ausdruck nicht nur in der Philosophie und der Wissenschaft kaum gebräuchlich, sondern tritt auch im Alltagsdiskurs eher selten auf: Bei einer Eingabe in die Suchmaschine Google (2007) wurden gerade mal 450 Treffer angezeigt (sowie die Bemerkung „Meinten Sie: Wahrheitstafel “) – man vergleiche das mit den 16'900'000 Tref-fern bei der Google -Suche nach dem Ausdruck „Wahrheit“.
Immerhin: In einer Online-Fassung des 1904er (!) Wörterbuch der philosophischen Begrif-fe von RUDOLF EISLER – gefunden über die vorher genannte Google -Suche – findet sich ein Eintrag zum Wort „Wahrheitsgefühl“:
„Wahrheitsgefühl ist ein instinktives, intuitives (nicht begrifflich vermitteltes) Spüren der Wahr-heit. – Nach Suabedissen ist das Wahrheitsgefühl ‚ein unmittelbares, d i. nicht durch ein frei vorschreitendes Verstandesverfahren vermitteltes Bewusstwerden der Wahrheit’. ‚Es beruhet ... auf der Vernunft und ist selbst die sich noch unklar äussernde Vernunft in ihrer Richtung auf gegebene Fälle’ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S. 295 f.). Nach Waitz beruht das Wahr-heitsgefühl auf einer ‚unvollständigen Vergleichung eines vorliegenden Falles mit dem Bilde eines allgemeinen, größtenteils sehr schwankenden Typus..., der als Norm desselben be-trachtet wird’ (Lehrb. d. Psychol. S. 338).“ (EISLER 2007)
Die anderen, kurz überflogenen Google -Ergebnisse scheinen mehrheitlich religiöse oder spirituelle Kontexte wiederzugeben (inklusive mehrerer Verweise auf RUDOLF STEINER). Ferner wird „Wahrheitsgefühl“ anscheinend oft als eine Art Synonym für Wahrhaftigkeit oder Ehrlichkeit verwendet („mein Wahrheitsgefühl verlangt das von mir“), oder aber ist im Sinne einer „Wahrheitsliebe“, einem Hochhalten des Wertes „Wahrheit“ zu verstehen. Ein halbwegs einheitlicher oder auch eindeutig bestimmbarer Gebrauch ist nicht auszuma-chen.[1]
Erstaunlicherweise fand sich kein Verweis auf einen Philosophen, der andeutungsweise angegeben hat, was darunter zu verstehen sei, nämlich ein „(...) Vermögen, ein wahres Urtheil zu fällen oder (was eben so viel heisst) die Wahrheit zu er-kennen, ohne sich gleichwohl des Grundes, aus dem man sie erkennt, bewusst zu werden.“ (BOLZANO 1837)
Für BOLZANO ist dieses Vermögen sogar so grundlegend, dass „die Logik und gar manch andere Wissenschaft“ gar nicht ohne auskommen könnten. Was wir uns aber genau dar-unter vorzustellen haben, und wir uns dieses Gefühls, das nach BOLZANO weder „sinnli-ches Fühlen“ noch „psychologisches Fühlen von Lust und Unlust“ sei, sicher sein können – darüber herrscht Schweigen, vielleicht, um den frühen WITTGENSTEIN zu bemühen, weil darüber nichts gesagt werden kann.
„Umso schlimmer für die Logik und die Wissenschaft!“, könnte dann aber z.B. ein Vertreter eines spirituellen Verständnisses des „Wahrheitsgefühls“ oder erst recht ein Kritiker an der Idee eines „Wahrheitsgefühls“ überhaupt sardonisch zu bedenken geben; und recht müss-ten wir ihm geben, wenn wir nichts anzubieten hätten, um ein solches „Wahrheitsgefühl“ – sofern es ein solches tatsächlich gibt – näher zu bestimmen.
2. ERKENNTNISINTERESSE UNDVORGEHEN
Die folgende Arbeit möchte auf die (fiktive) Herausforderung eingehen versuchen und explorativ prüfen, was sich als gehaltvolle Explikation des Ausdrucks „Wahrheitsgefühl“ in einem epistemologischen Kontext anbieten und welche theoretischen Mittel es erlauben könnten, dieses „Wahrheitsgefühl“ kohärent verständlich zu machen.
Vorausgesetzt werden muss, dass es so etwas wie ein „Wahrheitsgefühl“ gibt, und dass man darüber auch sinnvoll sprechen kann. Dieses Wahrheitsgefühl ist darüber hinaus auch kein „phänomenaler Spezialfall“ (der nur bei bestimmten Menschen – pace vermut-lich STEINER et al. – oder in hochspezifischen Situationen vorkommt), sondern kann zu-mindest in Erkenntnissituationen, sowohl alltäglichen wie wissenschaftlichen, prinzipiell von jedem epistemischen Subjekt erlebt werden. Das Gefühl kann als natürliche Disposition verstanden werden, welche durch kulturelle und soziale Faktoren verstärkt oder abge-schwächt werden kann (z.B. eine Sensibilisierung oder Desensibilisierung auf solche Ge-fühle).[2]
Es wird die Hypothese aufgestellt und skizzenhaft verteidigt, dass das Wahrheitsgefühl ein epistemisches Konfidenzgefühl ist (kurz: ein berechtigtes Gefühl des Vertrauens in unsere epistemischen Leistungen), welches sich als Sekundärphänomen auf die korrekte oder zuverlässige Ausübung unserer epistemischen Vermögen bezieht. Das Wahrheitsgefühl kann (deshalb) nicht ein eigenständiges epistemisches Vermögen darstellen. Theoretisch wird dies u.a. anhand Überlegungen aus (philosophischen) Gefühlstheorien und neueren Ansätzen der Tugendepistemologie (virtue epistemology) zu leisten versucht.
Eine vollumfängliche und in jeglicher Hinsicht abgestützte Explikation des Wahrheitsge-fühls im genannten Sinne kann in dieser Arbeit nicht geleistet werden. Es soll vor allem darum gehen, wichtige theoretische Vorbedingungen zu diskutieren und eine Richtung für weitere fruchtbare Untersuchungen anzugeben.
Zuerst werden theoretische Voraussetzungen in Bezug auf Gefühl, Tugendepistemologie und Existenz des Wahrheitsgefühls ausgewiesen, welche für die Entwicklung und die Ver-teidigung der Hypothese benötigt werden. Anschliessend werden verschiedene semanti-sche Optionen für den Ausdruck „Wahrheitsgefühl“ vorgestellt und aufgezeigt, warum ein epistemologischer Kontext – und die damit implizierten semantischen Optionen – als am Naheliegendsten einzustufen ist. Danach werden Adäquatheitsbedingungen für die Expli-kation eines solchen Begriffs von Wahrheitsgefühl formuliert sowie die Wichtigkeit der Be-stimmung des Wahrheits begriffes für das Projekt nahe gelegt. Schliesslich wird ein skiz-zenhafter Versuch einer entsprechenden Explikation entwickelt, und begründet, warum eine Explikation in dieser Richtung erfolgsversprechend scheint.
3. THEORETISCHEVORAUSSETZUNGEN
3.1. Die „Rehabilitierung des Gefühls“ – Gefühlstheorien
Dass Gefühle etwas in positiver Weise mit Erkenntnis zu tun haben könnten, ist eine eher ungewohnte Annahme. Im Gegenteil: Blickt man in Methodenhandbücher besonders der empirisch-quantitativen Wissenschaften und in die (analytisch orientierte) Wissenschafts-theorie, kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, dass Gefühle in Erkenntniszusam-menhängen nur den Part des Störenfrieds spielen, der Wahrnehmungen verzerrt, Objekti-vität verunmöglicht, (unangemessene) Parteilichkeit bewirkt und überhaupt unsere (wis-senschaftliche) Erkenntnis behindert. Gefühle müssen geradezu durch die wissenschaftli-che Methode und/oder der sozialen Verfasstheit der Wissenschaft[3] überwunden oder „ausgeschaltet“ werden, um die Sicherheit und Reinheit der Erkenntnis zu bewahren. Da dies in der alltäglichen Erkenntnissituation kaum geschieht, ist diese auch der wissen-schaftlichen Erkenntnis i.d.R. unterlegen – so zumindest das „klassische“Bild, das auch in der (westlichen) Philosophie nicht zu selten sein dürfte, insbesondere in der analytisch geprägten.
Während nicht bestritten werden sollte, dass Gefühle einen negativen Einfluss auf die Er-kenntnissituation oder die Ausübung epistemischer Fähigkeiten haben können (und in der wissenschaftlichen Erkenntnissituation dieser Einfluss zurecht durch methodische Mass-nahmen neutralisiert, minimiert oder korrigiert werden muss), muss die Frage gestellt wer-den, ob Gefühle nicht auch positiven oder gar konstitutiven Einfluss auf unsere Erkenntnis-fähigkeit ausüben könnten. Es wäre zu vereinfachend, bei einer Kategorie mit komplexen und vielschichtigen Instanzen, wie die Kategorie „Gefühl“ es darstellt, von einem simplen „Entweder-Oder“ auszugehen, zumindest, solange die Berechtigung dieser Annahme nicht nachgewiesen wurde.
Ausserhalb des sozialen Systems „Wissenschaft“ haben Gefühle in den letzten Jahrzehn-ten eine gewisse „Rehabilitierung“ erfahren (oder, was wahrscheinlicher ist, waren nie auf dieselbe Weise gebrandmarkt worden wie im genannten System). Die Rede von „emotio-nalen Kompetenzen“ oder „emotionaler Intelligenz“ oder gar romantisierenden Wendungen wie „Hör’ auf dein Herz!“ (und nicht auf den „Kopf“), bis hin zur (feministischen) Wissen-schaftskritik, welche die (männliche) „kalte Rationalität“ und die „patriachal-sexistische“ Dichotomie von Gefühl und Vernunft (MEIER-SEETHALER 2000) der Wissenschaften an-greift, deuten darauf hin, dass der Stellenwert der Gefühle in der Gesellschaft höher veror-tet wird als im oben holzschnittartig gezeichneten „traditionellen“ Bild der Wissenschaft. Die Zunahme der Berücksichtigung der Gefühle in der wissenschaftlichen und philosophi-schen Forschung lässt es aber womöglich zu, allgemeiner von einer allmählichen „Rehabi-litierung der Gefühle“ (PIEPER 2000) zu sprechen.
Typische Einwände gegen Gefühle im epistemologischen Kontext
Nach MARTHA NUSSBAUM (1999) sind typische Einwände gegen Gefühle z.B. jene, dass Gefühle blinde Kräfte und/oder falsche Urteile seien, sowie parteiisch und nur mit einer beschränkten Reichweite ausgestattet (so können z.B. gesellschaftliche Einheiten nicht Träger von Gefühlen sein, während sie aber sehr wohl Träger von Überzeugungen sein können). Insgesamt lässt sich dies verkürzen darauf, dass Gefühle als irrational (oder zu-mindest arational) und (deshalb) auch trügerisch und/oder unzuverlässig zu beurteilen sind, sobald sie in Erkenntnissituationen eingesetzt werden oder man sich auf sie verlas-sen will.
Solchen Vorwürfen wurde unterschiedlich begegnet. Neben philosophischen Erwägungen haben vor allem auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte aufge-zeigt, dass Gefühle und Rationalität enger beieinander liegen als im klassischen negativen Bild suggeriert. Es wurde philosophisch versucht, deutlich zu machen, dass Gefühle kogni-tiven Gehalt haben und deshalb ebenfalls Rationalität aufweisen können (siehe unten). Auch lässt sich darauf hinweisen, dass die traditionellen epistemischen Vermögen oder Quellen von Wissen – sinnliche Wahrnehmung, das Ableiten („Denken“), die Erinnerung und das Zeugnis anderer Personen (testimony) – keineswegs beanspruchen können, stets untrügerisch oder zuverlässig zu sein. Wir verfügen sogar über Disziplinen oder wissen-schaftliche Programme, die unser Fehlgehen in diesen Vermögen akribisch festhalten können. Die Logik (als Disziplin) zeigt, dass wir Denkfehler begehen können (logisch falsch ableiten, z.B.). Psychologische Untersuchungen weisen uns darauf hin, dass wir Wahrnehmungsirrtümern und -verzerrungen unterliegen können (z.B. selektive Wahrneh-mung). Unsere Erinnerung kann uns fehlleiten, weil sie verschwommen und teilweise nachträglich „konstruiert“ worden ist (z.B. Hirnforschung). Andere Personen schliesslich können sich auf dieselbe Weise täuschen – oder uns aufgrund bestimmter Motive oder Situationen etc. absichtlich betrügen oder unabsichtlich in die Irre führen (Sozialwissen-schaften). Inwiefern der Hinweis, dass Gefühle trügerisch sein können (was nicht bezwei-felt werden muss) bereits ausreichen soll, diese prinzipiell epistemisch zu disqualifizieren, wird nicht klar; erst unter zusätzlichen Annahmen, wie z.B. dass Gefühle systematisch trü-gerischer sind als die erwähnten epistemischen Quellen, wird die Disqualifizierung haltba-rer.
Kognitivistische Gefühlstheorien
Eine wesentliche begriffliche Grundunterscheidung muss zwischen Empfindung (feeling) und Gefühl (emotion) eingeführt werden. Auch müssen Wünsche oder Motivation (desire, motivation) und Gefühle voneinander begrifflich unterschieden werden; gleiches gilt für Stimmungen (moods).
Dadurch lassen sich drei „Mainstream“-Grundrichtungen der Gefühlstheorien bestimmen (BEN-ZE’EV 2004; S. 450): Solche, die Gefühle mit Wünschen oder motivationalen Kräften identifizieren; solche, die Gefühle als Empfindungen begreifen; und solche, für die Gefühle wesentlich kognitiv-evaluative Zustände darstellen.[4]
Gegen die zweite Position wird u.a. eingewendet, dass während Gefühle mit Empfindun-gen korrespondieren[5], doch nicht gleichsam alle Empfindungen auch zugleich Gefühle seien; nicht alle Gefühle, besonders dispositionale, weisen Gefühlsempfindungen auf (CALHOUN 1984; S. 328). Gefühle zeichnen sich – so zumindest einige PhilosophInnen – dadurch aus, dass sie Intentionalität und kognitive Vorbedingungen aufweisen (GUNTHER 2004), was Empfindungen nicht tun: Meine Wut ist stets eine Wut auf etwas oder jeman-den, und nicht nur die Empfindung von Wut (mit den damit verbundenen körperlichen Re-aktionen oder Prozessen). Auch benötigen wir, um verwandte Gefühle auseinander zu halten, Wissen über die Überzeugungen einer Person: Ärger, Neid und Eifersucht unter- scheiden sich nicht wesentlich hinsichtlich ihrer Empfindungen, aber sehr wohl hinsichtlich ihrer „kognitiven Basis“ (CALHOUN 1984; S. 328).
Analog wird gegen die erste Position eingewendet, dass Wünsche oder Motive zwar Teil von Gefühlen sein können, aber wiederum zu kurz greifen – Motive und Wünsche können zwar einen wesentlichen Teil von Gefühlen darstellen, lassen sich aber nicht darauf redu-zieren (BEN-ZE’EV 2004).
Neben Ansätzen, die Gefühle vorwiegend (oder ausschliesslich) als affektive Phänomene verstehen oder sie über ihre phänomenalen Charakteristika identifizieren, existieren schliesslich auch gefühlstheoretische Ansätze, die Gefühle vor allem (auch) über ihren kognitiven Gehalt begreifen, sie z.B. als Werturteil (judgment of value) betrachten (sog. Judgmentalism - Account, NUSSBAUM 2001, welcher sich nach BEN-ZE’EV aber auch des Reduktionismus schuldig macht). Dabei müssen Gefühle, wenn sie als Urteile betrachtet werden, nicht so verstanden werden, dass diese Urteile uns stets bewusst oder frei ver-fügbar sind – eher im Gegenteil –, doch können wir sie bei Bedarf artikulieren (SOLOMON 2003; S. 11). Abgelehnt wird dagegen oft eine Identifikation von Gefühlen mit Überzeu-gungen; Überzeugungen können aber „kognitive Vorbedingungen“ für Gefühle darstellen (SOLOMON 2003, S. 8; GUNTHER 2004, S. 44).
Einer der Gründe für das Vertreten eines kognitivistischen Ansatzes ist, dass, wenn Ge-fühle als blosse (körperliche) Empfindungen (wie z.B. bei WILLIAM JAMES bzw. dem „James-Lange-Modell“) oder nur über phänomenologische Eigenschaften verstanden werden, wenigstens manche Gefühle unzureichend beschrieben sind. Ein Paradigma-Beispiel da-für ist Angst. Angst ist natürlich auch mit körperlichen Empfindungen und einem „Auftreten im Bewusstsein“ verbunden, aber ohne Berücksichtigung eines kognitiven Gehalts nicht verständlich: Denn nur wenn ich weiss (die Überzeugung habe), dass ein Messer mich verletzen oder gar töten könnte, kann ich auch Angst vor einem Messer haben, mit dem ich bedroht werde. Dieser kognitive Anteil fehlt Ansätzen, die Gefühle auf Empfindung oder auf Wünsche reduzieren.
Gegen (viele) kognitivistische Theorien wird eingewendet, dass sie den kognitiven Aspekt über- und affektive und phänomenale Aspekte unterbetonen, oder gar ignorieren: Gefühle zeichneten sich eben doch gerade dadurch aus, dass sie affektive, nicht (nur) kognitive Phänomene seien. Wie BEN-ZE’EV (2004) hinweist: Gefühle sind nicht bloss Urteile. Auch bestehe die Gefahr, dass der Begriff des Kognitiven zu weit gefasst werden würde, damit z.B. „emotionale Überzeugungen“ möglich werden.
Im Folgenden soll ein im Prinzip kognitivistischer Ansatz der Gefühlstheorie zugrunde ge-legt werden. Dieser muss jedoch nicht dem Reduktionismus-Vorwurf ausgesetzt sein, wenn er affektive und phänomenologische Aspekte von Gefühlen einräumt (oder sogar einräumt, dass nicht alle Gefühle kognitiven Gehalt aufweisen müssen). Ein kognitivisti-scher Ansatz der Gefühle lässt es auch zu, (eher) von rationalen und irrationalen, von be-rechtigten und unberechtigten Gefühlen und dergleichen auszugehen: Meine Angst vor einem Messer, mit dem ich bedroht werde, ist weder irrational noch unberechtigt. Dadurch kann auch das klassische dichotomische Bild der „Vernunft (Rationalität) vs. Gefühle (Irra-tionalität)“ durchbrochen werden. Ferner wird eine solche kognitivistische Ausrichtung für die Explikation des Wahrheitsgefühls benötigt (siehe unten).
Gemäss der oben skizzierten Diskussion um Gefühlstheorien und begrifflichen Grundun-terscheidungen sollen folgende vier Aspekte (oder Typen von Gehalt) von Gefühlen unter-schieden werden: phänomenaler Gehalt (Empfindung, feeling), volitiver Gehalt (Wünsche, Motivationen), experientieller Gehalt (Erlebnis[6] ) und kognitiver Gehalt (Überzeugungen, Wissen, Begriffe; „wahrheitsfähige Elemente“).
Wahrheitsförderlichkeit (truth-conduciveness)
„Wahrheitsförderlichkeit“ ist ein Begriff vor allem der analytischen Erkenntnistheorie, der zum Ausdruck bringen soll, dass ein epistemisches Vermögen (oder ein Prozess) die Ei-genschaft aufweist, eher zu wahren denn zu falschen Überzeugungen zu führen (dies zu-mindest in veritistischen Erkenntnistheorien, also Erkenntnistheorien, welche an Wahrheit orientiert sind). Damit ist demnach nicht gemeint, dass das Vermögen unfehlbar ist, d.h. stets „zur Wahrheit führt“, sondern nur, dass es eine gewisse Zuverlässigkeit diesbezüg-lich aufweist.[7] In der klassischen Tripartite-Definition von Wissen[8] bezieht sich Wahrheits-förderlichkeit auf die (gewünschte, erhoffte) Eigenschaft der Rechtfertigungs komponente, die Wahrheits komponente zu befördern, oder anders ausgedrückt: Die Wahrheitsförder-lichkeit soll die Lücke zwischen Rechtfertigung und Wahrheit einer Meinung überbrücken (insofern Meinungen gerechtfertigt, aber nicht wahr sein können, oder aber wahr, jedoch nicht gerechtfertigt).
Bei der Explikation des „Wahrheitsgefühls“ muss davon ausgegangen (unterstellt) werden, dass dieses Gefühl a) im Rahmen einer veritistischen Erkenntnistheorie verortet werden kann und b) die Wahrheitsförderlichkeit eines Gefühls nicht a priori ausgeschlossen wer-den muss. Das „Wahrheitsgefühl“ muss sich als wahrheitsförderliches Gefühl auszeichnen können. Die Annahme ist, dass bei der Verfolgung tendenziell kognitivistischer Gefühls-theorien eine solche Eigenschaft nahe gelegt werden kann.
[...]
[1] Dies zumindest im Rahmen der recht oberflächlichen Betrachtung der erwähnten Ergebnisse; dies müsste mit mehr Zeit und Aufwand sprachwissenschaftlich genauer untersucht werden (was für die philosophischen Belange jedoch nicht entscheidend ist). Dennoch lässt sich auf Basis dieser Betrachtung vermuten, dass der
Ausdruck a) eher selten verwendet wird und b) in nicht eindeutiger Weise (was für den Ausdruck „Wahrheit“ zwar auch zutrifft, der aber bedeutend öfter verwendet wird, was diesen Umstand erwartbar macht).
[2] Es ist anzunehmen, dass die gegenwärtige westliche Kultur, besonders innerhalb akademischer sozialer Gruppen, eher desensibilisiert auf die Wahrnehmung eines solchen Gefühls ist. Auch die Wertschätzung eines solchen Gefühls dürfte im Grossen und Ganzen eher gering ausfallen. Ursache hierfür mag das tradi-tionelle, systematisch gewordene Ausschliessen von Gefühlen in epistemologischen und methodologischen Kontexten gerade in den Wissenschaften sein, aber auch die Tradition der westlichen (ex-altgriechischen) Philosophie, welche oft eher als „gefühlsfeindlich“ zu charakterisieren ist (mit nennenswerten Ausnahmen wie z.B. der Stoa oder DAVID HUMES Philosophie).
[3] Frei nach POPPER im Positivismusstreit (ADORNO/ALBERT 1980): Wissenschaftler können genauso engstir-nig, dogmatisch, leidenschaftlich usw. sein wie alle anderen Menschen auch; aber die Wissenschaft, als soziales und kognitiv ausgerichtetes System – als Inbegriff einer epistemology without subject –, ist es (in the long run) nicht.
[4] Nach BEN-ZE’EV sind die Behauptungen dieser Richtungen stärker: Sie reduzieren Gefühle jeweils auf die genannten Komponenten. Er schlägt daher auch eine „gemischte“ Theorie vor, die nicht Gefahr läuft, das komplexe Phänomen „Gefühl“ reduktionistisch auf Teilaspekte zu verkürzen. (Auch hält er die Suche nach einer strikten Definition der Gefühle mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen für sinnlos, und sucht daher den Weg über paradigmatische Fälle, um sich dem Phänomen anzunähern).
[5] Auf welche Weise genau, kann an dieser Stelle offengelassen werden. GUNTHER (2004) schlägt aber drei Möglichkeiten vor: Typenidentität zwischen Empfindung und Gefühl, notwendige und hinreichende Bezie-hung und multiple Realisierbarkeit.
[6] Ein Erlebnis setzt einen situativen (oft sozialen) Kontext voraus, in dem etwas zu einem Erlebnis werden kann (verglichen zu der Empfindung, die sich je nachdem auf physiologische Prozesse reduzieren lassen).
[7] Besonders ausgeprägt ist diese Idee bei reliabilistischen Positionen, welche epistemische Prozesse über die Zuverlässigkeit, eher wahre denn falsche Überzeugungen zu generieren, bestimmen. Das Konzept der Wahrheitsförderlichkeit setzt aber keinen Reliabilismus voraus.
[8] x ist Wissen gdw x gerechtfertigt, wahr und eine propositionale Einstellung (z.B. eine Meinung) ist. Wäh-rend diese Definition heute u.a. aufgrund der sog. Gettier-Beispiele (kurz: Beispiele, die darauf hinweisen, dass diese Definition zufällig wahres, gerechtfertiges Meinen nicht ausschliessen kann) oder aufgrund der mangelnden Berücksichtigung sozialer Kontexte oft als unzureichend beurteilt wird, stellt sie doch einen nach wie vor sinnvollen Ausgangspunkt dar. Verbesserungen der Tripartite-Definition zielen z.B. darauf ab, eine vierte Bedingung wie „ un-defeated “ (nicht-widerlegt) einzuführen (bspw. LEHRER/PAXSON 1992), um Gettier-Beispiele ausser Kraft zu setzen, oder aber das Zustandekommen von Wissen bereits so zu konzi-pieren, dass solche Beispiele nicht vorkommen können (siehe Tugendepistemologie).
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem „Wahrheitsgefühl“?
Es wird als ein „epistemisches Konfidenzgefühl“ definiert – ein berechtigtes Vertrauen in die eigene Erkenntnisleistung, das intuitiv auf die Richtigkeit eines Urteils hinweist.
Sind Gefühle in der Wissenschaft nur Störfaktoren?
Klassisch gelten sie als subjektive Störfaktoren, doch die Arbeit zeigt auf, dass bestimmte Gefühle als Tugenden die Erkenntnis sogar unterstützen können.
Was ist Tugendepistemologie?
Ein Ansatz, der Erkenntnis nicht nur an Regeln, sondern an den intellektuellen Tugenden und dem Charakter des erkennenden Subjekts festmacht.
Welche Rolle spielt Bolzano in dieser Debatte?
Bernhard Bolzano beschrieb das Wahrheitsgefühl als Vermögen, die Wahrheit zu erkennen, ohne sich des Grundes sofort bewusst zu sein – eine Art intellektuelle Intuition.
Ist das Wahrheitsgefühl ein eigenständiges Vermögen?
Nein, die Arbeit argumentiert, dass es ein Sekundärphänomen ist, das auf der zuverlässigen Ausübung anderer epistemischer Fähigkeiten beruht.
- Citation du texte
- MA Marcel Mertz (Auteur), 2007, Wie Wahrheit gefühlt wird, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135504