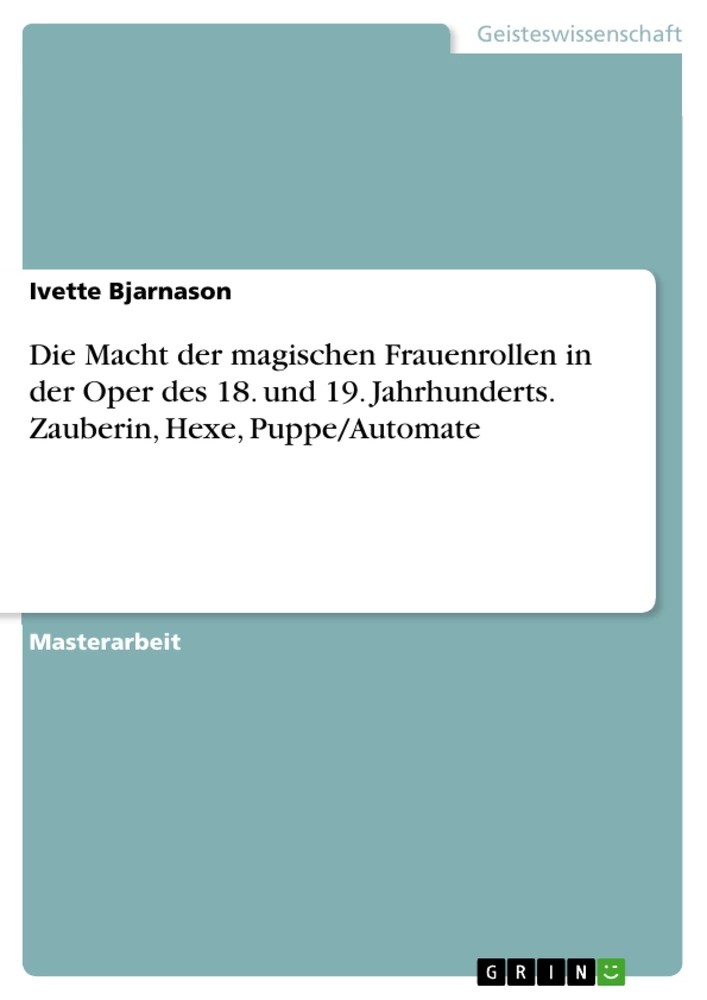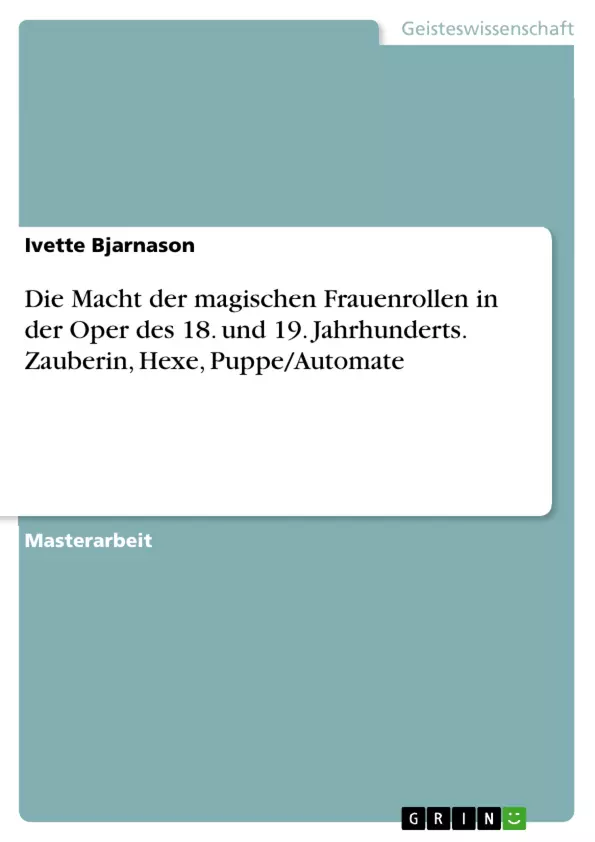Die vorliegende Arbeit widmet sich den starken Frauen in den Opern des 18. und 19. Jahrhunderts und der Frage, weshalb und auf welche Weise ihre Macht mit magischen Fähigkeiten verbunden ist. Dazu werden geschichtliche, literarische, religiöse und musikhistorische Hintergründe einbezogen und eine nähere Betrachtung der Opernkompositionen, Libretti sowie der Aufführungsrezeptionen durchgeführt.
Der Fokus der Untersuchung richtet sich auf die weiblichen Rollenpartien in neun epochen- und gattungsübergreifend exemplarisch ausgewählten Opern, die von den Urhebern explizit mit den Bezeichnungen der "Hexe", "Zauberin" oder "Puppe/Automat" versehen wurden bzw. wo es aus der literarischen Vorlage oder dem Libretto eindeutig hervorgeht, dass die Figur über magische (Anziehungs-) Kräfte verfügt oder ihr diese von den anderen Figuren des Opernwerkes unterstellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Die Macht der magischen Frauenrollen in der Oper des 18. und 19. Jahrhunderts
- Einleitung
- Die „Zauberin“ im 18. Jahrhundert: Vom „Geist der Natur“ zum „Verführerischen Weib“
- Die „Hexe“ im 19. Jahrhundert: Von der „Fabelgestalt“ zur „Verkörperung des Bösen“
- Die „Puppe“ (Automate): Vom „Mechanischen Wesen“ zur „Sinnbild der Künstlichkeit“
- Die „Zauberin“ in der Oper
- Die „Zauberin“ als „Geist der Natur“ in den Opern des 18. Jahrhunderts
- Die „Zauberin“ als „Verführerisches Weib“ in den Opern des 18. Jahrhunderts
- Die „Hexe“ in der Oper
- Die „Hexe“ als „Fabelgestalt“ in den Opern des 19. Jahrhunderts
- Die „Hexe“ als „Verkörperung des Bösen“ in den Opern des 19. Jahrhunderts
- Die „Puppe“ (Automate) in der Oper
- Die „Puppe“ als „Mechanisches Wesen“ in den Opern des 19. Jahrhunderts
- Die „Puppe“ als „Sinnbild der Künstlichkeit“ in den Opern des 19. Jahrhunderts
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Analyse der Macht der magischen Frauenrollen in der Oper des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie untersucht die Entwicklung der Rollen der „Zauberin“, der „Hexe“ und der „Puppe“ (Automate) sowie deren Bedeutung im Kontext der jeweiligen Epoche. Dabei werden die Opern und ihre Libretti als Spiegelbilder der gesellschaftlichen und kulturellen Normen der Zeit betrachtet.
- Die Entwicklung der magischen Frauenrollen von der „Zauberin“ über die „Hexe“ zur „Puppe“ (Automate)
- Die Bedeutung der magischen Frauenrollen als Symbol für das „Verführerische“, das „Böse“ und die „Künstlichkeit“
- Die Darstellung der magischen Frauenrollen im Kontext der jeweiligen Epoche
- Die Verbindung zwischen der Oper und den gesellschaftlichen und kulturellen Normen der Zeit
- Die Rezeption der magischen Frauenrollen in der Musikgeschichte und der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die zentrale These der Hausarbeit vor, die sich mit der Macht der magischen Frauenrollen in der Oper des 18. und 19. Jahrhunderts befasst.
- Das erste Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der „Zauberin“ in der Oper und ihrer Rolle als „Geist der Natur“ und „Verführerisches Weib“ im 18. Jahrhundert.
- Das zweite Kapitel analysiert die „Hexe“ in der Oper und untersucht ihre Transformation von der „Fabelgestalt“ zur „Verkörperung des Bösen“ im 19. Jahrhundert.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der „Puppe“ (Automate) in der Oper und ihrer ambivalenten Bedeutung als „Mechanisches Wesen“ und „Sinnbild der Künstlichkeit“.
Schlüsselwörter
Magische Frauenrollen, Oper, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, „Zauberin“, „Hexe“, „Puppe“ (Automate), Gesellschaft, Kultur, Libretto, Rezeption, Musikgeschichte, Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Welche magischen Frauenrollen werden in der Oper des 18. und 19. Jahrhunderts untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Rollentypen der Zauberin, der Hexe und der Puppe bzw. des Automaten.
Wie wandelte sich das Bild der „Zauberin“ im 18. Jahrhundert?
Die Rolle entwickelte sich vom „Geist der Natur“ hin zum „verführerischen Weib“, was die damaligen gesellschaftlichen Vorstellungen von weiblicher Macht widerspiegelte.
Was symbolisiert die „Hexe“ in den Opern des 19. Jahrhunderts?
Die Hexe transformierte sich in der Rezeption von einer bloßen Fabelgestalt zur Verkörperung des absolut Bösen.
Warum ist die „Puppe“ oder der „Automat“ eine magische Frauenrolle?
Die Puppe steht als Sinnbild für Künstlichkeit und mechanisches Wesen, das oft über eine unheimliche oder magische Anziehungskraft auf andere Figuren verfügt.
Inwiefern spiegeln diese Rollen gesellschaftliche Normen wider?
Die Verknüpfung von weiblicher Macht mit Magie diente oft dazu, starke Frauenfiguren als unnatürlich, gefährlich oder künstlich zu markieren und so bestehende Normen zu festigen.
- Quote paper
- Ivette Bjarnason (Author), 2022, Die Macht der magischen Frauenrollen in der Oper des 18. und 19. Jahrhunderts. Zauberin, Hexe, Puppe/Automate, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1355612