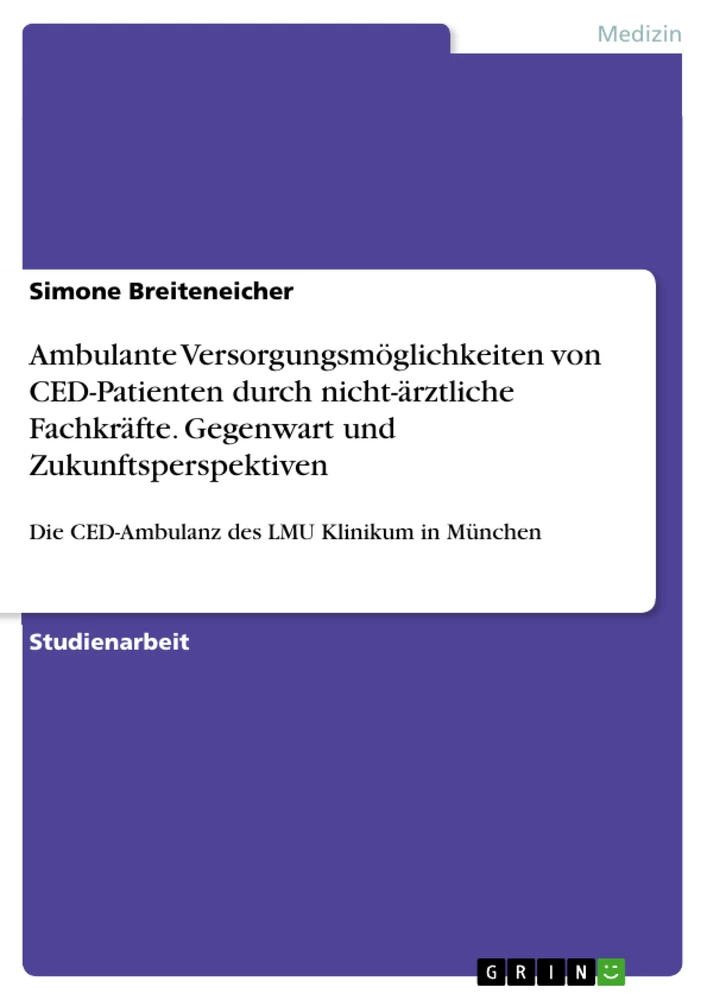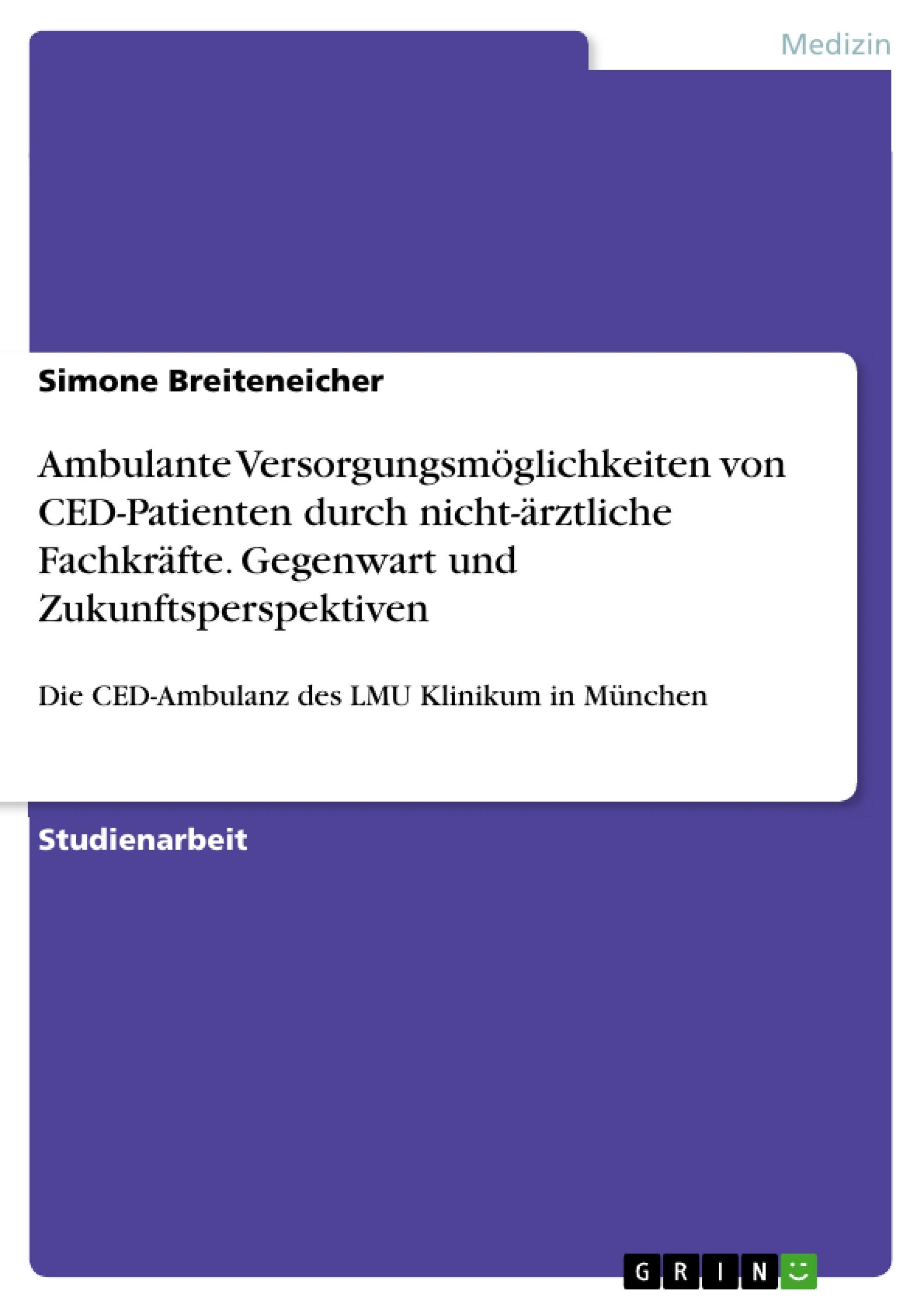In der vorliegenden Arbeit sollen neben dem IST-Zustand auch Möglichkeiten und Perspektiven für die Versorgung von CED-Patienten im ambulanten Bereich durch nicht-ärztliche Fachkräfte am Beispiel der CED-Hochschulambulanz des LMU Klinikum München beleuchtet werden.
Der Anspruch und die Anforderungen in der Krankenversorgung - sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich - nehmen für alle spürbar zu. Die Belastungsgrenzen von medizinischem Personal in Kliniken und Praxen wurden vor allem in den letzten Monaten in den Medien immer wieder thematisiert, unabhängig auch von der Corona-Pandemie. Dies soll Anlass sein, das Augenmerk auf eine Risikopatientengruppe aus dem Bereich der chronischen Erkrankungen zu lenken, die erst in den letzten Jahren zunehmend in das Bewusstsein der Öffentlichkeit aber auch der Ärzte gerückt ist: Patienten mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung.
Die Versorgung dieser Patientengruppen erfolgt meist in internistisch-gastroenterologischen Praxen oder Spezialambulanzen in Kliniken, deutlich seltener über allgemeinmedizinische Praxen. Unabhängig von der Erkrankung ist eines der Hauptprobleme in der Versorgung aktuell der zunehmende Mangel an ärztlichem Personal vor allem im ländlichen Raum. Dieses ist sehr deutlich spürbar im fachärztlichen Bereich. Patienten suchen häufig lange nach einer Praxis, bis ihnen ein Termin zur Diagnostik und dann zur Weiterbetreuung angeboten werden kann. Die zunehmende Komplexität in der Versorgung von Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und der damit verbundene Verwaltungsaufwand ist aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten für behandelnde Ärzte unattraktiv.
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1 CHRONISCH ENTZÜNDLICHE DARMERKRANKUNGEN
1.2 VERSORGUNG VON AMBULANTEN PATIENTEN IN DEUTSCHLAND DURCH NICHT-ÄRZTLICHE FACHKRÄFTE .
1.3 GRÜNDE UND BENEFIT FÜR EIN UMDENKEN HINSICHTLICH DES STELLENWERTES NICHT-ÄRZTLICHER FACHKRÄFTE
1.4 DELEGIERBARE ÄRZTLICHE TÄTIGKEITEN AN NICHT-ÄRZTLICHE FACHKRÄFTE
1.5 ORGANISATION DER PATIENTENVERSORGUNG DURCH NICHT-ÄRZTLICHE FACHKRÄFTE IN EUROPA
1.6 WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN IN EUROPA FÜR NICHT-ÄRZTLICHE FACHKRÄFTE IM BEREICH CED ...
1.7 WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN UND DEREN NUTZEN IN DEUTSCHLAND FÜR NICHT-ÄRZTLICHE FACHKRÄFTE IM BEREICH CED
2. VERSORGUNG VON CED-PATIENTEN IM LMU KLINIKUM 13
2.1 GRUNDLEGENDE STRUKTUR DES LMU KLINIKUM
2.2 ÜBERBLICK DER VERSORGUNGSSTRUKTUR VON AMBULANTEN PATIENTEN IN DER MEDIZINISCHEN KLINIK II AM LMU KLINIKUM
2.3 ÜBERBLICK ÜBER DIE VERSORGUNGSSTRUKTUR VON AMBULANTEN CED-PATIENTEN IN DER MEDIZINISCHEN KLINIK II AM LMU KLINIKUM
2.4 AKTUELLE SITUATION (IST-ZUSTAND) IN DER VERSORGUNG VON CED-PATIENTEN AN DER LMU
2.5 MITARBEITERBEFRAGUNG
3. PERSPEKTIVEN DER CED-PATIENTENVERSORGUNG DURCH NICHT-ÄRZTLICHE FACHKRÄFTE („SOLL“-ZUSTAND)
3.1 MÖGLICHKEITEN IN DEUTSCHLAND
3.2 MÖGLICHKEITEN AM LMU KLINIKUM
4. ABSCHLUSSFAZIT
LITERATURVERZEICHNIS
ANLAGEVERZEICHNIS
Das Anlageverzeichnis wurde entfernt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Der Anspruch und die Anforderungen in der Krankenversorgung - sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich - nehmen für alle spürbar zu. Die Belastungsgrenzen von medizinischem Personal in Kliniken und Praxen wurden vor allem in den letzten Monaten in den Medien immer wieder thematisiert, unabhängig auch von der Corona-Pandemie. Dies soll Anlass sein, das Augenmerk auf eine Risikopatientengruppe aus dem Bereich der chronischen Erkrankungen zu lenken, die erst in den letzten Jahren zunehmend in das Bewusstsein der Öffentlichkeit aber auch der Ärzte gerückt ist: Patienten mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung.
Die Versorgung dieser Patientengruppen erfolgt meist in internistisch- gastroenterologischen Praxen oder Spezialambulanzen in Kliniken, deutlich seltener über allgemeinmedizinische Praxen. Unabhängig von der Erkrankung ist eines der Hauptprobleme in der Versorgung aktuell der zunehmende Mangel an ärztlichem Personal vor allem im ländlichen Raum. Dieses ist sehr deutlich spürbar im fachärztlichen Bereich. Patienten suchen häufig lange nach einer Praxis, bis ihnen ein Termin zur Diagnostik und dann zur Weiterbetreuung angeboten werden kann. Die zunehmende Komplexität in der Versorgung von Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und der damit verbundene Verwaltungsaufwand ist aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten für behandelnde Ärzte unattraktiv.
In der vorliegenden Arbeit sollen neben dem IST-Zustand auch Möglichkeiten und Perspektiven für die Versorgung von CED-Patienten im ambulanten Bereich durch nicht-ärztliche Fachkräfte am Beispiel der CED-Hochschulambulanz des LMU Klinikum München beleuchtet werden.
1.1 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) werden mit den beiden Hauptentitäten Morbus Crohn und Colitis ulcerosa mittlerweile bei ungefähr 0,2 % der europäischen Bevölkerung diagnostiziert.1 Wie der Name es wiedergibt, ist eine CED eine chronisch verlaufende, mit entzündlichen Krankheitsschüben auftretende Erkrankung des MagenDarm-Traktes, welche in jedem Lebensalter, meist aber zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr, erstmalig auftreten kann. Beim Morbus Crohn kommt es zu einer transmuralen Entzündung der Darmschleimhaut. Diese zeigt sich optisch in der Endoskopie oftmals als tiefe Ulcera, sogenannte „Snail trails“ (Schneckenspuren). Typisch dafür ist ebenfalls ein diskontinuierliches Entzündungsmuster im Verdauungstrakt mit einer Hauptlokalisation der Erkrankung im terminalen Ileum. Möglich ist aber auch ein Befall des oberen Gastrointestinaltraktes inklusive der Mundhöhle. Die Colitis ulcerosa ist typischerweise in der Koloskopie durch einen kontinuierlichen Befall beginnend vom Anus her gekennzeichnet und kann das ganze Kolon als sogenannte Pancolitis ulcerosa betreffen. Eine Unterscheidung zwischen den beiden Erkrankung erfolgt endoskopisch durch das Befallsmuster, aber auch histologisch. Typische Symptome beider Erkrankungen sind vor allem Durchfälle, Bauchschmerzen und Gewichtsverlust. Je nach Krankheitsschwere und -dauer können auch Fieber, Engstellen durch andauernde Entzündungen (Stenosen) im Darm, Fisteln oder Abszesse (vor allem perianal) sowie sogenannte extraintestinale (außerhalb des Darms auftretende) Beschwerden, wie zum Beispiel Gelenkschmerzen, Hautveränderungen, Augenentzündungen oder Leber- bzw. Gallenwegserkrankungen wie die PSC, auftreten. Beide Formen der CED, gleich ob milder oder schwerer Verlauf, führen bei wiederholten Erkrankungsschüben mit Entzündungsaktivität zu einem Funktionsverlust und strukturellen Veränderungen des Darms. In Abhängigkeit des Befallsmusters wird die Resorption von Spurenelementen und Vitaminen gestört, ebenso der Eisenstoffwechsel. So steigt u.a. auch das Krebsrisiko bei andauernder Entzündung im Darm, wobei beim Vorliegen einer zusätzlichen PSC ein ungefähr dreifach erhöhtes Risiko für bösartige Zellveränderungen (Dysplasie) in der Kolonschleimhaut gegeben ist.2, 3 Bei Komplikationen wie Abszessen oder Stenosen kann es zur Notwendigkeit einer Operation kommen, was wiederum zu weiteren Einschränkungen (Verlust von Darmabschnitten,
Komplikationen während der Operation, optische „Veränderungen“ Narbenbildung) führen kann. Des Weiteren schränken Beschwerden den Alltag der Patienten deutlich und meist über lange Zeiträume ein. Häufige Toilettengänge, Bauchschmerzen, laute Darmgeräusche, Abgehen von Lüften und Stuhl, Unwohlsein, Übelkeit, Blutungen etc. führen zu einer reduzierten Lebensqualität. Die körperliche und psychosoziale Entwicklung kann stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies ist insbesondere in der adoleszenten Lebensphase, in der Jugendliche mit der neu gewonnenen emotionalen und körperlichen Entwicklung in den nächsten Lebensabschnitt, wie Ausbildung/Studium, erste Lebenspartner, starten möchten, relevant. Bauchschmerzen oder Übelkeit werden oft in jungen Jahren auch von Freunden, Familie oder Medizinern als „Reizdarm“ abgetan. Anhaltende Probleme, ob offensichtlich oder im Verborgenen stattfindend, führen daher zusätzlich zu Unverständnis bei Angehörigen und im Bekanntenkreis sowie daraus resultierend zu einer möglichen Selbstisolation des Patienten. Da das flächenmäßig größte menschliche Organ auch eine Vielzahl an anderen Aufgaben hat, ist eine frühzeitige Diagnostik und ggfs. medikamentöse Therapie sowie eine gute medizinische Betreuung zum Erzielen einer klinischen Remission (das Fehlen jeglicher Krankheitszeichen) der Erkrankung oder Response (Linderung der Symptome) beim Patienten von großer Bedeutung. Dies kann mittlerweile durch verschiedene hochwirksame Medikamente, z.B. anti-TNF-alpha Antikörper, Jak- Inhibitoren, IL-12/23-Antikörpern oder anti-Integrin-Antikörper, geschehen. Hat man vor 20 Jahren vor allem noch mit Steroiden wie Prednisolon in der Dauertherapie gearbeitet und damit zum Teil schwere Nebenwirkungen nach Langzeitanwendung in Kauf genommen, werden diese aktuell nur in akuten Schubsituationen eingesetzt. Eine Wachstumsretardierung bei Kindern, Blutzuckerentgleisungen, Bluthochdruck oder Schlafprobleme sind die häufigsten Nebenwirkungen bei der längeren Einnahme von Steroiden.4, 5, 6
Neben der medikamentösen Therapie ist aber auch die begleitende Betreuung der Patienten und ihrer Angehörigen durch den Arzt#, und besonders durch die speziell geschulte, nicht-ärztliche Fachkraft, eine wichtige Komponente in der ganzheitlichen Therapie.7, 30, 31
1.2 Versorgung von ambulanten Patienten in Deutschland durch nichtärztliche Fachkräfte
Im stationären Bereich ist die Versorgung der Patienten durch nichtärztliche Fachkräfte - namentlich durch Gesundheits- und Krankenpflegekräfte (GuKP) - ein Bild, das sich über Grenzen und Kulturen hinweg bewährt hat. Im ambulanten Bereich finden in Deutschland die Med. Fachangestellten (MFA) oder Arzthelfer ihren Einsatz. Aufgrund des Personalmangels werden auch zunehmend „Quereinsteiger“ aus anderen kundenorientierten Bereichen eingesetzt, wie bspw. Hotelfachangestellte im Patientenempfang, Rettungssanitäter oder -assistenten in der stationären und ambulanten Patientenversorgung (OP-Bereich, Intensivstationen etc.).
Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Arbeit die speziell geschulten MFAs, GuKP oder andere nicht-ärztliche Assistenz zur Vereinheitlichung als nicht-ärztliche Fachkraft (näF) beschrieben.
1.3 Gründe und Benefit für ein Umdenken hinsichtlich des Stellenwertes nicht-ärztlicher Fachkräfte
In mittlerweile allen Berufszweigen ist das Fehlen von Fachpersonal bemerkbar. Auch die sozialen Berufsgruppen leiden zunehmend unter Personalweggang oder -ausfall. Mögliche Gründe hierfür sind u.a. bessere Bezahlung in anderen Branchen, fehlende Anerkennung von geleisteter Arbeit oder ein dauerhaft hohes Arbeitspensum.8 Damit einhergehend ist die Patientenversorgung sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich zunehmend schwierig und die verbliebenen Mitarbeiter sind oft überlastet.9
Darunter leiden besonders chronisch erkrankte Patienten, wie die CED- Patienten, da die notwendigen Entscheidungen hinsichtlich Therapie und Diagnostik nicht erfolgen können. So sind ein zunehmendes Umdenken und Bewusstsein um die Wichtigkeit des Assistenzpersonals als zu qualifizierende nicht-ärztliche Fachkräfte zu überlegen und zu fördern. Den ärztlichen Mitarbeitern sollen keine Aufgaben oder Verantwortlichkeiten strittig gemacht werden, es können jedoch durch speziell qualifizierte näF bspw. die verwalterischen Tätigkeiten, welche aufgrund von regulatorischen Anforderungen wie QM, Hygiene oder Datenschutz verpflichtend sind, übernommen werden. Das „Nicht- delegieren“ solcher Aufgaben durch den Arzt kann möglicherweise, aufgrund seiner vielen zusätzlichen Aufgaben, zu Sorgfaltspflichteinbußen, die u.a. auch die Patientensicherheit gefährden können, führen. Alternativ wäre auch eine geringere Patientenzahl denkbar, die dann wiederum zu einer Unterversorgung der übrigen Patienten und einem wirtschaftlichen Defizit führen würde. Um dem entgegenzuwirken, wurde das Thema der Delegation von ärztlichen Tätigkeiten an nicht-ärztliches Personal bereits vor einigen Jahren in vielen Bereichen überdacht.10 So werden u.a. anerkannte, speziell qualifizierte nicht-ärztliche Fachkräfte zu bspw. VERAH, NäPa oder Stomaschwestern geschult und erfolgreich eingesetzt. Ziel dieser Spezialqualifikationen ist die Entlastung der Ärzte durch die Übernahme von delegierbaren ärztlichen Tätigkeiten. Die qualifizierten näF sind somit eine wertvolle und wichtige Stütze für den Arzt und ein wichtiges Bindeglied zwischen Patienten und Arzt.11, 12, 13, 14 Ein weiteres praktisches Einsatzbeispiel für speziell geschulte näF ist die MFA- Sprechstunde, welche u.a. im „Deliver-Care“-Projekt15 oder auch der BioAssist-Studie[16] erforscht wird. Letzteres Projekt, speziell für den Bereich der „CED-Fachassistenz“en ins Leben gerufen, will u.a. mit verschiedenen Fragebögen zur Lebensqualität den Benefit für den Patienten durch die Mitbetreuung durch eine näF im Rahmen von MFA- Sprechstunden erforschen. Profitieren die Patienten von dieser Versorgung, ist dies ein wichtiges Zeichen pro „MFA-Sprechstunde“. Ein positiver Aspekt kann hier die niederschwellige Kontaktaufnahme von Seiten des Patienten zur näF, z.B. bei wiederholten Fragen und Sorgen, sein. Die näF sichert auch die Konstanz hinsichtlich des Ansprechpartners, was ein wesentlicher Baustein im individuellen Krankheitsmanagement und der damit verbundenen Zufriedenheit des Patienten ist. Das Hauptaugenmerk liegt hier insbesondere auf der möglicherweise längeren Zeit Ein- und Aufteilung der Gespräche (z.B. bei der Anmeldung/Terminvergabe oder bei der Blutentnahme bzw. Medikamentenschulung oder Applikation) und der bewussten Vermeidung von Sprachbarrieren (z.B. aufgrund von medizinischen Fachausdrücken). Dies ist besonders wichtig bei Informationsgesprächen, wie z.B. im Rahmen von Patientenschulungen. Hier kann und wird dem Patienten ausreichend Zeit zum Verarbeiten von Informationen und dem Stellen von Fragen gegeben. Diese gibt es möglicherweise in den regulären, eng geplanten Arztgesprächen zur Therapiefestlegung nicht oder der Patient hat aufgrund der vielen Fremd- und Fachausdrücke des Arztes Verständnisprobleme. Die näF ergänzt und unterstützt als vielseitiges Bindeglied zwischen Patient und Arzt sowohl das komplexe Gefüge von Behandlungs- und Kosteneffektivität als auch die Versorgung hinsichtlich Therapie, Beratung und Förderung der Lebensqualität und Therapieadhärenz. Eine detaillierte Übersicht über den Benefit, welchen es durch den Einsatz einer spezialisierten näF im Bereich CED gibt, ist in der Anlage 1 aufgezeigt .
1.4 Delegierbare ärztliche Tätigkeiten an nicht-ärztliche Fachkräfte
Bei der Delegation von ärztlichen Tätigkeiten, beispielsweise an eine näF, handelt es sich um das Übertragen einer fachlichen Aufgabe, die eigentlich nur durch einen Arzt im Rahmen der Ausübung der Heilkunde erfolgen kann, die aber zur selbstständigen Ausführung durch den nicht approbierten Fachangestellten delegiert wird. Der delegierende Arzt muss sich von der verantwortungsbewussten und korrekten Durchführung dieser ärztlichen Tätigkeit durch die Fachkraft überzeugen, sie entsprechend anleiten und für notwendige Interventionen vor Ort bzw. in der Praxis/Klinik sein. Ebenso muss die MFA über entsprechendes Wissen in dem zu delegierenden Bereich verfügen und dieses auch im Rahmen der Sorgfaltspflicht immer wieder auffrischen bzw. erneuern. Daher sind wichtige Punkte zur Entscheidungshilfe, ob und an wen der Arzt eine Tätigkeit delegiert, die Qualifikation(en) und die persönliche Erfahrung mit der med. Fachangestellten (Vertrauen in Person und Können). Im Umkehrschluss ist das Patientenwohl die Messlatte, an der eine mögliche Delegation von ärztlichen Tätigkeiten festgemacht werden sollte, und hierfür sind wie beschrieben regelmäßige Schulungen sowohl für den Arzt als auch für die näF, sowie auch das Einhalten von nationalen und internationalen Expertenstandards wichtig. Auch muss der Arzt sich in regelmäßigen Abständen von der korrekten Durchführung der delegierten Tätigkeit überzeugen. Im Gegenzug hat die näF auch die Verpflichtung, zum Schutz des Patienten und aus haftungsrechtlichem Aspekt, eigene Unsicherheiten dem Arzt zu nennen und ggfs. auch ihr Weigerungsrecht -bzw. -pflicht wahrzunehmen. Zur rechtlichen Absicherung sollte in keinem Fall auf die Dokumentation der Delegation von Seiten des Arztes und der Ausführung von Seiten der Fachkraft verzichtet werden.17
1.5 Organisation der Patientenversorgung durch nicht-ärztliche Fachkräfte in Europa
Die Organisation der Patientenversorgung ist europaweit nicht einheitlich. Kurz zusammengefasst ist die Patientenversorgung und damit einhergehend der Stellenwert von „Schwestern“ in Deutschland nicht unbedingt mit den „Schwestern“ in anderen europäischen Ländern zu vergleichen. Aufgrund der per se unterschiedlichen Gesundheitssysteme und Ausbildungsstandards im Pflegebereich in den einzelnen Ländern Europas, ist eine Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Standards und Empfehlungen sicherlich schwierig. So ist beispielsweise die Ausbildung einer „Nurse“ in England eine dem Hochschulstudium ähnliche Ausbildung, welche mit einem Bachelor oder Master endet. Damit wird eine Annährung und Ebenbürtigkeit zum ärztlichen Berufsbild erreicht. Des Weiteren sind u.a. in England alle „Nurses“ in einer speziell für Pflegekräfte gegründeten Organisation registriert und werden dort, vergleichbar mit den Ärztekammern hierzulande, hinsichtlich Fort- und Weiterbildung unterstützt und gefördert.
[...]
#In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen jeden Geschlechts.
1 Zhao, M: The Burden of Inflammatory Bowel Disease in Europe in 2020. J Crohns Colitis. 2021 Sep 25;15(9):1573-1587.
2 Hoffmann, C: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Thieme Verlag. 2004. S. 58-96.
3 Palmela, C.: Inflammatory Bowel Disease and Primary Sclerosing Cholangitis: A Review of the Phenotype and Associated Specific Features.Gut Liver. 2018 Jan; 12(1): 17-29.
4 Actis, G.C.: History of Inflammatory Bowel Diseases. J. Clin. Med. 2019, 8, 1970.
5 Sturm, A.: Aktualisierte S3-Leitlinie „Diagnostik... Z Gastroenterol 2022; 60: 332-418
6 https://www.dgvs.de/wp- content/uploads/2022/07/Leitlinienaktualisierung- 2022_Konsultationsfassung_Leitlinie-LL-CU_05.07.22.pdf
7 Sturm A.: Inflammatory Bowel Disease Nursing Manual. Springer Verlag
8 https://www.marburger-bund.de/sites/default/files/files/2022-08/3%20- %20MB-Monitor%202022_Zusammenfassung_Ergebnisse_0.pdf
9 https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/3_Service/3.4._Publ ikationen/3.4.5._Krankenhaus_Barometer/2021-12-21_KH- Barometer.pdf
10 https://www.aerzteblatt.de/archiv/187962/Entlastung-fuer-Mediziner-
Delegation-Chancen-und-Grenzen
11 https://www.medi-karriere.de/magazin/mfa-sprechstunde-neues- modell-in-arztpraxen/
12 https://www.medi-karriere.de/weiterbildung/verah/
13 https://www.vmf-online.de/mfa/mfa-perspektiven/naepa-verah
14 https://www.online-zfa.de/archiv/ausgabe/artikel/zfa-10-2009/47624- 103238-zfa20090403-agnes-eva-verah-und-co-wer-kann-den-hausarzt- unterstuetzen-und-wieex/
15 https://inav-berlin.de/deliver-care/
16 https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/neue- versorgungsformen/ced-bio-assist-assistenzpersonal-assoziierte- optimierung-der-betreuung-von-patienten-mit-chronisch- entzuendlichen-darmerkrankungen-ced-unter-einer-biologika- therapie.259
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument befasst sich mit der Versorgung von Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) in Deutschland, insbesondere durch nicht-ärztliche Fachkräfte.
Was sind chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED)?
CED sind chronische Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, die mit Entzündungsschüben einhergehen. Die beiden Hauptformen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.
Wer sind die nicht-ärztlichen Fachkräfte (näF), die in diesem Dokument erwähnt werden?
NäF sind speziell geschulte medizinische Fachangestellte (MFA), Gesundheits- und Krankenpflegekräfte (GuKP) oder andere nicht-ärztliche Assistenten, die Ärzte bei der Versorgung von Patienten unterstützen.
Welche Vorteile bietet der Einsatz von nicht-ärztlichen Fachkräften bei der Versorgung von CED-Patienten?
NäF können Ärzte entlasten, die Patientenversorgung verbessern, die Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten erleichtern und die Lebensqualität der Patienten erhöhen. Sie können auch verwaltungstechnische Aufgaben übernehmen und die Therapieadhärenz fördern.
Welche Aufgaben können an nicht-ärztliche Fachkräfte delegiert werden?
Ärzte können bestimmte ärztliche Tätigkeiten an qualifizierte näF delegieren, wie z. B. Blutentnahme, Medikamentenschulung, Applikation von Medikamenten und die Betreuung von Patienten im Rahmen von MFA-Sprechstunden. Die Delegation muss jedoch sorgfältig erfolgen und dokumentiert werden.
Wie ist die Patientenversorgung durch nicht-ärztliche Fachkräfte in Europa organisiert?
Die Organisation der Patientenversorgung ist europaweit nicht einheitlich. Die Ausbildung und der Stellenwert von Pflegekräften variieren von Land zu Land.
Was sind die wichtigsten Punkte bei der Delegation ärztlicher Tätigkeiten?
Wichtige Punkte sind die Qualifikation der nicht-ärztlichen Fachkraft, das Vertrauen des Arztes in ihre Fähigkeiten, die regelmäßige Schulung von Arzt und Fachkraft, die Einhaltung von Expertenstandards und die Dokumentation der Delegation und Ausführung.
Welche Rolle spielt die Patientenbeteiligung im Rahmen der nicht-ärztlichen Fachkraft Betreuung?
Die Patientenbeteiligung ist ein wesentlicher Bestandteil der Versorgung. Durch die enge Zusammenarbeit mit nicht-ärztlichen Fachkräften können Patienten ihre Bedürfnisse und Fragen leichter äußern, was zu einer besseren Versorgung und Therapieadhärenz führt.
Was sind Beispiele für Spezialqualifikationen für nicht-ärztliche Fachkräfte?
VERAH (Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis), NäPa (Nicht-ärztliche Praxisassistentin) und Stomaschwestern sind Beispiele für Spezialqualifikationen, die es nicht-ärztlichen Fachkräften ermöglichen, erweiterte Aufgaben in der Patientenversorgung zu übernehmen.
- Citation du texte
- Simone Breiteneicher (Auteur), 2022, Ambulante Versorgungsmöglichkeiten von CED-Patienten durch nicht-ärztliche Fachkräfte. Gegenwart und Zukunftsperspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1357177