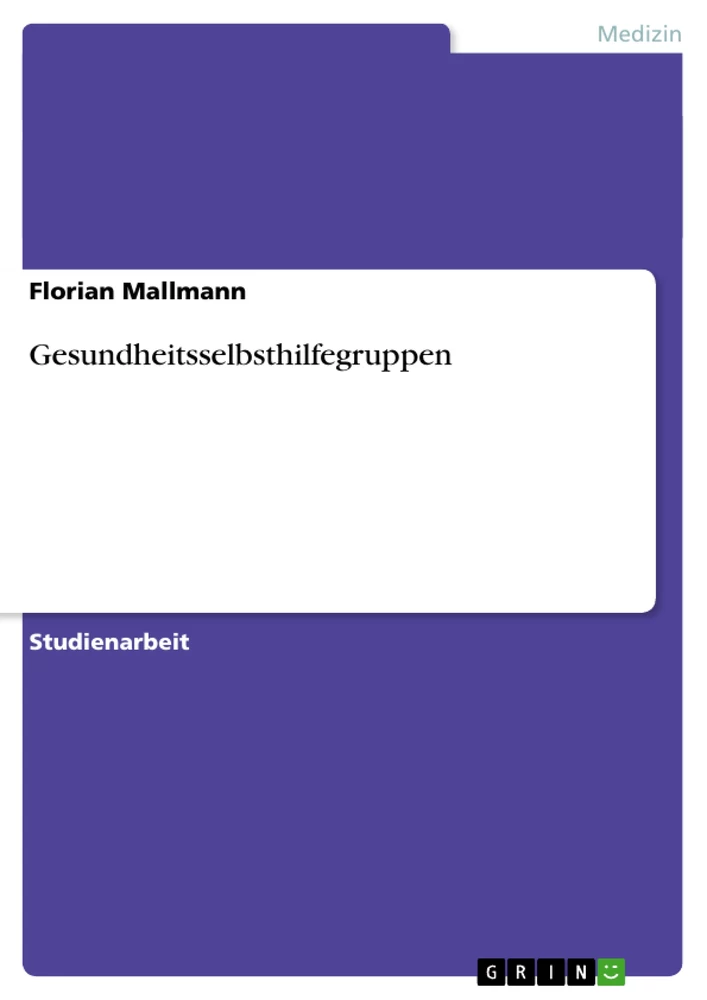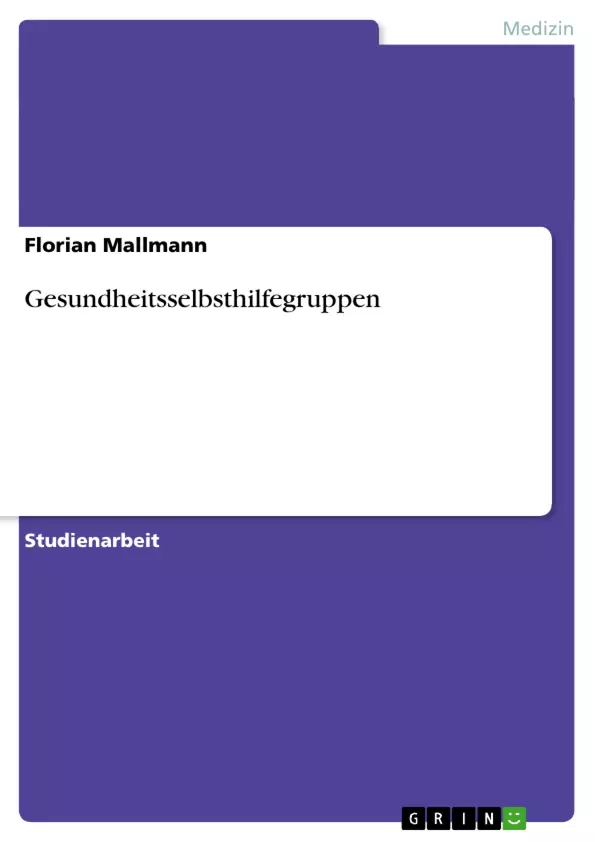Die Gesundheitssysteme westlicher Industriegesellschaften werden zunehmend mit zwei Problemen konfrontiert.
Auf der einen Seite wächst der Bedarf an medizinischer Versorgung aufgrund eines Wandels der Morbiditätsstruktur. Es kommt hinzu, dass die Leistungsfähigkeit der primärsozialen Netzwerke wie z.B. Familie und Nachbarschaft weiter abnimmt.
Auf der anderen Seite stehen den Gesundheitssystemen u.a. durch den Anstieg der Behandlungskosten zunehmend weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Zur Bewältigung können auf der einen Seite die Reorganisation und qualitative Verbesserung der Versorgung sowie ihrer Finanzierung und auf der anderen Seite die Senkung des Bedarfs an medizinischen Leistungen genannt werden.
Die Selbsthilfe hat sich vor allem in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der gesundheitlichen Versorgung entwickelt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgung Betroffener außerhalb des professionellen Dienstleistungssektors. Sie kann durch ihre Stärkung von Eigenverantwortung und Teilhabe der Betroffenen eine Reduktion der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen bewirken. Ebenso leistet sie psychologische Unterstützungen, die in diesem Ausmaß nicht vom professionellen System getragen werden können.
Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe und ihrer besonderer Merkmale. Neben der Arbeitsweise werden die überregionalen verbandlichen Strukturen der Selbsthilfe in Deutschland vorgestellt und deren Zusammenhänge erläutert. Nach allgemeinen Erläuterungen wird anhand einer Studie speziell die Informiertheit der Bevölkerung dargestellt, um Aktivierungspotentiale für das Engagement in Selbsthilfegruppen aufzuzeigen.
Eine zweite Studie zeigt den aktuellen Stand der Kooperationen zwischen Selbsthilfegruppen und Ärzten.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Selbsthilfe
2.1 Gesundheitliche Selbsthilfe
2.2 Merkmale und Arbeitsweise von Gesundheitsselbsthilfegruppen
2.3 Motive zur Teilnahme und Arbeit in Gesundheitsselbsthilfegruppen
2.4 Moderne Formen der Gesundheitsselbsthilfe
3. Strukturen der Selbsthilfe in Deutschland
3.1 Selbsthilfeorganisationen
3.2 Selbsthilfeverbände
3.3 Selbsthilfekontaktstellen
3.4 Förderung der Gesundheitsselbsthilfe
3.5 Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20 c SGB V
4. Ausgewählte empirische Studien
4.1 Beteiligung und Informiertheit in Deutschland
4.1.1 Methodisches Vorgehen
4.2 Kooperationen von Ärzten und Selbsthilfegruppen
4.2.1 Methodisches Vorgehen
4.2.2 Ergebnisse der Befragung
5. Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Darstellung der Struktur der Selbsthilfelandschaft in D
Abbildung 2: Befragungsergebnisse nach Alter und Geschlecht
Abbildung 3 Sichtweisen der Selbsthilfegruppen der Jahre 1989 und
über die Einstellung von Ärzten zu Selbsthilfegruppen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Aufstellung der Befragungsergebnisse nach Alter und Geschlecht
Tabelle 2: Anzahl der Ärzte und Selbsthilfegruppen, die an den Befragungen teilnahmen
Tabelle 3: Ergebnisse der Befragung zur Kontaktintensität
Tabelle 4: Anliegen der Selbsthilfegruppen an die Ärzte
Tabelle 5: : Arten der Kontakte zwischen Selbsthilfegruppen und Ärzten
1. Einleitung
Die Gesundheitssysteme westlicher Industriegesellschaften werden zunehmend mit zwei Problemen konfrontiert.
Auf der einen Seite wächst der Bedarf an medizinischer Versorgung aufgrund eines Wandels der Morbiditätsstruktur. Es kommt hinzu, dass die Leistungsfähigkeit der primärsozialen Netzwerke wie z.B. Familie und Nachbarschaft weiter abnimmt.
Auf der anderen Seite stehen den Gesundheitssystemen u.a. durch den Anstieg der Behandlungskosten zunehmend weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Zur Bewältigung können auf der einen Seite die Reorganisation und qualitative Verbesserung der Versorgung sowie ihrer Finanzierung und auf der anderen Seite die Senkung des Bedarfs an medizinischen Leistungen genannt werden.[1]
Die Selbsthilfe hat sich vor allem in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der gesundheitlichen Versorgung entwickelt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgung Betroffener außerhalb des professionellen Dienstleistungssektors. Sie kann durch ihre Stärkung von Eigenverantwortung und Teilhabe der Betroffenen eine Reduktion der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen bewirken. Ebenso leistet sie psychologische Unterstützungen, die in diesem Ausmaß nicht vom professionellen System getragen werden können.[2]
Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe und ihrer besonderer Merkmale. Neben der Arbeitsweise werden die überregionalen verbandlichen Strukturen der Selbsthilfe in Deutschland vorgestellt und deren Zusammenhänge erläutert. Nach allgemeinen Erläuterungen wird anhand einer Studie speziell die Informiertheit der Bevölkerung dargestellt, um Aktivierungspotentiale für das Engagement in Selbsthilfegruppen aufzuzeigen.
Eine zweite Studie zeigt den aktuellen Stand der Kooperationen zwischen Selbsthilfegruppen und Ärzten.
2. Selbsthilfe
Selbsthilfe bezeichnet eine Form des bürgerschaftlichen Engagements bei dem sich Bürger solidarisch für das eigene Wohl und/oder das Wohl anderer einsetzen. Es handelt sich um ehrenamtliche Tätigkeit in selbstorganisierten Kleingruppen, die sich aus verschiedensten sozialen Verbindungen herausbilden können.[3]
„Selbsthilfe läßt sich, wie andere Formen des freiwilligen Engagements, jenseits der primären sozialen Netze (Verwandte, Nachbarn, Freunde) und diesseits der professionellen Dienstleistungssysteme verorten“.[4] Eine Kooperation mit professionellen Akteuren in Rahmen beratender Funktion und Fachvorträgen ist jedoch nicht ausgeschlossen. Als allgemeine Ziele der Selbsthilfe sind Selbstveränderung, Selbstmanagement und eine Stärkung der Eigenkompetenz zu nennen.[5] Die Selbsthilfe leistet ihre Arbeit komplementär zur Arbeit des Staats in Problembereichen bei denen der Staat nicht in der Lage ist seine Kernaufgaben ausreichend zu erfüllen.[6]
2.1 Gesundheitliche Selbsthilfe
Aufgrund der aktuell geschätzten Anzahl von 70.000 bis 100.000 Selbsthilfegruppen mit mehr als 3 Mio. Mitgliedern aus den unterschiedlichsten Themenbereichen fällt eine eindeutige Zuordnung von Selbsthilfegruppen zum Bereich der Gesundheitsselbsthilfegruppen meist schwer.[7]
Der Begriff der gesundheitlichen Selbsthilfe meint in diesem Zusammenhang jedoch alle individuellen und kollektiven Handlungsformen, die der Vorbeugung und besseren Bewältigung von Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten dienen, ohne dass professionelle Dienste der Gesundheitsversorgung hinzugezogen werden.[8] Eine Kooperation mit professionellen Akteuren in Form von Fachvorträgen oder allgemeiner Beratung wird jedoch nicht ausgeschlossen (Vgl. Kapitel 4.2).[9]
Unter individueller Selbsthilfe wird in diesem Zusammenhang die Hilfe zur Bewältigung eines Zustands im Rahmen natürlicher sozialer Gebilde wie der Familie oder innerhalb eines Haushalts verstanden.[10] Individuelle Selbsthilfe umfasst somit neben Selbstdiagnose, -behandlung, und -medikation auch die Versorgung und Pflege hilfsbedürftiger Angehöriger.[11]
Findet die Selbsthilfe im Rahmen eigens zu diesem Zweck geschaffener Gruppierungen statt so wird von kollektiver Selbsthilfe gesprochen.[12] Im Folgenden wird daher speziell die kollektive Selbsthilfe in Form von Gesundheitsselbsthilfegruppen betrachtet.
2.2 Merkmale und Arbeitsweise von Gesundheitsselbsthilfegruppen
Das erste und entscheidende Merkmale von Selbsthilfegruppen und somit auch der Gesundheitsselbsthilfegruppen besteht in ihrem Handeln in „eigener Sache“. Diese Selbstbetroffenheit macht den Unterschied zwischen Selbsthilfegruppen und anderen Initiativen aus. Des Weiteren lässt sich aus diesem Prinzipien schließen, dass alle Teilnehmer gleichgestellt sind und kein Mitglied anderen vorgesetzt ist. Eine freiwillige, eigenverantwortliche und gegenseitige aktive Zusammenarbeit bildet daher den Grundsatz dieser Gruppen. Die Gruppen treffen sich über einen längeren Zeitraum einmal wöchentlich zu zwei- bis dreistündigen Treffen.[13]
Gesundheitsselbsthilfegruppen bestehen meist aus 6 bis 12 Mitgliedern, da bei einer geringeren Zahl von Mitgliedern die Gefahr des Zerfalls der Gruppe besteht. Ebenso ist auch die maximale Anzahl der Mitglieder geregelt, um die persönlichen Bindungen und Interaktionen innerhalb der Gruppe nicht zu gefährden.[14]
Die Mitwirkung professioneller Helfer ist auf ein geringes Maß beschränkt und es herrscht keinerlei Gewinnorientierung. Vorherrschend ist das Ziel der gemeinsamen Selbst- und/oder Sozialveränderung.[15]
Vor allem im Bereich der Gesundheitsselbsthilfe treten neben der Verarbeitung von persönlichen Problemen und Gefühlen, die Information, die Beratung und der Erfahrungsaustausch im Umgang mit einer Krankheit in den Vordergrund. Es wird auf gegenseitiger Basis die Fachkompetenz jedes einzelnen Teilnehmers verbessert. Zum Teil bilden sich innerhalb der Gruppen Kompetenzgruppen[16] heraus, welche wiederum ihr spezielles Fachwissen an die anderen Mitglieder weitergeben. Diese Informationen erstrecken sich nicht nur auf die Krankheit und deren Bewältigung, sondern erfassen auch das institutionalisierte Versorgungssystem in Form von relevanten Informationen über Ärzte, Gruppen und Institutionen, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden. Dennoch bleiben emotionale Unterstützung sowie Kontakt und Geselligkeit auch in der Gesundheitsselbsthilfe wichtige Faktoren, da viele Mitglieder aufgrund ihrer Erkrankung zur Teilhabe am alltäglichen gesellschaftlichen Leben nicht mehr fähig sind. Diese nicht problemgerichteten Aktivitäten von Gesundheitsselbsthilfegruppen können alle Formen der Freizeitbeschäftigung wie z.B. Sport und Ausflüge umfassen.[17]
Empirisch lassen sich neben den beschriebenen Kleingruppen mit reinem Selbstbezug auch Gruppen mit anderen Ausrichtungen unterscheiden. Hierbei handelt es sich um sogenannte außenorientierte Selbsthilfegruppen, die neben der Selbsthilfe in der Gruppe auch die Beratung und Interessenvertretung außenstehender Betroffener leisten. Ebenso soll die Öffentlichkeit auf die Anliegen der Betroffenen aufmerksam gemacht werden. Bei dieser Form werden die beschriebenen Mitgliederzahlen überschritten, da neben Betroffenen auch Interessierte, Angehörige und Freunde mitwirken.
Letztendlich ist die strikte Unterscheidung zwischen diesen beiden Formen nicht eindeutig möglich, da die Gruppen eng miteinander arbeiten und zum Teil auch starke Übereinstimmungen in ihren gewählten Aufgabenfeldern bestehen.[18]
2.3 Motive zur Teilnahme und Arbeit in Gesundheitsselbsthilfegruppen
Die Motive zur Arbeit in Gesundheitsselbsthilfegruppen lassen sich in vier Dimensionen unterteilen. Diese Dimensionen können wie folgt benannt werden:
1. Bewältigung der Krankheitsbelastung
2. Allgemeiner Kompetenzerwerb im Umgang mit der Krankheit
3. Hilfe zur Bewältigung von Mängeln des professionellen Systems
4. Hilfe zur Bewältigung von Mängeln der primären sozialen Netzwerke
Die Bewältigung der Krankheitsbelastung ist das zentrale Motiv für den Eintritt in eine Selbsthilfegruppe. Die Betroffenen erwarten einerseits eine Besserung im Umgang mit ihren Krankheitserscheinungen und wollen andererseits den alltäglichen Umgang mit der Krankheit zusammen mit anderen Betroffenen verbessern.
Ein vor allem in Gesundheitsselbsthilfegruppen vorhandenes Beitrittsmotiv stellt der Kompetenzerwerb im Bezug auf Kenntnis, Information und Verhaltensweisen im Umgang mit der Krankheit dar. Der von Teilnehmern wahrgenommene Kontrollverlust gegenüber dem professionellen System kann auf diese Weise am besten überwunden werden. Den Teilnehmern ist es wichtig mit Hilfe fachlicher Kompetenz ein Mitspracherecht im Rahmen ihrer eigenen Behandlung zu erwerben. Zusätzlich kann eine effektivere Nutzung des Gesundheitssystems erreicht werden.[19]
Das Motiv der Hilfe zur Bewältigung von Mängeln des professionellen Systems hängt eng mit dem Motiv des Kompetenzerwerbs zusammen. Die Betroffenen haben zunehmend erkannt, dass das professionelle System nicht all ihre Probleme zu lösen vermag. Sie erwarten daher im Rahmen der Gruppenarbeit Informationen über aktuelle Studien und deren Ergebnisse vor allem in Bezug auf neue Behandlungsverfahren für die gegenwärtig eine medizinische Standardtherapie fehlt.[20]
Die Hilfe zur Bewältigung von Mängeln der primären sozialen Netzwerke spielt zwar in Gesundheitsselbsthilfegruppen eine untergeordnete Rolle, wird jedoch vor allem dann zentrales Motiv, wenn die Hilfe durch das primäre soziale Netzwerk nicht mehr gewährleistet werden kann und dieses Defizit nicht ausreichend vom professionellen Versorgungsgeschehen ausgeglichen wird.
Nach Betrachtung der beschriebenen Beitrittsmotive wird deutlich, dass Gesundheitsselbsthilfegruppen neben dem Ziel der besseren Krankheitsbewältigung auch weiter reichende Ziele verfolgen.[21]
2.4 Moderne Formen der Gesundheitsselbsthilfe
Unter den modernen Formen der Gesundheitsselbsthilfe versteht man die verschiedenen Verbreitungs- und Nutzungsmöglichkeiten der Präsenz und Kommunikation im Internet. Diese Möglichkeiten werden in Form von Foren, Chats, E-Mail-Beratung und Informationsseiten ohne Beratungsangebot im Internet angeboten.[22] Letzteres wird vorrangig von Selbsthilfekontaktstellen (Vgl. 3.3) und Selbsthilfeorganisationen (Vgl. 3.1) angeboten, welche auf ihren Seiten über die Arbeit der bestehenden örtlichen Selbsthilfegruppen informieren und bei Bedarf den Kontakt herstellen. Neben den beschriebenen Informationsseiten existieren zudem auch Internetforen, die sich mit der Hilfe zur Bewältigung einer spezifischen Krankheit beschäftigen.[23] Betroffene finden in diesen Foren primär Ansprechpartner denen sie ihre sozialen Probleme und ihre körperlichen Beeinträchtigungen mitteilen können. Andere Betroffene haben dann die Möglichkeit auf diese Einträge zu antworten. Generell nähert sich dieses Vorgehen der realen Arbeit in Gesundheitsselbsthilfegruppen an.[24]
3. Strukturen der Selbsthilfe in Deutschland
Unter dem Begriff der Strukturen der Selbsthilfe in Deutschland werden alle Organisationsformen von Selbsthilfegruppen verstanden, welche sich aus der kleinsten Einheit, der einzelnen Selbsthilfegruppe, herausbilden können.
3.1 Selbsthilfeorganisationen
Unter Selbsthilfeorganisationen versteht man eine Organisationsform der Selbsthilfe die vorrangig mit der überregionalen Interessenvertretung beauftragt ist. Wie die zugehörigen Selbsthilfegruppen arbeiten die Selbsthilfeorganisationen themen- bzw. indikationsspezifisch.[25] Sie zeichnen sich durch meist größere Mitgliederzahlen und einen ausgeprägten Vereinscharakter aus, welcher sich auch in den formalisierten Verwaltungs- und Arbeitsabläufen widerspiegelt. Häufig besteht zusätzlich enger Kontakt zu professionellen Leistungserbringern die zum Teil auch Mitglied in der entsprechenden Organisation sind, da die Mitgliedschaft in einer Selbsthilfeorganisation keine Betroffenheit von der spezifischen Belastung voraussetzt. Selbsthilfeorganisationen erbringen neben der Unterstützung der Selbsthilfegruppen auch gegenüber Nichtmitgliedern Beratungs- und Unterstützungsleistungen und helfen diesen bei der Gründung neuer Gesundheitsselbsthilfegruppen.[26]
Ein wichtiger Faktor zur Abgrenzung von Selbsthilfeorganisationen sowie anderen Organisationsformen ist die mehrheitliche Leitung durch Betroffene und die nur gering ausgeprägte Mitarbeit hauptamtlicher Angestellter. Generell ist der Übergang von Selbsthilfegruppen zu Selbsthilfeorganisationen fließend, weshalb keine eindeutige Differenzierung möglich ist.[27]
3.2 Selbsthilfeverbände
Die erläuterten Selbsthilfeorganisationen sind ihrerseits Mitglieder eines der drei Spitzenverbände, welche sich einem umfassenden Themenbereich widmen, jedoch indikationsspezifische Untergliederungen anbieten.[28] Abbildung 1 (s. Anhang) zeigt schematisch die unterschiedlichen Organisationsebenen.
Von den angegebenen ca. 355 Selbsthilfeorganisationen handelt es sich bei ca. 70%[29] um gesundheitsbezogene Selbsthilfeorganisationen. Diese sind den zwei gesundheitsrelevanten Spitzenverbänden „Der Paritätischen Wohlfahrtsverband“ und der „Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.“ angeschlossen. Zusammen mit der „Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.“, welche suchtbezogene Selbsthilfeorganisationen vertritt und der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen“ (DAG SHG), welche Träger der Selbsthilfekontaktstellen (Vgl. Abschnitt 3.3) ist, stellen diese die Spitzenorganisationen zur Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe gemäß § 20 c SGB V dar (Vgl. Abschnitt 3.5).
3.3 Selbsthilfekontaktstellen
Die Aufgaben von Selbsthilfekontaktstellen liegen in der allgemeinen Unterstützung von Selbsthilfegruppen bei deren Arbeit und Verbreitung. Sie sind örtlich, regional und vereinzelt auch bundesweit tätig und beschäftigen im Gegensatz zu anderen Einrichtung der Selbsthilfe hauptamtliches Personal. Sie stellen somit eine professionelle Unterstützung in allen Themen- und Indikationsbereichen der Selbsthilfelandschaft dar.[30] Ihr Aufgabenprofil kann in vier Bereiche gegliedert werden. Ihre erste Aufgabe besteht in der Organisation und Dokumentation der Selbsthilfearbeit. Sie halten Informationen über bestehende Selbsthilfegruppen und deren Ansprechpartner für Interessenten bereit. Ebenso kümmern sie sich im Bedarfsfall um die nötigen Räumlichkeiten für Gruppensitzungen.[31] Als zweite Aufgabe gilt die Öffentlichkeitsarbeit und allgemeine Selbsthilfeunterstützung. Dies beinhaltet zum einen Pressearbeit und Organisation von Informationstagen, zum anderen auch die Information der Selbsthilfegruppen über neue Förderungsmöglichkeit und deren Inanspruchnahme. Zusätzlich vermitteln sie selbsthilfebezogene Weiterbildungsangebote an interessierte Mitglieder.[32]
Ihre dritte Aufgabe besteht darin, interessierte Bürger über das Angebot und dessen bestmögliche Nutzung zu informieren. Die angestellten Selbsthilfeberater streben in diesem Rahmen keine therapeutische Wirkung an, sondern versuchen das Selbsthilfepotential der Interessenten zu aktivieren. Ihnen werden vorhandene Selbsthilfegruppen empfohlen oder Hilfen bei der Gründung neuer Gruppen bereitgestellt.[33] Als vierter Aufgabenbereich wird die Verknüpfung der Gesundheitsselbsthilfe mit dem professionellen Gesundheitssektor gesehen. Die Selbsthilfekontaktstellen streben Kooperationen in Form von ehrenamtlichen Fachvorträgen und die Vermittlung betroffener Patienten in die Selbsthilfegruppen an. Die bekannteste der aktuell ca. 271 Selbsthilfekontaktstellen ist die bundesweit tätige „Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen“ (NAKOS). Sie wird von der in Abschnitt 3.3 genannten DAG SHG getragen. Die DAG SHG als deutsche Fachverband für Selbsthilfekontaktstellen empfiehlt eine Vorhaltung von 2,5 Selbsthilfeberatern pro 200.000 bis 500.000 Einwohnern einer Region.[34] Mehr als 60% der vorhandenen Selbsthilfekontaktstellen werden von freien Trägern wie Wohlfahrtsverbänden und kleineren Vereinen getragen und finanziert.[35]
[...]
[1] Vgl. Borgetto (2004) S. 22.
[2] Vgl. GBE (2004), S. 20.
[3] Vgl. Braun (1997), S. 12.
[4] Braun (1997), S. 13.
[5] Vgl. Braun (1997), S. 12.
[6] Vgl. Olk (1996), 119.
[7] Vgl. GBE (2004), S. 7, DAGSH (2008), S. 13.
[8] Vgl. Badura (1983), S. 10.
[9] Vgl. Braun (1997), S. 12.
[10] Vgl. Borgetto (2004), S. 79.
[11] Vgl. GBE (2004) S. 8.
[12] Vgl. Borgetto (2004), S. 80.
[13] Vgl. Moeller (1996), S. 93–95.
[14] Vgl. Moeller (1984), S. 18.
[15] Vgl. v. Ferber (1987), S. 80.
[16] Bei genauerer Betrachtung der „Laien“ stellt sich heraus, dass sie über ein sehr spezialisiertes Fachwissen im Bezug auf die eigene Krankheit verfügen. Vgl. Huber (1994), S. 15.
[17] Vgl. Badura (1983), S. 18 f.
[18] Vgl. Braun (1997), S. 16-19.
[19] Vgl. v. Ferber (1987), S. 87-90.
[20] Vgl. Röhrig (1991), S. 3.
[21] Vgl. v. Ferber (1987), S. 90.
[22] Vgl. Teschke (2008), S. 44.
[23] Vgl. Thiel (2000), S. 4.
[24] Vgl. Schielein et al. (2007), S. 29.
[25] Vgl. GBE (2004), S. 17.
[26] Vgl. Borgetto (2004), S. 84-85.
[27] Vgl. GBE (2004), S. 18.
[28] Vgl. Borgetto 2004), S. 161.
[29] Thiel (2007), S. 20.
[30] Vgl. GBE (2004), S. 18.
[31] Vgl. Braun (1994), S. 33.
[32] Vgl. Braun (1997), S. 117.
[33] Vgl. Braun (1997), S. 36.
[34] Vgl. GBE (2004), S. 20.
[35] Vgl. Thiel (2007), S. 11.
Häufig gestellte Fragen
Was leisten Gesundheitsselbsthilfegruppen?
Sie bieten Betroffenen emotionalen Rückhalt, Erfahrungsaustausch und stärken die Eigenkompetenz im Umgang mit chronischen Krankheiten.
Wie arbeiten Selbsthilfegruppen in Deutschland?
Sie sind meist ehrenamtlich organisiert, basieren auf dem Prinzip der Gleichheit aller Mitglieder und treffen sich regelmäßig zum Austausch "in eigener Sache".
Welche Rolle spielen Kooperationen mit Ärzten?
Ärzte können als Fachberater fungieren, während Selbsthilfegruppen Patienten helfen, die therapeutischen Empfehlungen im Alltag besser umzusetzen.
Was ist der gesetzliche Rahmen für die Förderung der Selbsthilfe?
Die Förderung ist in § 20h SGB V (früher § 20c) geregelt, wonach Krankenkassen Selbsthilfegruppen finanziell unterstützen müssen.
Wie viele Selbsthilfegruppen gibt es in Deutschland?
Schätzungen gehen von ca. 70.000 bis 100.000 Gruppen mit über 3 Millionen Mitgliedern aus.
- Citar trabajo
- Florian Mallmann (Autor), 2008, Gesundheitsselbsthilfegruppen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135786