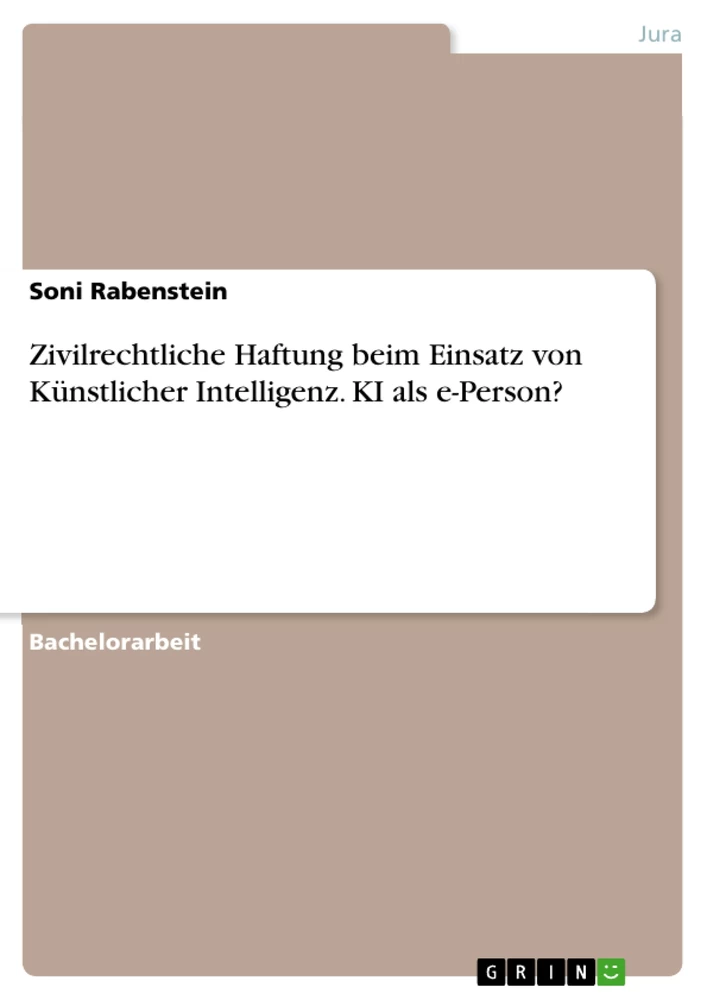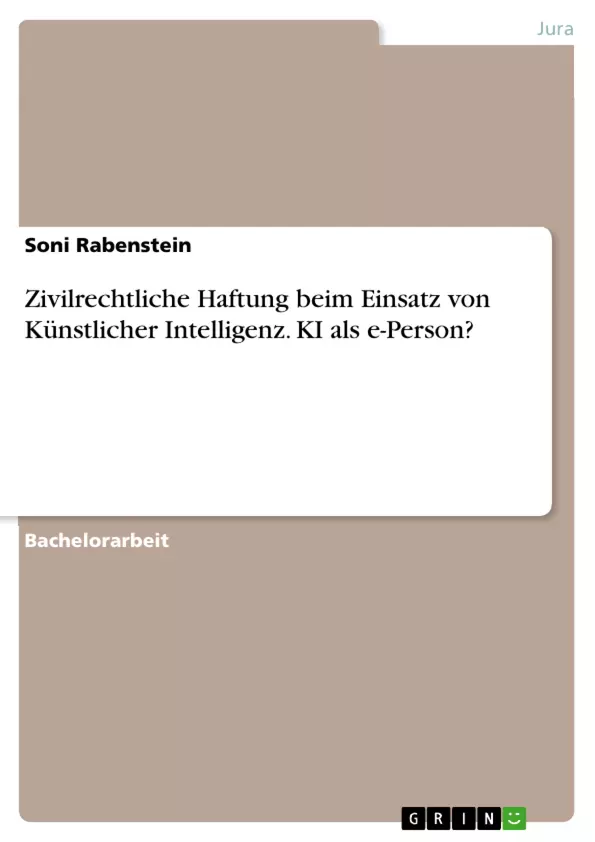Die Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Aspekten der KI, insbesondere mit der Frage der Haftung bei Fehlern und daraus resultierender Schäden von KI-basierten Systemen aus zivilrechtlicher Sicht. Es wird zudem näher auf die Frage einer "electronic person" eingegangen, die neben natürlichen und juristischen Personen mit ins deutsche Gesetz als eigenständiges Rechtssubjekt mit Rechten und Pflichten aufgenommen werden soll. Die Arbeit beinhaltet eigenständig ausgedachte, simple Beispielfälle, anhand derer die Anwendung der in Frage kommenden Rechtsnormen sowie die Theorie allgemein besser erklärt und veranschaulicht wird. Zum Schluss wurden eigenständig Musterklauseln im Rahmen einer AGB Prüfung hinsichtlich autonomer Systeme entworfen.
Das Einsatzgebiet von Robotern wächst persistent, menschliche Arbeitskraft wird zunehmend durch solche ersetzt. So sind autonom agierende Systeme bereits in der Lage, etwa bildgebende Diagnostik schneller und zuverlässiger auszuwerten als über Jahre ausgebildete Fachärzte oder dem Menschen bislang unbekannte Fortschritte bei der Entwicklung von Arzneimitteln zu erzielen.
Doch auch schreitet die Digitalisierung unseres Alltags stetig voran, wonach alltägliche Gebrauchssachen zunehmend "intelligenter" werden: Kühlschränke erledigen eigenständig Einkäufe und Fahrzeuge fahren ohne einen Fahrer,
was mittels maschineller Lernverfahren ermöglicht wird.
Gerade für das Privatrechtssystem ergeben sich hieraus jedoch viele ungeklärte Fragen: Wem ist bei einem Vertragsschluss mit/ durch autonome Systeme die Willenserklärung zuzurechnen? Kommt dem autonomen System dahingehend eine Rechtsfähigkeit zu, wonach es Träger von Rechten und Pflichten wird? Wer haftet, wenn das System einen Fehler macht und dadurch einen Schaden verursacht?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsbestimmung und Einordnung KI
- 1. Automatisierung
- 2. Autonomie
- a) Maschinelles Lernen
- b) Deep Learning
- c) Roboter
- III. Vertragsrechtliche Herausforderungen beim Einsatz von KI
- 1. Klassischer Vertragsschluss
- 2. Vertragsschluss unter Einsatz von Software
- a) Automatisierte Willenserklärungen
- b) Autonome Willenserklärungen
- aa) Eigene Willenserklärung der KI
- (1) Objektiver Tatbestand
- (2) Subjektiver Tatbestand
- bb) Anwendung des Stellvertretungsrechts
- cc) Botenschaft
- dd) Blanketterklärung
- ee) Zwischenergebnis
- ff) KI als eigene Rechtspersönlichkeit (ePerson)?
- c) Zwischenergebnis
- IV. Zivilrechtliche Haftung bei Fehlern autonomer Systeme
- 1. Haftungsgrundlagen
- 2. Haftung des Nutzers/ Betreibers
- a) Vertragliche Haftung
- aa) Eigenes Verschulden
- bb) Fremdverschulden, § 278 BGB
- (1) Analoge Anwendung des § 278 BGB
- (2) Eigene Haftung des autonomen Agenten
- (3) Verhaltensfiktion
- cc) Zwischenergebnis
- b) Deliktische Haftung
- aa) Verschuldenshaftung
- bb) Analoge Anwendung des § 831 BGB
- cc) Gefährdungshaftung
- V. AGB Recht
- 1. Musterklausel
- 2. AGB - Klauselkontrolle
- a) Neue Regelungen zu Verträgen mit digitalen Produkten
- b) Mögliche Abhilfemaßnahmen
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit den rechtlichen Herausforderungen, die sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Vertragsrecht ergeben. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Vertragsschluss unter Einsatz von KI-Systemen und untersucht die Haftung für Schäden, die durch autonome Systeme verursacht werden. Darüber hinaus beleuchtet sie die besonderen Herausforderungen im Bereich des Allgemeinen Geschäftsbedingungenrechts.
- Vertragsrechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI
- Haftung für Schäden durch autonome Systeme
- AGB-Recht im Kontext von KI-Systemen
- Autonome Willenserklärungen und ihre rechtliche Einordnung
- Die Rolle der KI im Zivilrecht
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der rechtlichen Herausforderungen im Kontext von KI ein und erläutert die Relevanz des Themas. Sie liefert einen kurzen Überblick über die Inhalte der Ausarbeitung.
- II. Begriffsbestimmung und Einordnung KI: Dieses Kapitel definiert den Begriff der KI und ordnet sie in verschiedene Kategorien ein. Es beschreibt die Funktionsweise von KI-Systemen, insbesondere im Hinblick auf Automatisierung und Autonomie. Es werden auch die Begriffe Maschinelles Lernen, Deep Learning und Roboter erläutert.
- III. Vertragsrechtliche Herausforderungen beim Einsatz von KI: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI im Vertragsrecht. Es analysiert, wie sich der Vertragsschluss unter Einsatz von KI-Systemen auf den traditionellen Vertragsschluss auswirkt. Besonderes Augenmerk wird auf die Frage gelegt, ob und wie KI-Systeme eigene Willenserklärungen abgeben können.
- IV. Zivilrechtliche Haftung bei Fehlern autonomer Systeme: Dieses Kapitel behandelt die Frage der zivilrechtlichen Haftung für Schäden, die durch autonome Systeme verursacht werden. Es untersucht die verschiedenen Haftungsgrundlagen, die in Betracht kommen, insbesondere die Haftung des Nutzers oder Betreibers des KI-Systems.
- V. AGB Recht: Dieses Kapitel befasst sich mit den Besonderheiten des AGB-Rechts im Kontext von KI-Systemen. Es analysiert, wie die bestehenden Regeln zur Klauselkontrolle auf Verträge mit digitalen Produkten und KI-Systemen angewendet werden können. Darüber hinaus werden mögliche Abhilfemaßnahmen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Ausarbeitung befasst sich mit den Themen Künstliche Intelligenz (KI), Vertragsrecht, Zivilrecht, Haftung, Autonome Systeme, Willenserklärung, AGB-Recht, Musterklausel, Klauselkontrolle, digitale Produkte und Rechtspersönlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer haftet, wenn eine Künstliche Intelligenz (KI) einen Schaden verursacht?
Die Haftung ist komplex. Infrage kommen die vertragliche Haftung des Nutzers oder Betreibers, die deliktische Verschuldenshaftung oder eine Gefährdungshaftung, da KI-Systeme derzeit noch keine eigenen Rechtssubjekte sind.
Kann eine KI selbstständig Verträge abschließen?
KI kann Willenserklärungen automatisiert oder autonom abgeben. Rechtlich wird dies oft über das Stellvertretungsrecht, die Botenschaft oder als Blanketterklärung des Nutzers gelöst, dem die Erklärung zugerechnet wird.
Was ist eine „electronic person“ (e-Person)?
Die e-Person ist ein rechtspolitisches Konzept, das autonomen Systemen eine eigene Rechtspersönlichkeit mit Rechten und Pflichten verleihen würde, ähnlich wie bei juristischen Personen (z. B. GmbHs).
Wie wird Autonomie bei KI-Systemen definiert?
Autonomie bedeutet in diesem Kontext, dass das System durch Maschinelles Lernen oder Deep Learning Entscheidungen trifft, die vom Programmierer nicht im Detail vorhergesehen wurden.
Welche Rolle spielt das AGB-Recht beim Einsatz von KI?
Beim Einsatz von KI müssen Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) so gestaltet sein, dass sie die Risiken autonomer Entscheidungen abdecken und gleichzeitig der strengen Klauselkontrolle des BGB standhalten.
- Quote paper
- Soni Rabenstein (Author), 2022, Zivilrechtliche Haftung beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. KI als e-Person?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1358044