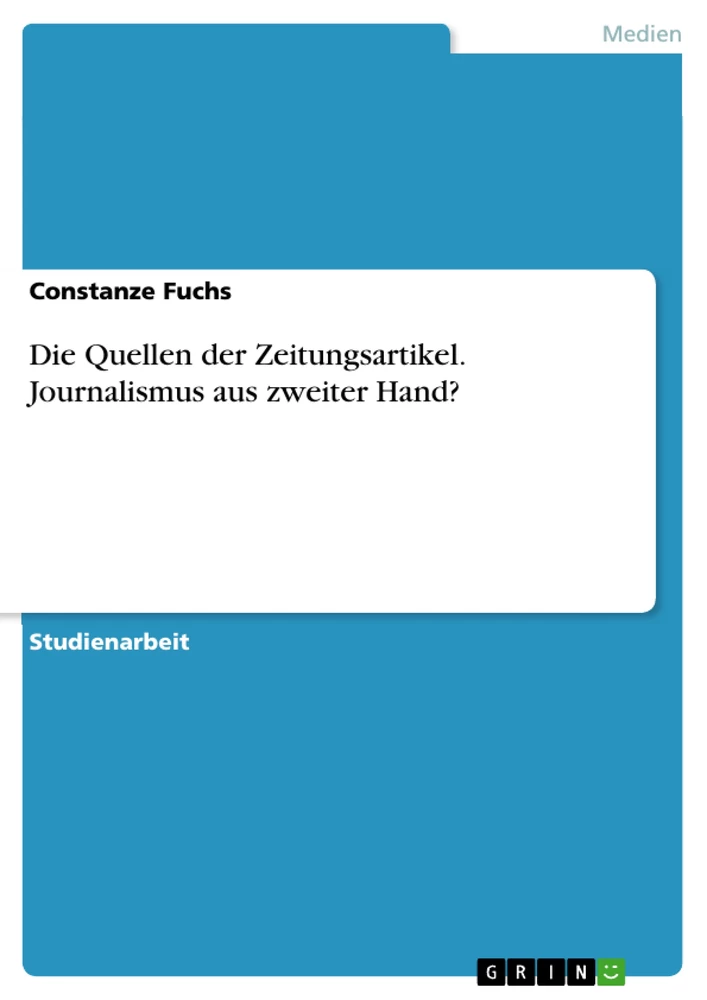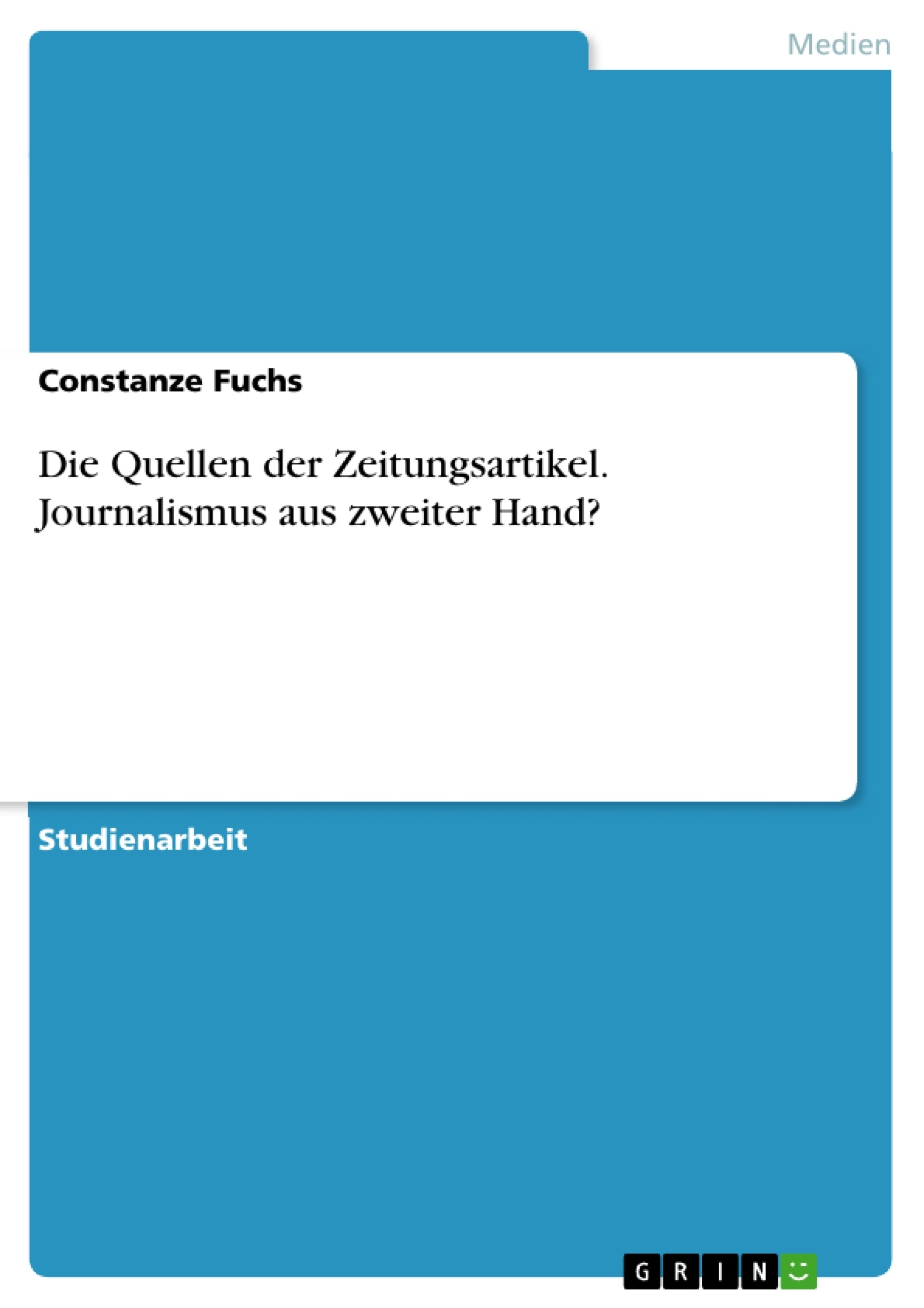„Die Frage, auf welche Quellen sich die Medien stützen und welche Bezugsgruppen bei der Medienkommunikation wirksam werden, hat schon früh die Neugier der Kommunikationsforschung geweckt“. Schon 1910 sprach Max Weber beim 1. Deutschen Soziologentag von der „‘Stoffbeschaffung’“ im Zeitungswesen, nachdem die Nachrichtenagenturen bei Zeitungen vermehrt zu „‘Journalismus aus zweiter Hand’“ geführt hatten. Bis heute haben Nachrichtenagenturen als Informationslieferanten für Zeitungen und andere Massenmedien an Bedeutung hinzu gewonnen. Denn ungefähr 800 bedruckte Zeitungsseiten mit Agenturmeldungen erreichen eine große deutsche Tageszeitung täglich aufgrund moderner Technik, die zu noch schnellerer Übermittlung von noch umfangreicherem Textmaterial führt als damals. Immerhin stehen in Deutschland fünf große Nachrichtenagenturen und weitere Spezialagenturen mit gesonderten Themengebieten für die Informationsbeschaffung zur Verfügung. Zusammen mit anderem Nachrichtenmaterial, wie z.B. Pressemitteilungen, sorgen die Agenturen also für eine regelrechte Informationsflut in den Zeitungsredaktionen. Und es ist Aufgabe der Redakteure, die Masse von Informationen zu selektieren und zu bearbeiten. Dabei bleibt offen, inwieweit die eigene Recherchetätigkeit der Journalisten darunter zu leiden hat oder gar gelähmt wird, wie Barbara Baerns behauptet: „Da Informationen ohnedies, mediengerecht, geliefert werden, fehlt es am »äußeren« Zwang, Motivation mit Sachkompetenz und Ressourcen auszustatten und in die Form von Handlungen zu übersetzen“.
Daher erscheint es mir aus Sicht der Nachrichtenforschung interessant zu untersuchen, wieviel „Fremdbeiträge“ zu Lasten der Beiträge, die von eigenen Journalisten geschrieben werden, nun tatsächlich in den Tageszeitungen abgedruckt werden. Die vorliegende Studie soll am Beispiel der Süddeutschen Zeitung und des Münchner Merkurs darüber Aufschluss geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsfrage
- 3 Anlagen zur Untersuchung
- 3.1 Methode
- 3.2 Anmerkungen zu Grenzen und Gültigkeit der Methode
- 3.3 Hinweise zur verwendeten Literatur
- 4 Ergebnisse
- 4.1.1 Quellenangaben der Zeitungsbeiträge
- 4.1.2 Quellenangaben in den Ressorts
- 4.2 Agenturpräferenzen
- 4.2.1 Agenturpräferenzen der SZ und des Münchner Merkurs
- 4.2.2 Agenturpräferenzen in den Ressorts
- 5 Zusammenfassung und Fazit
- 6 Anhang: Tabellen
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht den Anteil von Agenturmeldungen im Vergleich zu eigens recherchierten Beiträgen in der Süddeutschen Zeitung (SZ) und dem Münchner Merkur. Das Ziel ist es, quantitative Unterschiede zwischen beiden Zeitungen aufzuzeigen und die Hypothese zu überprüfen, dass die SZ aufgrund ihrer größeren Ressourcen und ihres überregionalen Anspruchs einen höheren Anteil an Eigenbeiträgen aufweist und eine größere Vielfalt an Agenturen nutzt als der Münchner Merkur.
- Vergleich des Anteils von Agenturmeldungen und Eigenbeiträgen in der SZ und dem Münchner Merkur.
- Analyse der Agenturpräferenzen beider Zeitungen.
- Untersuchung möglicher Unterschiede in der Quellenverwendung zwischen den Ressorts.
- Beurteilung der Bedeutung von Agenturmeldungen für die journalistische Arbeit.
- Diskussion der Hypothese über den Zusammenhang zwischen Ressourcen, Qualitätsanspruch und der Nutzung von Agenturmeldungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach den Quellen der Zeitungsbeiträge in der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Merkur. Sie beleuchtet die historische Bedeutung von Nachrichtenagenturen und die steigende Relevanz von „Journalismus aus zweiter Hand“. Die Autorin argumentiert, dass die zunehmende Abhängigkeit von Agenturmeldungen die Eigenrecherche der Journalisten gefährden könnte und untersucht daher quantitativ den Anteil von Agenturbeiträgen in den untersuchten Zeitungen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen einer überregionalen Qualitätszeitung (SZ) und einer Lokalzeitung (Münchner Merkur).
2 Forschungsfrage: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage der Studie: Woher beziehen die Süddeutsche Zeitung und der Münchner Merkur ihre Zeitungsbeiträge, und wie unterscheiden sie sich dabei? Es werden zwei konkrete Untersuchungsschwerpunkte definiert: der Anteil von Agenturbeiträgen im Vergleich zu Eigenbeiträgen und die Verwendung verschiedener Nachrichtenagenturen. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass die SZ einen höheren Anteil an Eigenbeiträgen und eine größere Agenturvielfalt aufweisen wird als der Münchner Merkur, begründet durch den größeren personellen und ökonomischen Hintergrund sowie den höheren Qualitätsanspruch.
3 Anlagen zur Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie. Es wird eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt, wobei die Ausgaben der SZ und des Münchner Merkurs vom 19. bis 21. Februar 2003 untersucht werden. Die Auswahl der Ressorts und die Kategorien für die Zuordnung der Quellenangaben (Eigener Bericht, Agentur, 2-3 Agenturen, ohne Angabe, Sonstige) werden detailliert erläutert. Die methodischen Grenzen werden angesprochen, insbesondere die Stichprobenziehung, welche nicht den Kriterien einer Zufallsauswahl entspricht. Es wird auf die vergleichbare thematische Auswahl der Seiten beider Zeitungen geachtet um die Ergebnisse nicht zu verzerren.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der quantitativen Inhaltsanalyse, unterteilt in die Quellenangaben der Zeitungsbeiträge und die Quellenangaben in den einzelnen Ressorts sowie die Agenturpräferenzen der beiden Zeitungen und deren Verteilung über die verschiedenen Ressorts. Die Daten liefern den quantitativen Nachweis für oder gegen die in Kapitel 2 aufgestellte Hypothese.
Schlüsselwörter
Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, Nachrichtenagenturen, Agenturmeldungen, Eigenbeiträge, Qualitätsjournalismus, Lokaljournalismus, quantitative Inhaltsanalyse, Quellenangaben, Medienforschung, Journalismus aus zweiter Hand.
Häufig gestellte Fragen zur Studie: Agenturmeldungen in der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Merkur
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht den Anteil von Agenturmeldungen im Vergleich zu eigens recherchierten Beiträgen in der Süddeutschen Zeitung (SZ) und dem Münchner Merkur. Sie vergleicht eine überregionale Qualitätszeitung mit einer Lokalzeitung und analysiert deren Quellenverwendung.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Woher beziehen die Süddeutsche Zeitung und der Münchner Merkur ihre Zeitungsbeiträge, und wie unterscheiden sie sich dabei? Konkret wird der Anteil von Agenturbeiträgen zu Eigenbeiträgen und die Verwendung verschiedener Nachrichtenagenturen untersucht.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Hypothese besagt, dass die SZ aufgrund größerer Ressourcen und ihres überregionalen Anspruchs einen höheren Anteil an Eigenbeiträgen und eine größere Vielfalt an Agenturen nutzt als der Münchner Merkur.
Welche Methode wird verwendet?
Es wird eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Ausgaben der SZ und des Münchner Merkurs vom 19. bis 21. Februar 2003 wurden untersucht. Die Auswahl der Ressorts und die Kategorien für die Zuordnung der Quellenangaben (Eigener Bericht, Agentur, 2-3 Agenturen, ohne Angabe, Sonstige) sind detailliert beschrieben. Die methodischen Grenzen, insbesondere die Stichprobenziehung, werden angesprochen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der quantitativen Inhaltsanalyse werden präsentiert, unterteilt in die Quellenangaben der Zeitungsbeiträge und die Quellenangaben in den einzelnen Ressorts. Weiterhin werden die Agenturpräferenzen der beiden Zeitungen und deren Verteilung über die verschiedenen Ressorts analysiert. Die Daten liefern den quantitativen Nachweis für oder gegen die aufgestellte Hypothese.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Forschungsfrage, Anlagen zur Untersuchung (Methodenbeschreibung), Ergebnisse, Zusammenfassung und Fazit, Anhang (Tabellen), Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, Nachrichtenagenturen, Agenturmeldungen, Eigenbeiträge, Qualitätsjournalismus, Lokaljournalismus, quantitative Inhaltsanalyse, Quellenangaben, Medienforschung, Journalismus aus zweiter Hand.
Was ist das Fazit der Studie (in Kürze)?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der quantitativen Inhaltsanalyse zusammen und bewertet diese im Hinblick auf die eingangs formulierte Hypothese. Es wird diskutiert, ob die Hypothese bestätigt oder widerlegt werden konnte und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können.
Welche Zeiträume und Ausgaben wurden untersucht?
Die Studie analysiert die Ausgaben der Süddeutschen Zeitung und des Münchner Merkurs vom 19. bis 21. Februar 2003.
Wie werden die Agenturmeldungen kategorisiert?
Die Quellenangaben werden in folgende Kategorien eingeteilt: Eigener Bericht, Agentur, 2-3 Agenturen, ohne Angabe, Sonstige.
- Citar trabajo
- Constanze Fuchs (Autor), 2003, Die Quellen der Zeitungsartikel. Journalismus aus zweiter Hand?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13582