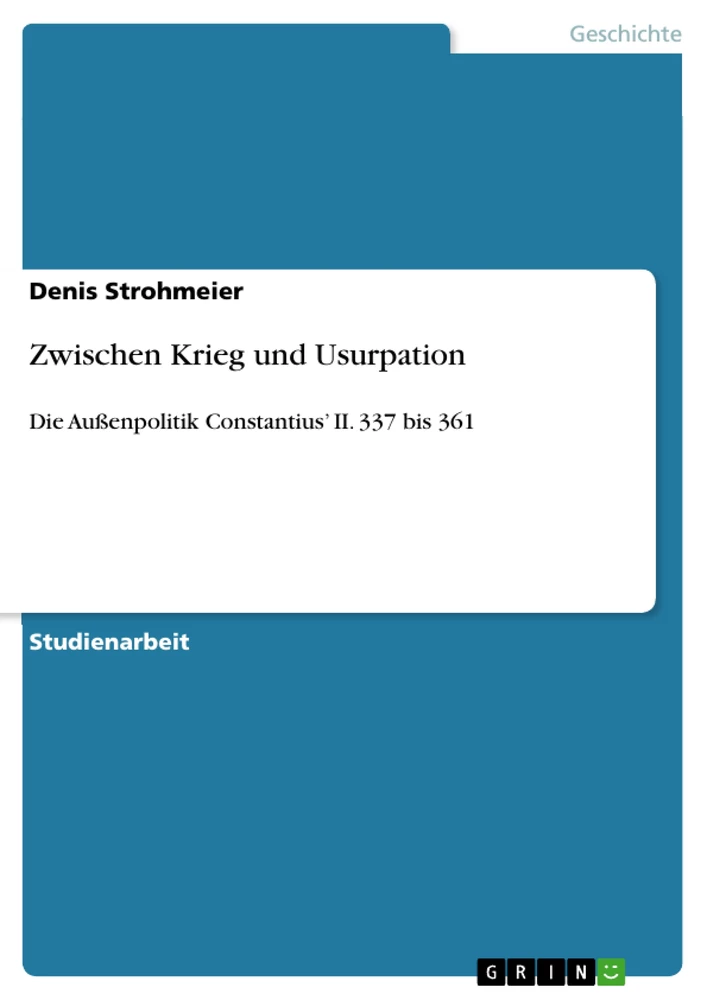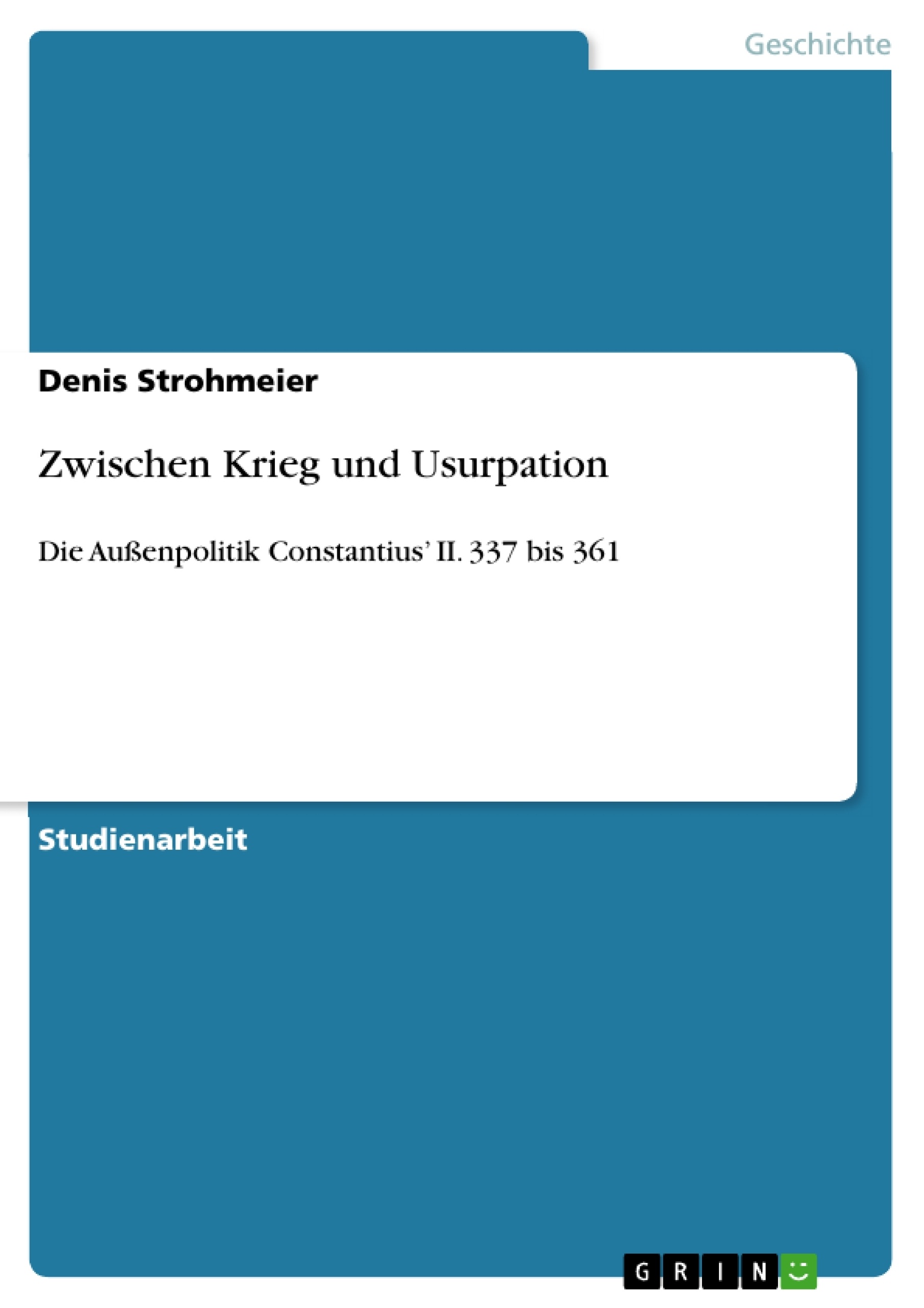Die Regierungszeit Constantius II. wurde von Aurelius Victor sehr treffend mit folgendem Zitat beschrieben: „Doch Julius Constantius, der jetzt 23 Jahre lang als Augustus die Herrschaft innehat, steht, indem ihn Unruhen bald von außen, bald im Inneren bedrängen, nur selten unter Waffen.“ Kaiser Constantius II., Sohn Konstantin des Großen, regierte 337 bis 361 die Geschicke des römischen Weltreiches und der neuen christlichen Staatskirche. Trotz seiner langen Regierungszeit findet Constantius II. häufig nur am Rande Beachtung, meist handelt es sich dabei nur um Detailfragen und Teilaspekte der Geschichte. Vor allem in Werken die sich mit theologischen und kirchenpolitischen Fragen beschäftigen wird auf Constantius Rücksicht genommen. Häufig jedoch wird er zusammen mit seinen Brüdern nur als unbedeutender Übergang zwischen den wirklich „wichtigen“ Herrschern Constantin dem Großen und Julian angesehen. So meint Alexander Demandt zu den Söhnen Konstantins: “Es gab keine herausragende Charaktere unter den Kaisern.“ Im Großen und Ganzen galten die Söhne Konstantins nicht weiter als die „Erfüllungsgehilfen“ des von ihm angefangenen großen geschichtlichen Werkes, der so genannten constantinischen Wende .
Bis auf wenige Lexikartikel gibt es nur eine Monografie die sich umfassend mit Constantius auseinandersetzt. Lediglich Pedro Barcelo hat sich bisher eingehender mit allen Aspekten der Regierung des römischen Herrscher und seiner Bedeutung für die Spätantike und das Römische Reich befasst. Auch in diesem Werk nimmt der Faktor Kirche einen großen Raum ein, wie schon der Titel nahe legt.
Die meist negative Deutung des Nachfolgers Constantins liegt auch an fehlenden zuverlässigen Quellen eines großen Teils der Regierungszeit von Constantius II.. Vor allem die Überliefungen der politischen und militärischen Ereignisse zwischen 337 und 353 sind lückenhaft bzw. bruchstückhaft. Die Quellen und auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum 24 Jahre herrschenden Constantius II. sind eher überschaubar, im Gegensatz zu seinem Nachfolger Julian, der gerade mal zwei Jahre regierte, und über den es eine wahre Flut von Quellen und Literatur gibt.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Innenpolitische Probleme und innerkirchliche Auseinandersetzungen
III. Die Ostfront: Armenien, Persien und Arabien
III.1. Die arabischen Stämme
III.2. Persien und Armenien
III.3. Constantius II. vs. Sapor II
IV. Germanen an Rhein und Donau
IV.1. Germanische Einfälle an der Rheingrenze
IV.1.1 Abwehrkampf unter Constantius II.
IV.1.2 Offensive unter Caesar Julian
IV.2. Donaugrenze
IV.2.1. Goten, Juthungen, Quaden und Sarmaten
IV.2.2 Die Limiganten
V. Fazit
Bibliographie
Quellen
Quellensammlungen
Literatur
I. Einleitung
Die Regierungszeit Constantius II. wurde von Aurelius Victor sehr treffend mit folgendem Zitat beschrieben: „Doch Julius Constantius, der jetzt 23 Jahre lang als Augustus die Herrschaft innehat, steht, indem ihn Unruhen bald von außen, bald im Inneren bedrängen, nur selten unter Waffen.“[1]
Kaiser Constantius II., Sohn Konstantin des Großen, regierte 337 bis 361 die Geschicke des römischen Weltreiches und der neuen christlichen Staatskirche. Trotz seiner langen Regierungszeit findet Constantius II. häufig nur am Rande Beachtung, meist handelt es sich dabei nur um Detailfragen und Teilaspekte der Geschichte. Vor allem in Werken die sich mit theologischen und kirchenpolitischen Fragen beschäftigen wird auf Constantius Rücksicht genommen[2]. Häufig jedoch wird er zusammen mit seinen Brüdern nur als unbedeutender Übergang zwischen den wirklich „wichtigen“ Herrschern Constantin dem Großen und Julian angesehen. So meint Alexander Demandt zu den Söhnen Konstantins: “Es gab keine herausragende Charaktere unter den Kaisern.“[3] Im Großen und Ganzen galten die Söhne Konstantins nicht weiter als die „Erfüllungsgehilfen“ des von ihm angefangenen großen geschichtlichen Werkes, der so genannten constantinischen Wende[4].
Bis auf wenige Lexikartikel gibt es nur eine Monografie die sich umfassend mit Constantius auseinandersetzt. Lediglich Pedro Barcelo hat sich bisher eingehender mit allen Aspekten der Regierung des römischen Herrscher und seiner Bedeutung für die Spätantike und das Römische Reich befasst. Auch in diesem Werk nimmt der Faktor Kirche einen großen Raum ein, wie schon der Titel nahe legt.
Die meist negative Deutung des Nachfolgers Constantins liegt auch an fehlenden zuverlässigen Quellen eines großen Teils der Regierungszeit von Constantius II.. Vor allem die Überliefungen der politischen und militärischen Ereignisse zwischen 337 und 353 sind lückenhaft bzw. bruchstückhaft[5]. Die Quellen und auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum 24 Jahre herrschenden Constantius II. sind eher überschaubar, im Gegensatz zu seinem Nachfolger Julian, der gerade mal zwei Jahre regierte, und über den es eine wahre Flut von Quellen und Literatur gibt[6]. Zur Außenpolitik sind es gar noch weniger brauchbare Quelle. Außenpolitische Aspekte finden selten und dann meist in Verbindung mit Julian Beachtung. Dabei ist gerade die Zeit des Constantius wichtig für die Außenpolitik des Römischen Reiches in der Spätantike. Immerhin gelang es ihm die Grenzen gegen alle einfallenden Feinde zu verteidigen ohne dabei größere Gebietsverluste hinnehmen zu müssen.
Die wichtigsten Quellen für die Außenpolitik im 4. Jahrhundert stammen aus der Feder von Autoren die wichtige Gründe hatte ein negatives Bild des Kaisers zu zeichnen, meist waren sei ihm feindlich gesonnen oder waren Anhänger seines Nachfolgers Julian, der ebenfalls ein eher negatives Bild seines Vorgängers hinterließ. So sind es die Überlieferungen von Amannius Marcellinus, Libanius, Athanasios, Zosimus und nicht zuletzt Julian die das negative Bild von Constantius II. prägen. Hinzukommt die Vielzahl von Schriften in den der Kaiser nur am Rande erwähnt wird, wie in den Schriften der Kirchenväter, die ebenfalls wenig schmeichelhaft sind und beschäftigen sich nur am Rande mit der Außenpolitik der Herrscher, geben jedoch trotzdem wichtige Ansätze, da die Kirchenpolitik sich wesentlich auf die Politik der Herrscher ausgewirkt hat. Diese Teilweise gar bedingte.
Die Außenpolitik wird in dieser Arbeit nach geografischen Räumen und nicht in chronologischer Reihenfolge dargestellt, um ein umfassenderes Bild zu erhalten und die spezifischen Probleme der jeweiligen Regionen herauszustellen und welche Möglichkeit Constantius II. hatte diese zu lösen. Von Bedeutung ist hierbei das Wechselspiel zwischen Innenpolitik und Außenpolitik, die einander bedingen und voneinander abhängen. So wird immer wieder kurz die Rede von innenpolitischen Problemen des römischen Reiches sein die die Außenpolitik beeinflussten, in einigen Fällen waren sie Auslöser für Gefahren an den Grenzen des Reiches. Dabei stand die Außenpolitik, trotz ihrer Bedeutung für das Imperium, immer im Schatten der innenpolitischen Probleme. Nachfolgestreitigkeiten, Usurpationen und die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen behinderten eine langwierig, erfolgreiche Außenpolitik. Der Rahmen in dem die Innenpolitik hier behandelt wird bleibt klein, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
An erster Stelle der Problemfelder der Außenpolitik der direkten Nachfolger Konstantins stand das Perserreich, der östlichen Nachbarn des römischen Reiches an der Euphratgrenze. An der südlichen Ostgrenze gaben häufiger werdende Überfälle arabischer Stämme auf römisches Territorium Anlass zu Sorge. Sie gefährdeten nicht nur die militärischen Operationen gegen Persien, sondern stellte auch eine Gefahr für die Handelswege nach Indien dar[7]. Dieser Nebenschauplatz der Außenpolitik des römischen Reiches ist bisher wenig erforscht und fußt noch heute auf der Forschungsliteratur aus den 50iger und 60iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ähnlich ist es um die die historische Forschung der Sassaniden bestellt und meist nur im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit dem römischen Reich Erwähnung finden. Jedoch bezieht sich das Bild der Perser im 4. Jahrhundert meist nur auf römische Quellen und es erfolgt kaum eine Auswertung der vorhandenen persischen Inschriften und Überlieferungen[8]. Die Berichte speziell für diesen Raum sind ebenfalls sehr negativ für Constantius II. ausgefallen und auch moderne Historiker sind sehr schnell in ihrem Urteil über die Erfolge beziehungsweise die Niederlagen des Kaisers gegen die Perser[9]. Römische Autoren sahen ein Missverhältnis zwischen den Siegen in den inneren Bürgerkrieg und des Kaisers Unvermögen den Feind im Osten endgültig zu schlagen[10]. Es wird wenig beachtet mit wie viel Sorgfalt Constatius II. gerade hier vorgegangen ist, so verband er nicht nur Politik, Diplomatie und Religion um den Gegner im Osten davon abzuhalten das Römische Reich anzugreifen[11]
Der langwierigste Schauplatz römischer Außenpolitik war die Sicherung der Westgrenze an Rhein und Donau. Im 3. Und 4. Jahrhundert kam es dort immer wieder zu Einfällen der germanischer Stämme und einiger anderer Völker, die sich teilweise dauerhaft auf römischem Gebiet niederlassen wollten. Am Rhein stellten Alamannen und Franken die größte Gefahr für das Imperium dar, nutzten diese Stämme doch immer wieder die innenpolitische Schwäche des Reiches um in Gallien einzudringen[12]. An der Donau waren es die Stämme der Sarmaten, Quaden, Limiganten und Goten die versuchten auf römisches Gebiet über den Fluss vorzudringen um sich dort festzusetzen[13]. Die zahlreichen innenpolitischen Krisen, ausgelöst durch Bürgerkrieg und Usurpation gaben den Gegnern immer wieder Anlass die Schwäche des römischen Reiches auszunutzen.
II. Innenpolitische Probleme und innerkirchliche Auseinandersetzungen
Nach dem Tod Konstantins, 337, wurde das römische Reich unter seinen Nachfolgern aufgeteilt. Die drei Söhne des Kaisers, Constantinus II., Constans und Constantin II., sowie deren Cousin Flavius Dalmatius sollten das Reich in Einigkeit regieren so wie einst Diokletian und die Tetrarchie. In der Realität wurden durch Aufstände, Meuterei, Brudermord und Usurpation schnelle neue politische Fakte festgelegt und so herrschten 340 nur noch zwei Männer über das Reich: Constans und Constantius II.[14]. Eher in einem Gegeneinander als in einem Miteinander ganz im Gegensatz zur Intention des Vorgänger der ein mutmaßlich eine hierarchische Viererherrschaft geplant hatte[15].
So zerrissen wie das Reich im politischen, war es auch im Religiösen. Nicht nur gab es Konflikte zwischen Heiden und Christen, sondern auch innerhalb des Christentums. Diese war innerlich tief gespalten und im 4. Jahrhundert von Streitigkeiten über dogmatischen und Auslegungsfragen geprägt. Nicht beschäftigte dies Kaiser und Bischöfe sondern es führte teils zu „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“[16]. Vor allem sorgte der arianische Streit für politischen Zündstoff und Unruhe im Reich, hier besonders sein schärfster Gegner Athanasios. Jener war für viele Kaiser, angefangen bei Konstantin, ein Ärgernis und wurde mehrfach verbannt und wieder rehabilitiert. Der Arianismus war bereits unter Konstantin auf dem Konzil von Nicaea, 325, verurteilt wurden und die Wesensgleichheit zwischen Vater und Sohn als orthodoxen Grundsatz festgelegt[17]. Constantius II. scheint Anhänger des Arianismus zu sein, was er wohl nicht öffentliche äußerte, jedoch schien es die Förderung dieser Richtung offensichtlich[18]. Dies führte vor allem mit seinem Bruder Constans zu Streitigkeiten, der die innerkirchlichen Auseinandersetzungen dazu nutzte Druck auf Constantius auszuüben. Constans betonte seine katholische Haltung durch Schenkungen an die Kirche und durch Verfolgung von Heiden, Juden und Häretikern[19]. Nach dem Tode Constans versuchte Constantius aktiv in die Belange der Kirche einzugreifen und berief mehrere Synoden um zu einer neuen Glaubensformel zu gelangen[20].
Zusätzlicher innenpolitischer Druck waren die hohen Steuern, die zum Erhalt und Unterhalt des Militärs gebraucht wurde[21].
Doch das sind alles Kleinigkeiten im Vergleich mit den zahlreichen Usurpationen die das Römische Reich im inneren stark erschütterten. Die zahlreichen Machtaneignungen durch Magnentius, Vetranio, Silvanus und besonders die Machtergreifung Julians schwächte die Abwehrfähigkeit des Reiches. Denn es kämpften die römischen Soldaten fast mehr gegeneinander anstatt gegen äußere Feind und zahlten dabei einen hohen Blutzoll.
III. Die Ostfront: Armenien, Persien und Arabien
An den Grenzen im Osten kam es im Verlauf der Geschichte des römischen Reiches immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen. Das persische Großreich, war ein nicht zu unterschätzender Gegner, auch wenn es bei weitem nicht über die Ressourcen seines Gegners im Westen verfügte. Schon unter Constantin I. und seinen Vorgänger trafen hier die beiden Großreiche in militärischen Auseinandersetzungen aufeinander, vor allem Armenien entwickelte sich seit es unter römischer Vorherrschaft stand zum Zankapfel zwischen Rom und Persien. Der Konflikt zwischen beiden Mächten zeichnete sich in der Herrschaftszeit Constantius vor allem durch wechselnden Erfolg der Gegner und durch die hohe Anzahl von Schlachten aus[22].
Ein weiteres Problemfeld an den östlichen Grenzen des römischen Reiches waren die wiederkehrenden Übergriffe arabischer Stämme.
Am Beginn seiner Regentschaft sah sich Constanius II. einer Vielzahl von außenpolitischen Problemen ausgesetzt die, ohne auf Unterstützung von seinen Mitkaisern hoffen zu könne, zu lösen waren[23].
III.1. Die arabischen Stämme
In den Grenzgebieten der römischen Machtbereiche Syrien und Arabia siedelten verschieden arabische Stämme, die in erster Linie nordarabischen Ursprungs waren. Diese meist nomadischen oder halbnomadische lebenden Gruppen bildeten sie kleinere Reiche die als Pufferstatten oder tributpflichtige Gebiete dienten[24].
Im 3. und 4. Jahrhundert entwickelten sich diese Stämme zunehmend zu einer Bedrohung für die streitenden Großmächte Rom und Persien. Nicht nur die römischen Provinzen und Händler litten unter den Überfällen der Araber, sondern auch die Perser waren betroffen[25]. Durch Konzentration der Großmächte auf die Grenzen des jeweilig anderen, versuchten die arabischen Stämme das entstehende Machtvakuum in den südlichen Grenzgebieten erfolglos auszufüllen. Für das römische Reich war dies zwar nur eine relativ geringe Bedrohung, jedoch beeinträchtigten die regelmäßigen Überfälle den Handel mit Südarabien und Indien, sowie die Christenmission in diesen Gebieten. Gleichzeitig schwächten die Einfälle die militärische Stärke Constantius II. gegen Persien.
Nach dem die Sassaniden in Mesopotamien größere militärische Operationen durchzuführen begannen, wandte sich der Augustus des Osten den arabischen Stämmen zu und konnte sie mit Geldzahlungen dazu bewegen statt in Syrien, in den persischen Stammlanden zu plündern. In den folgenden Jahren versuchte Constantius II. mit Hilfe von Gesandtschaften und Verhandlungen immer wieder römische Interessen im arabischen Raum zu vertreten und durch zusetzen[26]. Seine Politik beschränkte er dabei nicht nur auf den Schutz der äußeren Grenzen, sondern er vertrat auch handfeste wirtschafts- und religionspolitische Interessen des Reiches. Die Missionstätigkeit für das Christentum und die Sicherheit des Indienhandels standen hierbei im Vordergrund[27]. Trotzdem blieben die Araber eine unberechenbare, jedoch noch kleine, Größe an den Ostgrenzen des Reiches.
III.2. Persien und Armenien
Das persische Reich wurde seit cirka 226 von den Sassaniden regiert, die die Arsakidendynastie ablöste. Für das römische Reich ändert sich dadurch wenig, es bleibt bei den kontinuierlichen Spannungen und Auseinandersetzungen mit dem östlichen Nachbarn[28]. Genau wie ihre Vorgänger orientierten sich die sassanidischen Herrscher außenpolitischen am Achämenidenreich (550-330v.Z.) und erhoben Anspruch auf die einst persischen Gebiete in Kleinasien und Syrien[29]. Gegenüber dem römischen Reich erhoben sie vor allem Anspruch auf das von Rom besetzte Mesopotamien und das römische Klientelkönigreich Armenien[30]. Das gesamte 3. Jahrhundert war durchzogen von militärischen Konflikten zwischen beiden Großreich. Erst Diokletian gelang es 298 mit den Sassaniden einen Frieden zu schließen der längere Zeit Bestand hatte[31].
Im 4 . Jahrhundert dann weite sich der Konflikt unter dem neuen sassanidischen Herrscher Sapur II. (309-379) aus, denn er erneuerte die aggressive Westpolitik gegen Rom. Unter der langen Regierungszeit Sapors erlebte das sassanidische Persien seine glanzvollste Zeit und auch seinen vorläufigen Höhepunkt in der Geschichte. Bereits in jungen Jahren hatte sich der persische Herrscher gegen die arabischen Stämme militärisch erfolgreich gezeigt und versuchte seit den 330iger Jahren gegen das römische Reich vor zugehen. Außenpolitisch versuchte sich die sassanidische Dynastie am Achaimenidenreich zu orientieren[32]. Ähnlich wie Rom an der Rhein- und Donaugrenze, so wurde auch das Perserreich an seinen östlichen und nordöstlichen Grenzen durch fremde Stämme bedroht. Die Nomadenstämme der Kapisee und Altai brachten durch anhaltende Einfälle die innere Stabilität des Reiches in Gefahr, so dass sich der sassanidsiche Herrscher schon zwangsweise nach Westen wenden mußte[33]. Eine weiterer Grund war die Zurückgewinnung der Gebiete die 298 an das römische Reich angetreten werden mussten, als Diokletian den persischen Herrscher Narseh besiegte. Im Frieden von Nisibis mussten die Sassaniden unter anderem fünf armenische Provinzen abtreten[34].
Innenpolitisch ging Sapor II. hart gegen Christen vor um einer vermeintlichen Parteinahme für Rom zuvor zukommen[35]. Diese Christenverfolgung war einer der Gründe Konstantins II. militärisch gegen Persien vorzugehen. Der Tod des großen Kaisers verhinderte jedoch den geplanten Persienfeldzug[36]. Es oblag nun den Persern die Initiative zu ergreifen, da die Teilung des römischen Reiches und die Streitigkeiten unter den Nachfolgern Constantins die militärische Stärke Roms im Osten geschwächt hatten.
[...]
[1] Aur. Vict. 42, 20.
[2] Barcelo 2004; S. 15.
[3] Demandt, Alexander; Geschichte der Spätantike. Das Römische Reich von Diocletian bis Justinian, München 1998; S. 70.
[4] Wirth, Gerhard: Constantin und seine Nachfolger, in: Jahrbuch für Antike und Christentum 39 (1996), S. 13-75; S. 13
[5] Thompson, E. A.; Constantine, Constantius II, and the lower Danube frontier, in Hermes 84 (1956), S. 372-381; S. 378.
[6] Vergleiche dazu: Rosen, Klaus; Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser, Stuttgart 2006; S. 518-546 und Barcelo, Pedro; Constantius II. und seine Zeit. Die Anfänge des Staatskirchentums, Stuttgart 2004; S.251-268.
[7] Barcelo 2004; S. 59.
[8] Lediglich ein Werk neueren Datums hat sich der Vermittlung persischer Geschichte auch unter Berücksichtung der vorhandenen, sassanidischen Quelle, Winter/Dignas; Rom und das Perserreich, Berlin 2001.
[9] Libanios Or. 18, 205-207; Eutrop. X, 10 . Libanios hatte hier vorallem die Ereignisse zwischen 359-360 im Blick in denen es den Persern gelang mehrer Städte zu erobern und zu zerstören, wirklich langfristig erfolgreich waren sie jedoch nicht.
[10] Blockley, R. C.; Constantius and Persia; in: Studies in Latin Literature and Roman History V (1989); S. 465-490; S. 465.
[11] Wirth 1996; S. 52.
[12] Barcelo 1983; 23-24.
[13] Barcelo 2004; S. 150 u. 156-157.,
[14] Eutrop. X, 9.
[15] Brandt, Hartwig; Geschichte der römsichen Kaiserzeit. Von Diokletian und Konstantin bis zum Ende der konstantinschen Dynastie (284-363), Berlin 1998; S. 39.
[16] Ebd. S. 41.
[17] Thdt. HE I 8; Brandt 1998; S. 42.
[18] Thdt. HE II 3.
[19] Demandt 1998; S. 61.
[20] Ebd.; S. 66-67.
[21] Amm. XXI 16, 17; Brandt 1998; S. 44.
[22] Winter, E. / Dignas, B.; Rom und das Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen Konfrontation und Koexistenz, Berlin 2001, S. 107.
[23] Barcelo 2004; S. 59.
[24] Lewis, Bernard; Die Araber, München 2002; S. 33-35. Eines der wenigen Bücher die sich in einem kleinen Abschnitt mit der Geschichte der Arabischen Halbinsel beschäftigt, ansonsten ist der Forschungsbestand in diesem Bereich sehr dünn, da verlässliche Quelle gering sind oder schlicht nicht vorhanden!
[25] Schippmann, Klaus; Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches, Darmstadt 1990; S.32.
[26] Jul. Or. I, 21B.
[27] Barcelo 1981; S. 85-86.
[28] Winter, E.; Die sassanidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n. Chr. - ein Beitrag zum Verständnis der außenpolitischen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten, Frankfurt a. Main [u.a.] 1988; S. 26-28.
.[29] Ebd., S. 30-32.
[30] Barcelo 2004; S. 160.
[31] Winter 1988; S. 216; Die Ansicht Sapur II. würde sich in seiner Aussenpolitik am Achaimenidenreich orientieren ist in der Forchung nicht unumstritten! Siehe dazu: Wirth, Gerhard: Constantin und seine Nachfolger, in: Jahrbuch für Antike und Christentum 39 (1996), S. 13-75; S. 49..
[32] Winter/ Dignas; S. 51-53.
[33] Wirth 1996; S. 49.
[34] Schippmann 1990; S.30.
[35] Winter/ Dignas; S. 243-244(M 30 c); Das hier gewählte Dokument zeigt sehr deutlich die Abneigung Sapors gegenüber den Christen.
[36] Vic. Aur. 41, 16; Schippmann 1990; S. 32-33.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Constantius II.?
Constantius II. war ein Sohn Konstantins des Großen und regierte das Römische Reich von 337 bis 361 n. Chr. Er sicherte die Grenzen des Reiches in einer Zeit ständiger Unruhen.
Was waren die größten außenpolitischen Herausforderungen seiner Regierungszeit?
Die Hauptkonflikte lagen an der Ostfront gegen das Perserreich (Sassaniden) sowie an der Rhein- und Donaugrenze gegen germanische Stämme wie Alamannen, Franken und Sarmaten.
Warum wird Constantius II. in der Geschichtsschreibung oft negativ bewertet?
Dies liegt vor allem an der lückenhaften Quellenlage und der Tatsache, dass viele zeitgenössische Autoren (wie Ammianus Marcellinus oder sein Nachfolger Julian) ihm feindlich gesonnen waren.
Welche Rolle spielte die Kirche in seiner Politik?
Seine Regierungszeit war geprägt vom Arianischen Streit. Constantius II. griff aktiv in kirchliche Dogmenfragen ein, was zu Spannungen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte.
Wie erfolgreich war seine Grenzverteidigung?
Trotz zahlreicher Usurpationen und innerer Unruhen gelang es ihm, das Territorium des Reiches weitgehend ohne größere Gebietsverluste gegen äußere Feinde zu verteidigen.
- Citation du texte
- Denis Strohmeier (Auteur), 2005, Zwischen Krieg und Usurpation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135850