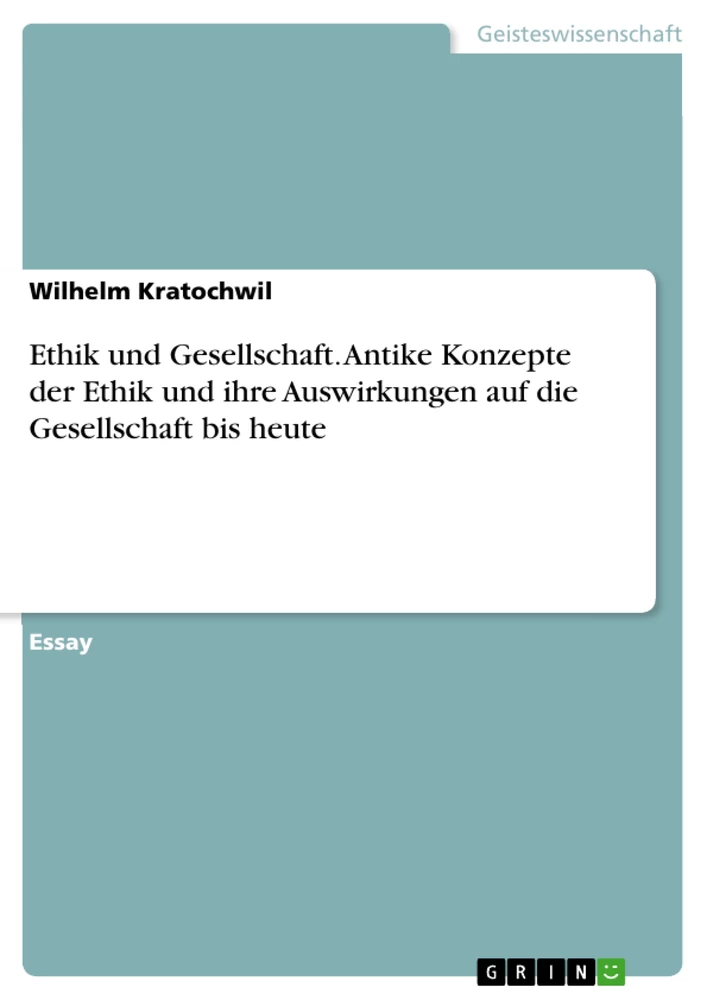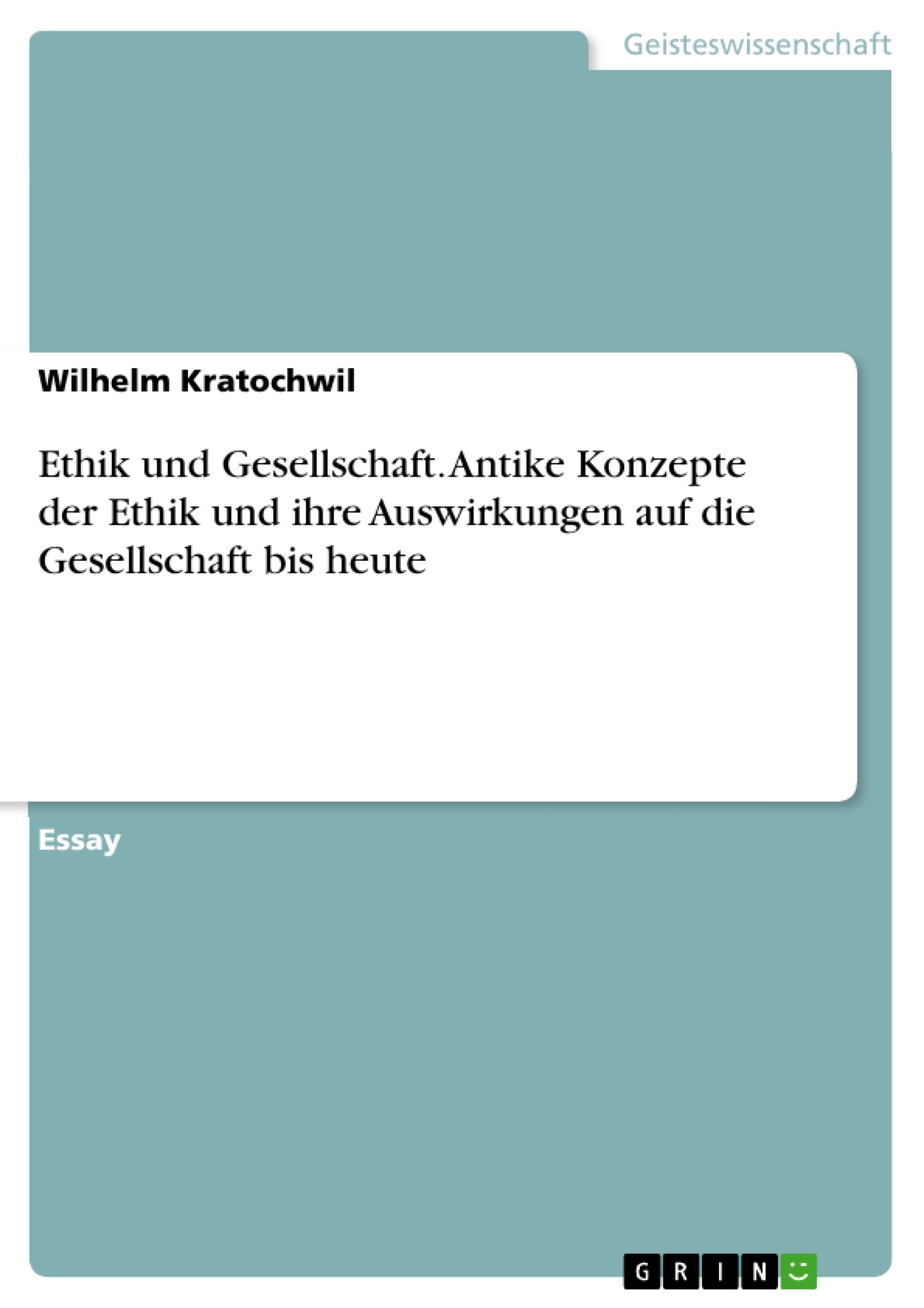Ausgehend von Konzepten der Antike wird versucht, die Ethik begrifflich zu fassen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft bis heute darzustellen.
Eingangs will ich Gedanken aufgreifen, die sich in früheren Zeiten andere dazu gemacht haben. Aristoteles nennt in seiner Ethik als Ziel des Menschen eine vita bona (to eu zen), aber auch den bios theoretikos, um das Glück zu erlangen. Dazu bedarf es des Erwerbs von Verstandes- und Charaktertugenden. Weil auch der Staat zum privaten Glück beitrage, untersucht er verschiedene Arten von Verfassungen. Man könne das Glück nicht erjagen, weiß ein deutsches Volkslied, und die alte Philosophie erklärt auch, warum: das Glück komme auf dem Rücken der Dinge, wenn alles Andere stimme. Auch die Stoiker sahen eine vita bona als erstrebenswert an und erarbeiteten sozusagen eine Kasuistik dafür, die das Christentum weitgehend übernahm. Während die Epikuräer den Lebenszweck im Genuß sahen, predigten Kant und der Calvinismus eine Pflichtethik, die dem Genuß abhold war. Thomas von Aquins „uti, ne frui“ ähnelt diesem Ansatz. So pendelten die Konzepte zwischen Askese und Genuß. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 statuierte, indem sie der Naturrechtsphilosophie folgte, „als unveräußerliches Menschenrecht das Streben nach Glück“; stimmt das aber? Das Streben ja, doch wollte man ein solches Recht verfassungsmäßig garantieren, wäre es als subjektives öffentliches Recht (so lautet die juristische Bezeichnung) dem Staat gegenüber einklagbar. Sollte der Staat dazu die Sozialämter zu Glücksämtern aufblasen?
1. Konzepte der Vergangenheit
Eingangs will ich Gedanken aufgreifen, die sich in früheren Zeiten andere dazu gemacht haben. Ari- stoteles nennt in seiner Ethik als Ziel des Menschen eine vita bona (to eu zen), aber auch den bios theoretikos. um das Glück zu erlangen. Dazu bedarf es des Erwerbs von Verstandes- und Charakter- tugenden. Weil auch der Staat zum privaten Glück beitrage, untersucht er verschiedene Arten von Verfassungen. Man könne das Glück nicht erjagen, weiß ein deutsches Volkslied, und die alte Philo-sophie erklärt auch warum: das Glück komme auf dem Rücken der Dinge, wenn alles Andere stim-me. Auch die Stoiker sahen eine vita bona als erstrebenswert an und erarbeiteten sozusagen eine Ka- suistik dafür, die das Christentum weitgehend übernahm. Während die Epikuräer den Lebenszweck im Genuß sahen, predigten Kant und der Calvinismus eine Pflichtethik, die dem Genuß abhold war. Thomas von Aquins „uti, ne frui“ ähnelt diesem Ansatz. So pendelten die Konzepte zwischen Aske- se und Genuß. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 statuierte, indem sie der Na-turrechtsphilosophie folgte, „als unveräußerliches Menschenrecht das Streben nach Glück“; stimmt das aber? Das Streben ja, doch wollte man ein solches Recht verfassungsmäßig garantieren, wäre es als subjektives öffentliches Recht (so lautet die juristische Bezeichnung) dem Staat gegenüber ein- klagbar. Sollte der Staat dazu die Sozialämter zu Glücksämtern aufblasen?
Der Mensch strebt danach, Lust zu empfinden und Schmerz zu vermeiden. Das hat ihn die Evoluti- on gelehrt. Aber nicht immer ist Lust möglich, in der stets nur die seligen Götter schwelgen können. Nietzsche schrieb im Zarathustra: „Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit“. Faust wollte seine Seele dann verpfänden, wenn er sagen könnte: „Verweile Augenblick, du bist so schön!“ Die Menschen müssen leider auch Schlimmes und Schweres aushalten und hart arbeiten. „Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Sterblichen zuteil.“ (Schiller). Freud hat daher zu Recht vor das Lustprinzip das Realitätsprinzip gesetzt.
Glück und Ethik scheinen theoretisch zusammenzuhängen. Das Grundgesetz der Ethik lautet: „Tue das Gute und meide das Böse.“ Dazu muß man zuerst wissen, was gut und böse ist. Judentum und Christentum erklären Gut und Böse mit der Fabel vom Ungehorsam der ersten Menschen im Para-dies, indem sie vom „verbotenen“ Baum aßen. Gesetzesreligionen mag das genügen, dass Gott ein Gebot gegeben habe, das übertreten wurde. Moses und Hammurapi erklärten ihre Gesetze auch als von einem Gott empfangen, um deren Befolgung zu fördern; die entsprechende Motivation dazu macht(e) zu allen Zeiten Probleme; viele Menschen erstreben ihr Glück unter Verletzung von Nor- men und Ethik. Früher wie heute sollen auch Strafdrohungen die Befolgung von Gesetzen sicher-stellen. Bis heute nennt man ein Gesetz ohne Sanktion eine lex imperfecta. Das Böse muß daher be- straft werden, um das lädierte Recht wiederherzustellen bzw. von seiner Verletzung abzuschrecken. Hin und wieder wird auch eine gute Tat belohnt, so im Märchen und in den Religionen, die Lohn &
Strafe meist ins Jenseits verlagern, um dem Argument auszuweichen, dass es Lumpen oft besser als guten Menschen geht. Der persische Religionsstifter Zarthuscht lehrte gar die Gleichgewichtigkeit der beiden Prinzipien von Gut und Böse. Der Mensch müsse den in ihm vorhandenen Lichtfunken aus der Vermischung mit der als böse angesehenen Materie befreien. Seine Lehre wirkte auf Juden-tum und Christentum. Das letztere verdammte die Lehre des persischen Priesters Mani, den Mani- chäismus, wie später auch den Pelagianismus, als ketzerisch, während der Semipelagianismus prak-tisch geduldet wurde. In seiner Jugend war auch Augustinus Manichäer, was man seiner Erbsünde-lehre anmerkt. Sie irrt wie Paulus über die Folgen des Sündenfalls, weil der Tod nicht durch eine „Ursünde“ der mythischen Stammeltern Adam und Eva in die Welt kam, sondern schon in den Ge-nen begründet liegt: wenn sich die Telomere nach einer bestimmten Zahl von Teilungen durch Ver-kürzung verbraucht haben, sterben die Zellen ab. Das legte der Theologe und Paläowissenschaftler Teilhard de Chardin dar, und erhielt von der katholischen Kirche deshalb Lehrverbot.
Um den Inhalt der Ethik einfach und einprägsam zu definieren, formulierte Rabbi Hillel: „Was Du hassest, dass man Dir tue, das tue auch nicht anderen!“ Ein deutsches Sprichwort schlägt in diesel- be Kerbe: „Was Du nicht willst, dass man Dir tu, das füg‘ auch keinem andern zu.“ Wendet man diese minimalistische Formel für den Einzelfall an, wäre schon sehr viel gewonnen. Kant kritisier- te Hillel dafür, auch ein zum Tod Verurteilter könne dies seinen Richtern entgegenhalten, doch er vergleicht dabei Äpfel mit Birnen: der Straftäter verletzte durch seine primäre Tat das Recht, Rich- ter aber ahnden in einem sekundären Akt die Verletzung des Rechts, und geben diesem sozusagen in einem konträren Akt Genugtuung. Kant dachte da wohl etwas zu kurz. Stattdessen verlangt sein kategorischer Imperativ, das Handeln des Einzelnen müsse Basis für ein allgemeines Gesetz sein können. Hegel und Schopenhauer kritisierten diesen Ansatz, Hoerster wendet dagegen ein, warum „soll“ der kategorische Imperativ überhaupt als legitimes Verfahren zur Ermittlung allgemein aner- kannter Normen akzeptiert werden? Ist z. B. eine Notlüge als ethisch schlecht zu bewerten, wenn man damit in einer Diktatur das Leben eines anderen retten kann? M. Weber und M. Scheler formu-lierten daher eine Verantwortungsethik. Jesus gebot positiv: „Was Ihr wollt, dass Euch die anderen tun, das das tut ihnen zuerst.“ Das ihm in Übereinstimmung mit dem A. T. zugeschriebene Gebot „Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst“ halte ich für nur teilweise realistisch: wichtig ist die Begrenzung des Egoismus, der alle sozialen Beziehungen stört, ebenso wie das Gebot rich- tiger Selbstliebe; denn wer sich selbst nicht mag, kann auch andere Menschen nicht lieben. Ander-erseits ist es unvernünftig, jemanden ohne Rücksicht auf seine Taten zu lieben. Man denke dabei an den Terror und die millionenfachen Morde von Nazis und Sowjetkommunisten, und wer sollte etwa Putin lieben? Seine Exfrau Ludmilla klagte in einem Buch bitter über dieses Scheusal, weil sie ihn genauer als die Putinversteher kannte, die auf seine und Lawrows Lügen und deren Propa-ganda hereinfallen. Durch Angehörige in Rußland und dort gesperrte, aber in Deutschland zugäng-liche websites russischer Blogger bin ich über die unhaltbaren Zustände in Rußland bestens unter- richtet. Nicht ohne Grund bewundert Putin eigener Aussage zufolge Dr. Goebbels, den größten Na- zilügner; denn Wahrheit ist die Erzfeindin der Diktatur. Letzterer hatte in seiner Jugend bei den Je- suiten „gelernt“, und Stalin verbrachte eine gewisse Zeit in einem orthodoxen Priesterseminar, aus dem er wegen revolutionärer Umtriebe entlassen wurde. Lernten beide dort, gekonnt zu lügen?
2. Die Ethik ist zwar eine Zier, doch besser geht es ohne ihr!?
Ethik – jeder ist wohl offiziell dafür, hält sich aber, wenn es um seinen Vorteil geht, lieber etwas zu- rück. Einmal ist keinmal. Der Dalai Lama bekannte einmal freimütig, Ethik sei wichtiger als Religi-on, was unser Dr. Ratzinger (Benedikt XVI.) kaum unterschrieben hätte, wenn auch der Dalai Lama vermutlich Recht hat: Religionen haben Kriege auf der Welt vermehrt statt vermindert, eine wirklich praktizierte Ethik könnte mehr leisten. Die Politik trägt daran die meiste Schuld. Während wir Deut-schen uns über 77 Jahre Frieden freuen können, sieht es in vielen Teilen der Welt leider ganz anders aus: Unterdrückung und Ausbeutung von Völkern, Ermordung von Gegnern, Folter, Krieg, Armut, Hunger, Korruption, Alleinlassen nach Naturkatastrophen usw. Der „homo sapiens“ vergeudet Un-summen für Waffen und Kriege mit ihren Zerstörungen, statt das Elend auf der Welt wirksam zu be-kämpfen. Für Kriege war schon immer genug Geld da, nicht aber für Positives. Lamentieren allein hilft jedoch nicht – steigen wir also in die Ethik selbst ein.
Sie werden vielleicht einwenden: jede Religion lehrt Ethik - aber die Welt ist trotzdem schlecht ge- blieben wie seit eh und je. Warum nur? Manche Menschen entscheiden sich eben für die linke Tour, statt den beschwerlicheren „rechten Weg“ zu nehmen. Das wird sich auch trotz einer evtl. erneuer-ten Ethik nicht ändern, und weder autoritäre Herrschaft noch die Drohung der Religion mit Höllen- strafen konnten dies verhindern. Teils sind die Religionen selbst schuld, weil sie Glaube und Loya- lität höher stellen als ihre eigenen ethischen Gebote (siehe den israelitischen Genozid an den Ama- lekitern, christliche Verbrennung von Ketzern und islamistische Grausamkeiten). Das Christentum lehrte einen ganz anderen Weg, betätigte sich aber oft nur als Wegweiser, der den gezeigten Weg nicht mitging. Sogar die Gesetzgebung unter Blitz und Donner am Sinai, die Höllendrohungen in Christentum und Islam, sowie harte Sanktionen machten die Welt nicht besser. Woran liegt das?
3. Warum verhalten sich Menschen unethisch?
Ein häufiger Grund ist einfach Schwäche: der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, sagt das N.T.
Aber es gibt auch viele Gründe für eine absichtliche Verletzung der Regeln für das Zusammenleben der Menschen; warum soll man sich anstrengen, wenn es auch anders geht: mit Diebstahl, Betrug, Nichterfüllung von Verpflichtungen, Intrigieren, Raub und anderen Gewaltverbrechen, in der Politik mit Drohungen und Krieg. Intriganten streicheln ihr mangelndes Selbstwertgefühl, indem sie andere ausschmieren, und viele lassen den Frust über ihre eigene Unfähigkeit an anderen aus, oder zerstö- ren einfach. Mephisto formulierte diesen Negativismus so: „...denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrundegeht.“ Wenn die Kultur fehlt, schlägt das ererbte aggressive Reptiliengehirn durch, von dem Konrad Lorenz sprach. Weil die Gegenwart oft als belastend empfunden wird, sind die Sagen von der „guten alten Zeit“ entstanden: aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo sponte sua sine lege fidem rectumque colebat. Andersherum predigen die Religionen die Ankunft eines Saoschyant oder Messias in der Zukunft, der es sozusagen richten wird. Aber beide Sagen versäumen es, vor al- lem darauf hinzuweisen, dass wir in der Gegenwart leben, und nur jetzt auf das Leben Einfluß neh- men können. Die Vergangenheit ist ein Eimer voller Asche, und die Zukunft können wir noch nicht gestalten. Also wie sollen wir jetzt leben? Die theoretischen Grundlagen der Religionen wurden im Lauf der Zeit als brüchig, oft als unwahr erkannt. Ihr Handeln entspricht leider all zu oft weltlicher Herrschaft anstatt ihrem eigentlichen Ziel. Oder welchen Sinn hat es, eine junge Studentin, die das Kopftuch angeblich falsch trug, von sogenannten Tugendwächtern so zurichten zu lassen, dass sie stirbt? Der Prophet hat im Koran weder Kopftuch noch Shador angeordnet! Der weltliche Staat hat Minimalregularien für ein geordnetes Zusammenleben der Menschen zu erlassen und notfalls mit Gewalt durchzusetzen, Ethik und Gesinnung kann man aber nicht per Gesetz anordnen. Diese bei- den kann man den Menschen nur mit Überzeugungskraft vermitteln. Die meisten sind ja gutwillig und bereit, anständig zu leben. Daher sollte Ethik an allen allgemeinbildenden Schulen als Pflicht-fach unterrichtet werden. Religionsunterricht können Kirchen als verfassungsrechtlich geschützte Privatangelegenheit erteilen.
In Biographien von Verbrechern kann man lesen, dass sie als Kinder oft geprügelt wurden, so auch Hitler und Putin. Später revanchierten sie sich an den Menschen mit ihren Untaten. Hitler übertrug seinen Haß auf „die Juden“ (wohl ohne die 345.000, die sich freikaufen konnten) und Putin auf die Ukraine, die als freie Demokratie seiner Geschichtsklitterung und seinen Machtansprüchen wider- stand. Umgekehrt gibt eine Familie, in der ein fröhlicher Ton und konstruktives Verhalten vorherr-schen, den Kindern die besten Voraussetzungen für ihr späteres Leben mit. Ethik, richtiges Verhal- ten müssen eben eingeübt werden, denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Als Er-wachsene wenden sie diese Routinen auch in ihren künftigen Familien an, wie es negativ gepolte Menschen mit den ihren tun, weil sie sie für richtig halten. Die renommierte US Familientherapeu- tin Virginia Satir wies auf diesen Zusammenhang hin. In meinem Buch „DU bist schuld“ (GRIN-Verlag München) stelle ich ihre Erkenntnisse dar und referiere ausführlich über Fremd- und Selbst-erziehung. Eingehend behandle ich das bisher ungelöste gesellschaftliche Problem der zahlreichen Scheidungen, und gebe Hilfen dafür an die Hand.
In den allgemeinbildenden Schulen wird viel herkömmliches Wissen transportiert, das interessant, aber nicht notwendig ist. Wem hilft es auch nur irgendetwas, zu wissen, wer wann über wen in der Schlacht bei Issos gesiegt hat? Aber Konfliktmanagement, praktische Psychologie, Erziehungsleh- re, Grundlagen des Wirtschaftslebens sucht man gewöhnlich vergeblich in den Lehrplänen. Ich hat- te Latein, Altgriechisch und Englisch als Pflichtfächer – aber genügt das für eine Europäische Ge- meinschaft? Ich lernte noch Italienisch und etwas Französisch dazu, aber keine slawische Sprache.
Wie schlecht es ist, keine Fremdsprachen zu beherrschen, sieht man an Russen, die im Ausland un- selbständig wie Kinder auftreten, wenn sie sich nicht verständlich machen können. Was sollen die ewigen Schlachten im Geschichtsunterricht? Dieses Unterfangen läßt den Staat und seine Protago-nisten als über dem Individuum stehend erleben, statt daß der Staat den Menschen und seine Rech- te an den Anfang der Verfassung stellt wie unser Grundgesetz. Kulturgeschichte, anstatt Verherrli- chung von Schlachten mit ihren Siegern und Verlierern, statt Gebietsgewinnen und -verlusten ist geboten. Das falsche Denken Putins in Kategorien des 19 Jahrhunderts zerstört die Ukraine und die Wirtschaft Rußlands. Mussolinis Streben nach dem „mare nostro“ ebenso wie Hitlers NS-Her- renmenschenphantasien kosteten 50 Millionen Menschen das Leben. Die Völker wollen das nicht wirklich, nur die Politiker hetzen sie zu solch hirnrissigem Treiben auf, ja zwingen sie dazu. Krieg ist die dümmste Erfindung des sogenannten homo sapiens. Ich habe noch den 2. Weltkrieg mit sei- nen Folgen erlebt, andere „kennen“ seine schreckliche Wirklichkeit nur oberflächlich aus Büchern und Filmen; laut Pädagogik kann man Erfahrungen nur machen, aber leider nicht übertragen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind einige der in "Konzepte der Vergangenheit" diskutierten philosophischen Konzepte des Glücks und der Ethik?
Der Text erörtert verschiedene philosophische Ansätze zum Glück, von Aristoteles' vita bona und bios theoretikos über die stoische Vorstellung eines erstrebenswerten Lebens bis hin zu Kants Pflichtethik und dem utilitaristischen Streben nach Lust. Er hinterfragt auch die Idee, dass das Streben nach Glück ein unveräußerliches Menschenrecht sei.
Wie wird das Verhältnis von Lust und Realität im Text dargestellt?
Der Text stellt fest, dass der Mensch zwar nach Lust strebt, aber auch Schmerz und Schwierigkeiten aushalten muss. Freud wird erwähnt, um das Realitätsprinzip über das Lustprinzip zu stellen, was darauf hindeutet, dass das Leben nicht nur aus Vergnügen besteht.
Wie wird die Ethik im Zusammenhang mit Gut und Böse definiert?
Der Text definiert Ethik als das Gebot, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Er untersucht die religiösen Erklärungen von Gut und Böse anhand der Fabel vom Ungehorsam im Paradies und diskutiert die Herausforderungen bei der Durchsetzung ethischen Verhaltens durch Gesetze und Strafen.
Welche alternativen ethischen Formulierungen werden im Text präsentiert?
Der Text stellt Hillels goldene Regel ("Was Du hassest, dass man Dir tue, das tue auch nicht anderen!") und Kants kategorischen Imperativ vor. Er erwähnt auch die Kritik an diesen Konzepten und die Formulierung einer Verantwortungsethik durch M. Weber und M. Scheler.
Welche Kritik wird an Religionen in Bezug auf Ethik geübt?
Der Text argumentiert, dass Religionen Kriege eher gefördert als verhindert haben und dass eine praktizierte Ethik mehr erreichen könnte. Es wird behauptet, dass Religionen oft Glaube und Loyalität über ihre eigenen ethischen Gebote stellen.
Was sind einige der Gründe, warum sich Menschen unethisch verhalten?
Der Text nennt Schwäche, Bequemlichkeit, mangelndes Selbstwertgefühl, Frustration und das Durchschlagen des ererbten aggressiven Reptiliengehirns als Gründe für unethisches Verhalten. Es wird auch auf den Einfluss von Kindheitserfahrungen, insbesondere Gewalt, hingewiesen.
Welche Vorschläge werden zur Verbesserung der ethischen Bildung gemacht?
Der Text schlägt vor, Ethik als Pflichtfach an allen allgemeinbildenden Schulen zu unterrichten. Es wird argumentiert, dass Konfliktmanagement, praktische Psychologie, Erziehungslehre und Grundlagen des Wirtschaftslebens in den Lehrplänen fehlen. Die Bedeutung des Erlernens von Fremdsprachen wird ebenfalls betont.
Welche Kritik wird an herkömmlichen Bildungsinhalten geübt?
Der Text kritisiert, dass im herkömmlichen Geschichtsunterricht Schlachten und Gebietsgewinne/-verluste zu stark betont werden, anstatt Kulturgeschichte und die Rechte des Einzelnen in den Vordergrund zu stellen.
- Citar trabajo
- Wilhelm Kratochwil (Autor), 2022, Ethik und Gesellschaft. Antike Konzepte der Ethik und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft bis heute, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1359109