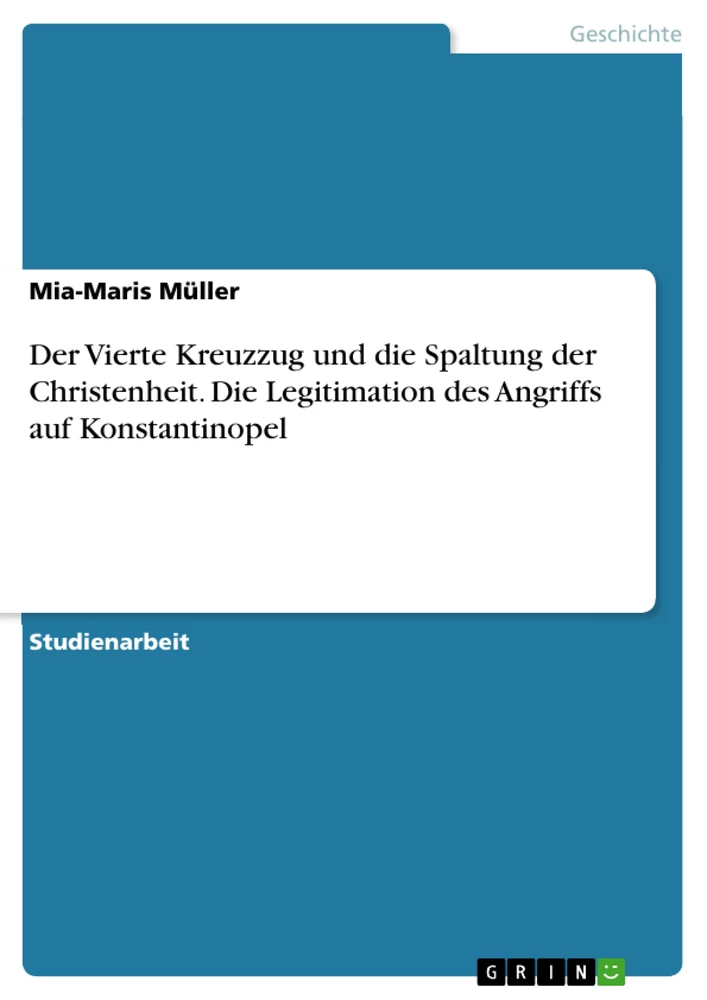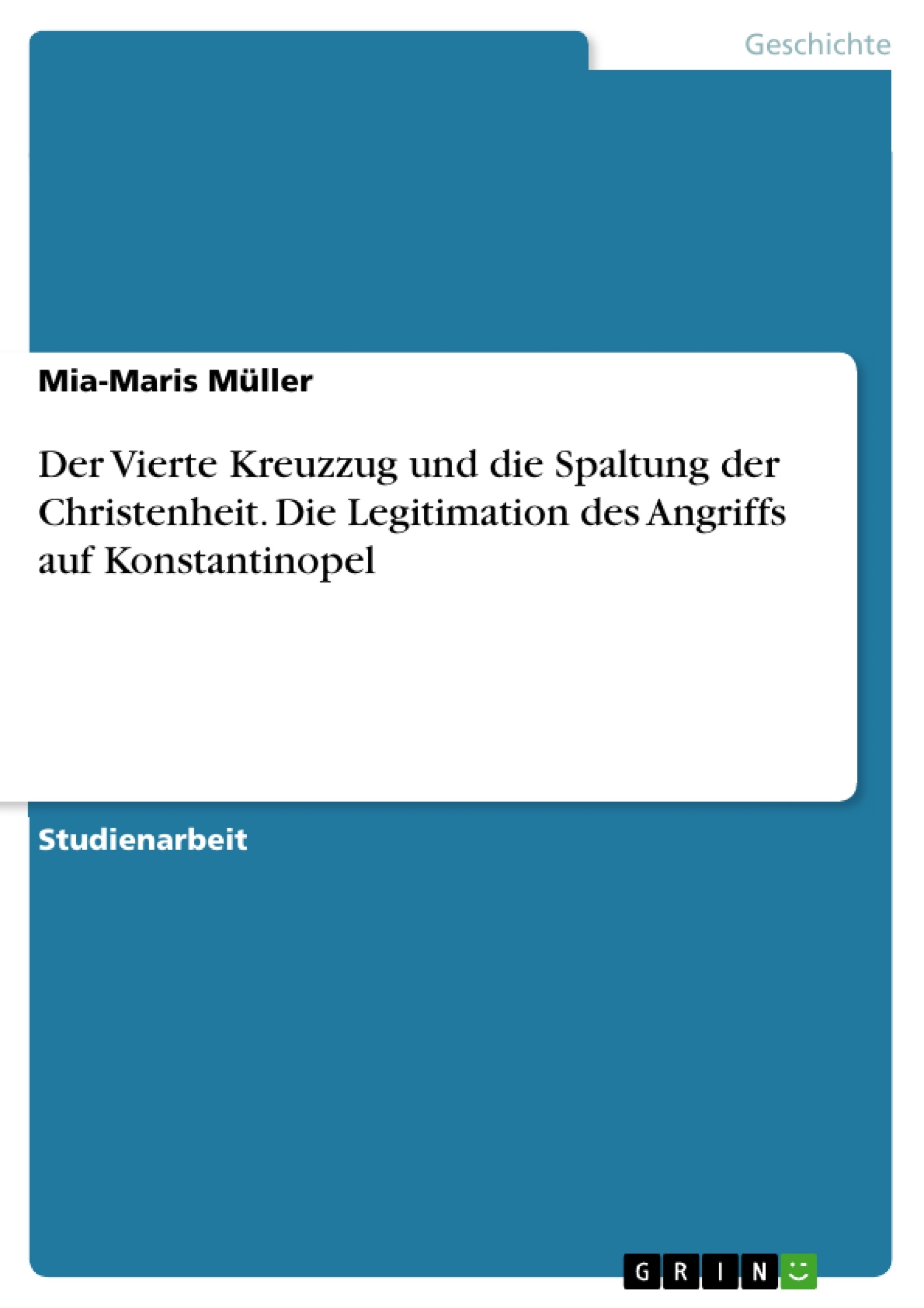Der vierte Kreuzzug besiegelte die Spaltung von orthodoxer und katholischer Kirche. Das christliche Heer griff im Jahr 1204 Konstantinopel an, plünderte es und zerteilte das Byzantinische Kaiserreich trotz des päpstlichen Verbotes Christen, auch orthodoxe, anzugreifen. Dieser Tabubruch widersprach den religiösen Motiven der Kreuzfahrer:innen, woraus sich die Frage ableitet: Wie legitimierten die Kreuzfahrer:innen den Angriff auf Christen im Vierten Kreuzzug?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage und Forschungsstand
- Aufbau der vorliegenden Arbeit
- Die Vorboten des Vierten Kreuzzugs
- Beziehungen zwischen Ost und West
- Ausruf und Vorbereitung
- Wendung gegen Zara
- Rechtfertigung des Tabubruchs
- Vertrag mit Alexios IV.
- Angriff auf Konstantinopel
- Byzantinischer Vertragsbruch
- Legitimation der Plünderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Legitimation des Angriffs auf Konstantinopel im Vierten Kreuzzug. Sie beleuchtet die Frage, wie die Kreuzfahrer:innen den Angriff auf Christen im Jahre 1204 rechtfertigten, obwohl dieser einem religiösen Tabu widersprach. Die Arbeit analysiert verschiedene Quellen, die die Ereignisse des Kreuzzugs aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.
- Rechtfertigung des Tabubruchs durch die Kreuzfahrer:innen
- Die Rolle von Religion und Politik im Vierten Kreuzzug
- Die Bedeutung von Quellen und deren unterschiedliche Perspektiven
- Die Legitimationsstrategien von Robert de Clari und Gunther von Pairis
- Der Einfluss von Venedig auf die Ereignisse des Vierten Kreuzzugs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Quellenlage und den Forschungsstand zum Vierten Kreuzzug vor. Sie präsentiert die wichtigsten Quellen, darunter die Chroniken von Robert de Clari und Gunther von Pairis, und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationsansätze im Forschungsdiskurs. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Ansätze zur Legitimation des Tabubruchs, die von den Kreuzfahrern genutzt wurden. Es wird die Frage untersucht, wie die Kreuzfahrer:innen den Angriff auf Konstantinopel als gerechtfertigt darstellten.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Vorboten des Vierten Kreuzzugs. Es untersucht die Beziehungen zwischen Ost und West vor dem Hintergrund der politischen und religiösen Spannungen der Zeit. Das Kapitel beschreibt die Vorgeschichte des Kreuzzugs, die zur Wende gegen Zara und schließlich zur Eroberung Konstantinopels führte.
Das dritte Kapitel analysiert die Wendung des Kreuzzugs gegen Zara. Es untersucht die Rechtfertigung des Tabubruchs, also den Angriff auf Christen, und beleuchtet die Rolle von Venedig in dieser Entwicklung. Das Kapitel analysiert den Vertrag zwischen den Kreuzfahrern und Alexios IV., der die Eroberung Konstantinopels schließlich ermöglichte.
Das vierte Kapitel beleuchtet den Angriff auf Konstantinopel und die Legitimation der Plünderung. Es analysiert die angeblichen Vertragsbrüche der Byzantiner:innen, die von den Kreuzfahrern als Rechtfertigung für den Angriff herangezogen wurden. Das Kapitel untersucht die verschiedenen Legitimationsstrategien, die von den Kreuzfahrern eingesetzt wurden, um die Gewalt und Plünderung der Stadt zu rechtfertigen.
Schlüsselwörter
Vierte Kreuzzug, Byzantinisches Reich, Konstantinopel, Tabubruch, Legitimation, Quellenanalyse, Robert de Clari, Gunther von Pairis, Intrigentheorie, Zufallstheorie, Venedig, Alexios IV.
- Citation du texte
- Mia-Maris Müller (Auteur), 2023, Der Vierte Kreuzzug und die Spaltung der Christenheit. Die Legitimation des Angriffs auf Konstantinopel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1360056