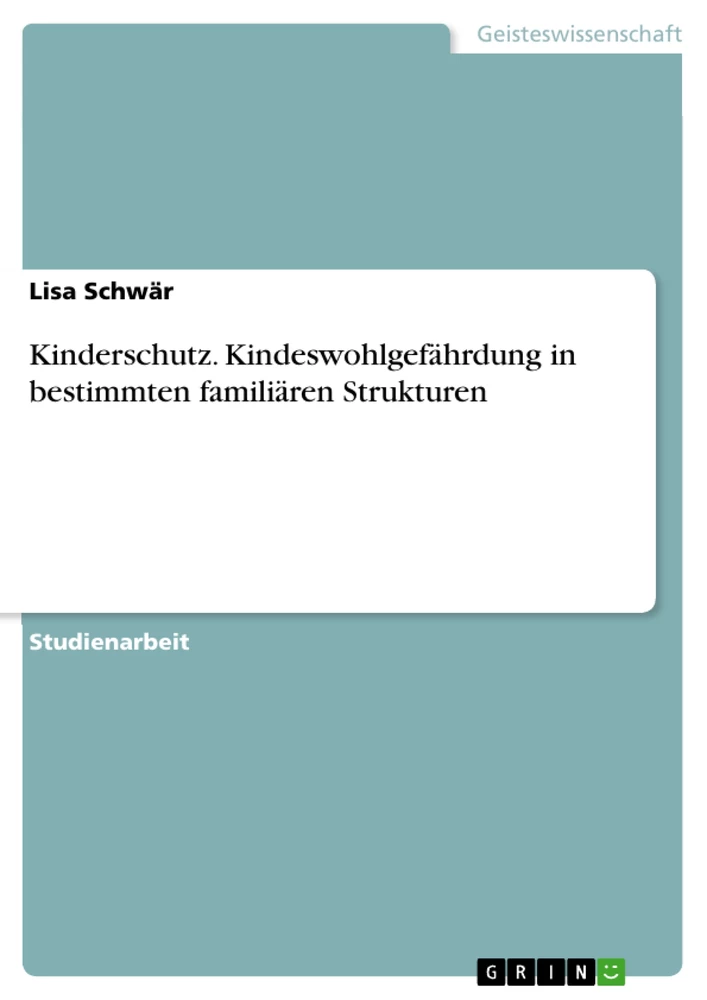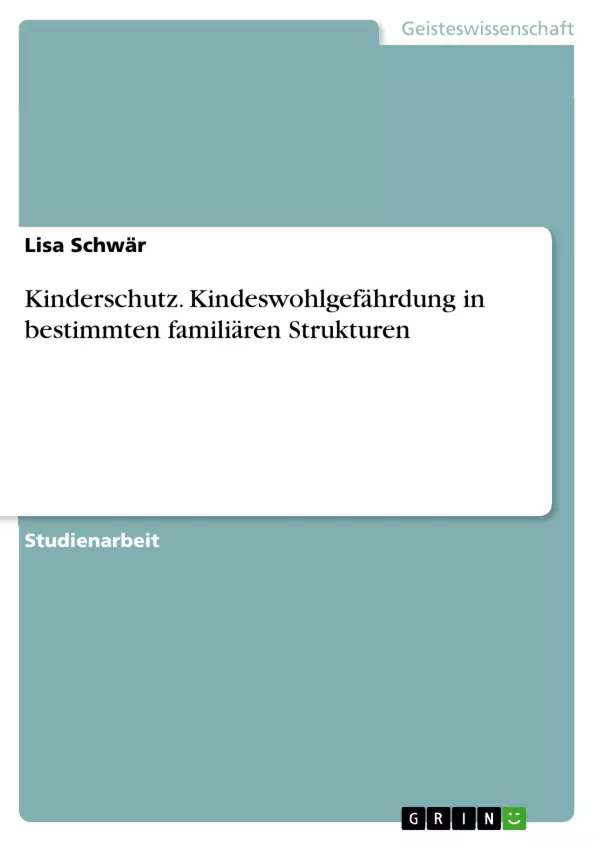Ziel der Arbeit ist, den Unterschied zwischen Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung darzustellen und dabei den Fokus auf die Kindeswohlgefährdung zu legen. Was hat sich signifikant in der familiären Struktur geändert, sodass Gewalt in der Familie und verschiedene Formen der Kindermisshandlung häufiger auftreten? Was sind Risikofaktoren und was genau stellen Belastungen für die heutigen Familien dar?
Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts haben die Jugendämter und Behörden im Jahr 2020 bei fast 60.600 Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung feststellen können, rund 9% oder 5000 Fälle mehr als im vorherigen Jahr 2019. Dies verzeichnet den aktuellen Höchststand seit der Einführung der Statistik 2012. Grund dafür ist das Corona-Jahr 2020, mit gravierenden Belastungen der Familien, Lockdown und Kontaktbeschränkungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begriffsdefinitionen
- 1.2 Aufbau der Seminararbeit
- 2. Kindeswohl
- 2.1 Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
- 2.2 Aktuelle Rechtsgrundlage
- 3. Kindeswohlgefährdung
- 3.1 Formen der Kindeswohlgefährdungen
- 3.2 Wandel der familiären Strukturen
- 3.3 Risikofaktoren und Belastungen in der Familie
- 3.4 Gewalt in der Familie
- 4. Hilfs- und Unterstützungsangebote
- 4.1 Schutzfaktoren
- 4.2 Schutzauftrag
- 4.3 Einschränkung des Elternrechts
- 4.4 Frühe Hilfen
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Kindeswohlgefährdung und ihre Auftretenskontexte. Ziel ist es, den Unterschied zwischen Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung zu verdeutlichen und die Faktoren zu analysieren, die zu einem erhöhten Risiko für Kindeswohlgefährdung beitragen. Der Fokus liegt dabei auf dem Wandel familiärer Strukturen und den damit verbundenen Herausforderungen.
- Definition und Abgrenzung von Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung
- Analyse des Wandels familiärer Strukturen und deren Einfluss auf Kindeswohlgefährdung
- Identifizierung von Risikofaktoren und Belastungen für Familien
- Untersuchung von Gewalt in Familien als Form der Kindeswohlgefährdung
- Beschreibung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kindeswohlgefährdung ein und benennt die steigenden Fallzahlen laut Statistischem Bundesamt. Sie definiert die Fragestellung der Arbeit und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Unterschieds zwischen Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung sowie der Analyse der Faktoren, die zu einem erhöhten Risiko für Kindeswohlgefährdung führen.
2. Kindeswohl: Dieses Kapitel beleuchtet das Kindeswohl, definiert den Begriff und beschreibt die Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Es wird auf die aktuelle Rechtslage eingegangen, die den Rahmen für den Schutz des Kindeswohls vorgibt. Die Darstellung der Grundbedürfnisse dient als Grundlage für das Verständnis von Kindeswohlgefährdung im darauf folgenden Kapitel.
3. Kindeswohlgefährdung: Dieses zentrale Kapitel behandelt verschiedene Formen der Kindeswohlgefährdung, analysiert den Wandel familiärer Strukturen und die damit verbundenen Herausforderungen für das Kindeswohl. Es werden Risikofaktoren und Belastungen in Familien identifiziert und die Problematik von Gewalt in Familien ausführlich untersucht. Der Bezug zu den im vorherigen Kapitel dargestellten Grundbedürfnissen wird hergestellt, um die Gefährdung des Kindeswohls im konkreten Kontext zu veranschaulichen.
4. Hilfs- und Unterstützungsangebote: Das Kapitel beschreibt verschiedene Hilfs- und Unterstützungsangebote für Familien, in denen das Kindeswohl gefährdet ist. Es werden Schutzfaktoren, der Schutzauftrag, die Einschränkung des Elternrechts und Frühe Hilfen detailliert erläutert. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten der Intervention und Prävention von Kindeswohlgefährdung.
Schlüsselwörter
Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, Familienstrukturen, Risikofaktoren, Gewalt, Hilfsangebote, Schutzfaktoren, Jugendamt, Rechtsgrundlagen, Grundbedürfnisse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Kindeswohlgefährdung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Kindeswohlgefährdung. Sie beinhaltet eine Einleitung mit Begriffsdefinitionen, ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht Kindeswohlgefährdung und ihre Kontexte, analysiert den Unterschied zwischen Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung und die Faktoren, die zu einem erhöhten Risiko beitragen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Wandel familiärer Strukturen und den damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Kernbereiche: Definition und Abgrenzung von Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung; Analyse des Wandels familiärer Strukturen und deren Einfluss; Identifizierung von Risikofaktoren und Belastungen für Familien; Untersuchung von Gewalt in Familien als Form der Kindeswohlgefährdung; Beschreibung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten (Schutzfaktoren, Schutzauftrag, Einschränkung des Elternrechts, Frühe Hilfen); Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen; aktuelle Rechtsgrundlagen zum Kindeswohl.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und definiert die Fragestellung. Kapitel 2 (Kindeswohl) beleuchtet das Kindeswohl und die Grundbedürfnisse von Kindern. Kapitel 3 (Kindeswohlgefährdung) analysiert verschiedene Formen der Gefährdung, den Wandel familiärer Strukturen, Risikofaktoren und Gewalt in Familien. Kapitel 4 (Hilfs- und Unterstützungsangebote) beschreibt verschiedene Hilfsangebote und Interventionen. Kapitel 5 (Resümee) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, Familienstrukturen, Risikofaktoren, Gewalt, Hilfsangebote, Schutzfaktoren, Jugendamt, Rechtsgrundlagen, Grundbedürfnisse.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel ist es, den Unterschied zwischen Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung zu verdeutlichen und die Faktoren zu analysieren, die zu einem erhöhten Risiko für Kindeswohlgefährdung beitragen. Der Fokus liegt auf dem Wandel familiärer Strukturen und den damit verbundenen Herausforderungen. Die Arbeit soll ein Verständnis für die Problematik und die vorhandenen Hilfsangebote schaffen.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung jedes Kapitels bietet einen kurzen Überblick über den Inhalt und die zentralen Aussagen. So wird die Einleitung mit der Definition des Problems und dem Aufbau der Arbeit erläutert. Kapitel 2 und 3 befassen sich mit dem Kindeswohl und der Kindeswohlgefährdung, Kapitel 4 beschreibt die Hilfsangebote und das Resümee fasst die Ergebnisse zusammen.
- Quote paper
- Lisa Schwär (Author), 2022, Kinderschutz. Kindeswohlgefährdung in bestimmten familiären Strukturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1360100