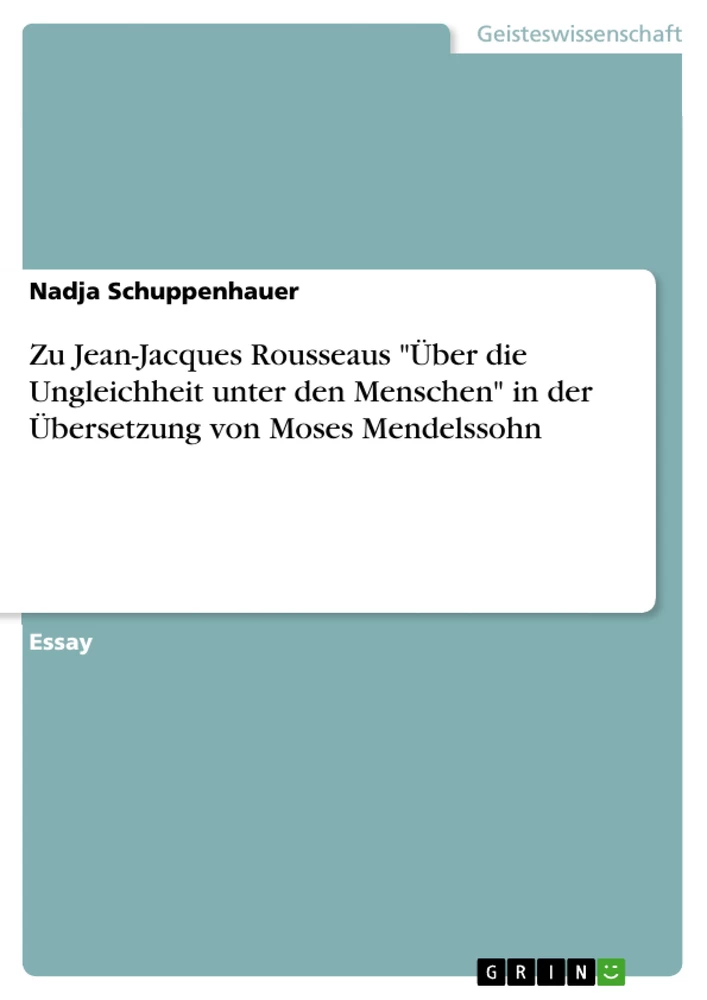Jean-Jacques Rousseau (geboren 1712 in Genf; gestorben 1778 bei Paris) gilt als einer der
einflussreichsten Philosophen und Schriftsteller der europäischen Aufklärung und als
entscheidender Wegbereiter der französischen Revolution.
Rousseaus 1755 in Amsterdam veröffentlichte „Abhandlung von dem Ursprunge der
Ungleichheit unter den Menschen, und worauf sie sich gründe“1 (discours sur l’origine et les
fondements de l’inégalité parmi les hommes) war seine Beantwortung der von der Akademie
zu Dijon im Jahr 1753 gestellten Preisfrage nach den Gründen der Ungleichheit unter den
Menschen und ob diese im natürlichen Gesetz gegründet sei. Der Diskurs ist eine sehr
vielschichtige Arbeit, die verschiedene Themenkomplexe berührt. So wird sein Werk u. a. als
erster Beitrag der Aufklärung zur Anthropologie betrachtet2, was nicht zuletzt den
geschichtsphilosophischen Ansatz der Abhandlung bestätigt. Daneben stellt Rousseau
Überlegungen zum Ursprung der Sprache an und diskutiert antike und moderne
Naturrechtskonzeptionen, „vor allem die politischen Ideen von Hobbes, Pufendorf und Locke,
die [...] eingehend geprüft und schließlich verworfen werden“3. Im Zentrum seiner Arbeit
steht jedoch eine massive Gesellschaftskritik4, die seine im ersten und preisgekrönten
„Diskurs über die Künste und Wissenschaften“ (discours sur les sciences et les arts; 1750)
entworfenen Gedanken und Argumente aufnimmt, erweitert und detailliert ausarbeitet.
Bereits im Folgejahr seines Erscheinens übersetzte der deutsch-jüdische und in Berlin
ansässige Philosoph Moses Mendelssohn (geboren 1729 in Dessau; gestorben 1786 in Berlin)
– auf die Bitte seines Freundes Gotthold Ephraim Lessing hin – Rousseaus Zweiten Diskurs,
der auch in Deutschland eine starke Rezeption erfuhr, ins Deutsche. Die Übersetzung erschien
1756 anonym in Berlin und wurde von Mendelssohn um das „Sendschreiben an den Herrn
Magister Leßing in Leipzig“ nebst einer Nachschrift und um die Übersetzung von Voltaires
polemischem Kommentar zu Rousseaus Arbeit erweitert. Mendelssohn setzte sich in seinem
Sendschreiben und der dazugehörigen Nachschrift kritisch mit den Überlegungen und
Argumenten Rousseaus auseinander und legte darin seine eigenen Anschauungen über die
menschliche Gesellschaft und den Menschen überhaupt dar, die teilweise denjenigen
Rousseaus diametral entgegenstehen.
[...]
Einleitung
Jean-Jacques Rousseau (geboren 1712 in Genf; gestorben 1778 bei Paris) gilt als einer der einflussreichsten Philosophen und Schriftsteller der europäischen Aufklärung und als entscheidender Wegbereiter der französischen Revolution.
Rousseaus 1755 in Amsterdam veröffentlichte „Abhandlung von dem Ursprunge der Ungleichheit unter den Menschen, und worauf sie sich gründe“[1] (discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes) war seine Beantwortung der von der Akademie zu Dijon im Jahr 1753 gestellten Preisfrage nach den Gründen der Ungleichheit unter den Menschen und ob diese im natürlichen Gesetz gegründet sei. Der Diskurs ist eine sehr vielschichtige Arbeit, die verschiedene Themenkomplexe berührt. So wird sein Werk u. a. als erster Beitrag der Aufklärung zur Anthropologie betrachtet[2], was nicht zuletzt den geschichtsphilosophischen Ansatz der Abhandlung bestätigt. Daneben stellt Rousseau Überlegungen zum Ursprung der Sprache an und diskutiert antike und moderne Naturrechtskonzeptionen, „vor allem die politischen Ideen von Hobbes, Pufendorf und Locke, die [...] eingehend geprüft und schließlich verworfen werden“[3]. Im Zentrum seiner Arbeit steht jedoch eine massive Gesellschaftskritik[4], die seine im ersten und preisgekrönten „Diskurs über die Künste und Wissenschaften“ (discours sur les sciences et les arts; 1750) entworfenen Gedanken und Argumente aufnimmt, erweitert und detailliert ausarbeitet.
Bereits im Folgejahr seines Erscheinens übersetzte der deutsch-jüdische und in Berlin ansässige Philosoph Moses Mendelssohn (geboren 1729 in Dessau; gestorben 1786 in Berlin) – auf die Bitte seines Freundes Gotthold Ephraim Lessing hin – Rousseaus Zweiten Diskurs, der auch in Deutschland eine starke Rezeption erfuhr, ins Deutsche. Die Übersetzung erschien 1756 anonym in Berlin und wurde von Mendelssohn um das „Sendschreiben an den Herrn Magister Leßing in Leipzig“ nebst einer Nachschrift und um die Übersetzung von Voltaires polemischem Kommentar zu Rousseaus Arbeit erweitert. Mendelssohn setzte sich in seinem Sendschreiben und der dazugehörigen Nachschrift kritisch mit den Überlegungen und Argumenten Rousseaus auseinander und legte darin seine eigenen Anschauungen über die menschliche Gesellschaft und den Menschen überhaupt dar, die teilweise denjenigen Rousseaus diametral entgegenstehen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Bild, das Rousseau von der menschlichen Gesellschaft zeichnet und mit der kritischen Auseinandersetzung Mendelssohns mit eben diesem Gesellschaftsbild. Dazu sollen Rousseaus Grund- und Hauptgedanken zum Prozess und den Auswirkungen der menschlichen Vergesellschaftung betrachtet werden, um anschließend die Kommentare und Gegenargumente Mendelssohns zu diesem Konzept mit ihnen zu kontrastieren.
Hauptgedanken der Abhandlung von der Ungleichheit
Entgegen der gängigen Meinung seiner Zeitgenossen sieht Rousseau in der Gegenwart nicht den vielgepriesenen Ideal- und Endzustand der Gesellschaft, sondern kritisiert – ganz im Gegenteil – letztere vielmehr als einen Hort der „Gewaltthätigkeit der Mächtigen und [der] Unterdrückung der Schwächern“[5]. Dass er mit seinen Ausführungen ganz nebenbei auch den unter den Aufklärern herrschenden Fortschrittsgedanken und Kulturoptimismus erledigt[6], sich also der zu seiner Zeit weitverbreiteten teleologischen Auffassung von Geschichte entgegen stellt, kann hier nur am Rande erwähnt sein.
Der Hauptteil von Rousseaus Diskurs ist in zwei Abschnitte gegliedert; der erste beschäftigt sich primär mit der Konstruktion eines – fiktiven – „Naturmenschen“, während im zweiten Abschnitt der Versuch unternommen wird, den Ausgang des Menschen aus seinem „Naturzustand“ nachzuzeichnen und zu erklären, wie es zur Vergesellschaftung kam, wie die Geschichte der Menschheit ihren Anfang nahm, um so die Entstehung der gesellschaftlichen Ungleichheit zurückzuverfolgen. Die Betonung liegt hierbei auf dem Attribut des „gesellschaftlichen“, da Rousseau gleich zu Beginn des Hauptteils seiner Arbeit einräumt, dass es zwischen den Menschen selbstverständlich immer Ungleichheit gegeben habe, diese sich jedoch auf natürliche, physische Ursachen beschränke und die in „der Verschiedenheit des Alters, der Gesundheit, der körperlichen Stärke, und der Seelenkräfte“[7] bestehe und auf die sich die gesellschaftliche nicht zurückführen ließe.
[...]
[1] So die Übersetzung von Moses Mendelssohn; in der neueren Literatur wird im Zusammenhang mit dieser Abhandlung häufig auch vom „Diskurs über die Ungleichheit“ oder einfach vom „Zweiten Diskurs“ gesprochen.
[2] So Claude Lévi-Straus: vgl. Wokler, Robert: Rousseau, Freiburg im Breisgau 1999, S. 54.
[3] Wokler: Rousseau, (wie Anm. 2) S. 54.
[4] Vgl. Müller-Weil, Ulrike: Rousseau als Geschichtsphilosoph, in: Archiv für Kulturgeschichte, Bd. 83, Köln/Weimar/Wien 2001, S. 145-169, hier S. 147.
[5] Rousseau, Jean-Jacques: Abhandlung von dem Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen. Aus dem Französischem von Moses Mendelssohn, hg. von: Goldenbaum, Ursula, Weimar 2000, S. 91.
[6] Vgl. Müller-Weil: Rousseau als Geschichtsphilosoph, (wie Anm. 4) S. 149.
[7] Rousseau: Abhandlung, (wie Anm. 5) S. 97.
Häufig gestellte Fragen
Wer übersetzte Rousseaus „Zweiten Diskurs“ ins Deutsche?
Der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn übersetzte das Werk im Jahr 1756 auf Bitte seines Freundes Gotthold Ephraim Lessing.
Was ist das zentrale Thema von Rousseaus Abhandlung über die Ungleichheit?
Im Zentrum steht eine massive Gesellschaftskritik, die den Ursprung der sozialen Ungleichheit und die Abkehr des Menschen von seinem Naturzustand untersucht.
Welche Rolle spielt der „Naturzustand“ in Rousseaus Werk?
Rousseau konstruiert einen fiktiven Naturmenschen, um zu erklären, wie die Vergesellschaftung zur Entstehung von Ungleichheit und Unterdrückung führte.
Wie unterschied sich Moses Mendelssohns Position von der Rousseaus?
Mendelssohn setzte sich in einem Sendschreiben kritisch mit Rousseau auseinander und vertrat Ansichten über die menschliche Gesellschaft, die Rousseaus Thesen teilweise diametral entgegenstanden.
Welche philosophischen Konzepte verwirft Rousseau in seinem Diskurs?
Rousseau prüfte und verwarf insbesondere die politischen Ideen und Naturrechtskonzeptionen von Hobbes, Pufendorf und Locke.
Welche Arten der Ungleichheit unterscheidet Rousseau?
Er unterscheidet zwischen natürlicher (physischer) Ungleichheit, wie Alter und Gesundheit, und gesellschaftlicher Ungleichheit, die auf Konventionen beruht.
- Citation du texte
- Nadja Schuppenhauer (Auteur), 2007, Zu Jean-Jacques Rousseaus "Über die Ungleichheit unter den Menschen" in der Übersetzung von Moses Mendelssohn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136088