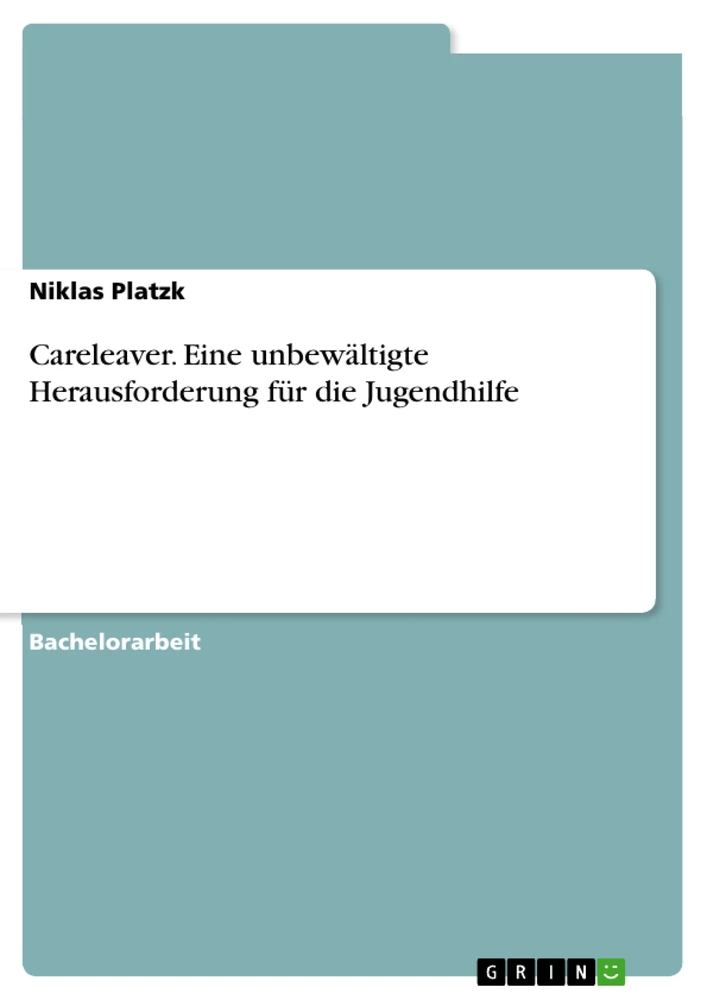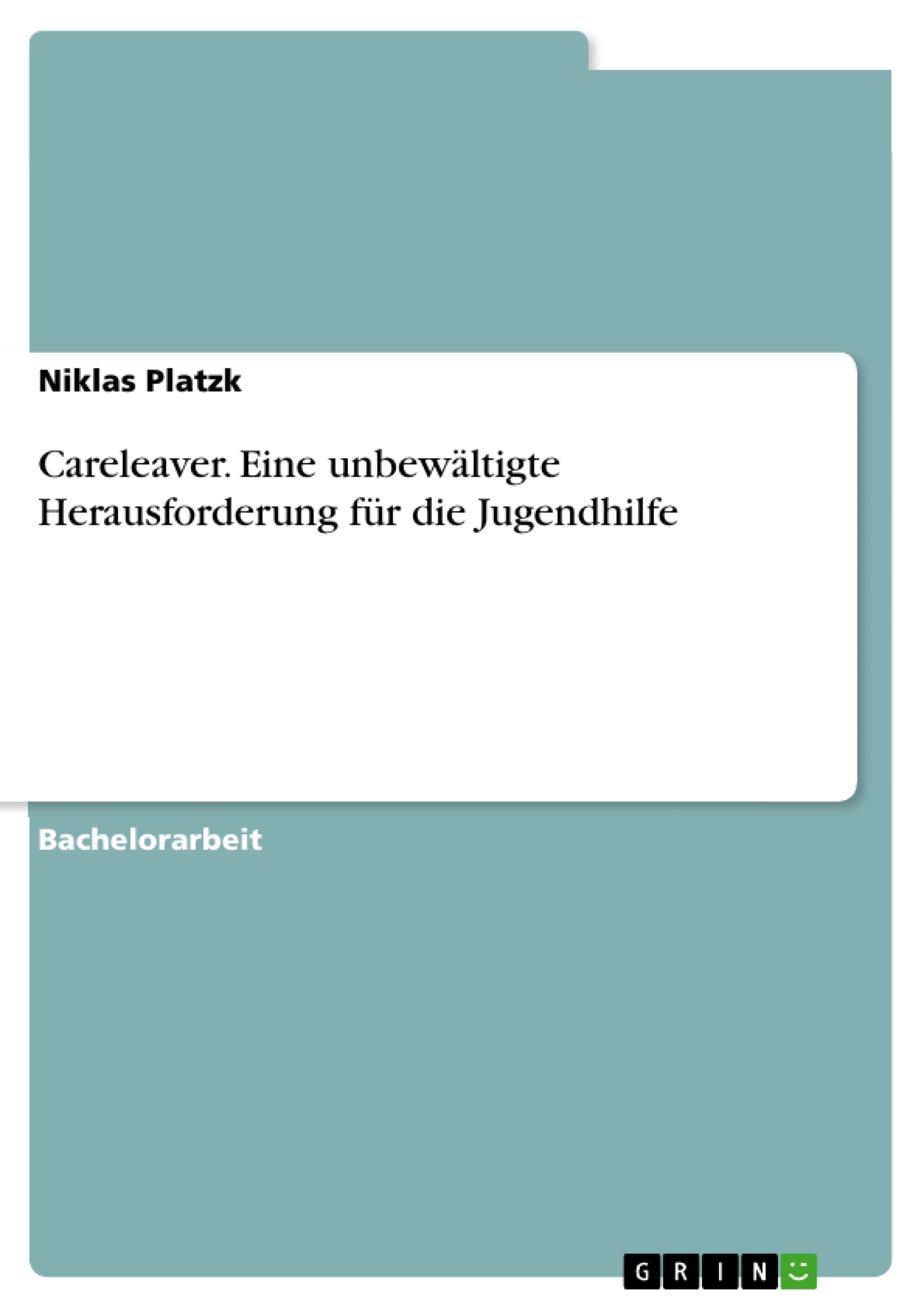In der vorliegenden Arbeit werden besonders die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen für ein Übergangsmanagement thematisiert. Zusätzlich werden auch verschiedene Herausforderungen von CareleaverInnen aufgegriffen, um zu verdeutlichen,
dass junge Menschen mit Verlassen der Hilfen zur Erziehung eine fortlaufende Unterstützung benötigen. Abschließend werden einige bisherige Übergangsmodelle und Konzepte veranschaulicht, um beispielhaft zu verdeutlichen, wie ein Übergangsmanagement funktionieren kann. Es soll in dieser Arbeit verdeutlicht werden, dass CareleaverInnen mit dem Auszug aus den stationären Jugendhilfeeinrichtungen dennoch einen Anspruch und einen Bedarf für weiterführende Unterstützung haben und dass eben dieser von den öffentlichen und freien Trägern der Hilfen zur Erziehung anerkannt und unterstützt werden muss.
CareleaverInnen stellen für die Jugendhilfe grundsätzlich keine konkrete Herausforderung mehr dar, da der Hilfebedarf in der Regel so weit erfüllt wurde, dass ein selbstständiges Leben ansteht. Für viele CareleaverInnen bedeutet das eigenständige Leben jedoch häufig Komplikationen und Herausforderungen, auf die sie nicht ausreichend vorbereitet waren. Da CareleaverInnen ehemalige junge Menschen aus der Jugendhilfe sind, stellt sich die Frage, inwieweit die Übergänge aus der Jugendhilfe ausgestaltet sind und inwieweit ein Übergabemanagement für CareleaverInnen relevant ist.
Übergänge sind für alle Menschen ein Teil des Lebens. Besonders die Gestaltung dieser Übergänge kann in verschiedenen Situationen über weitere Verläufe des Lebens oder auch das Reflektieren der Vergangenheit entscheiden. Ein umfangreiches Übergangsmanagement kann somit Abhilfe schaffen und Entwicklungsprozesse der jungen Menschen und werdenden
CareleaverInnen unterstützen. Übergänge gestalten sich für die meisten Menschen als Herausforderung, jedoch haben die meisten Menschen ein unterstützendes Hilfenetzwerk, auf das sie sich verlassen können, wenn es zu herausfordernden Situationen kommt. Dieses Hilfenetzwerk haben junge Menschen aus der stationären Jugendhilfe und somit auch CareleaverInnen häufig nicht und sind somit vermehrt auf sich gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition
- 2.1. KJSG
- 2.2. Ombudschaft
- 3. Leaving Care - Wer sind CareleaverInnen
- 4. Komplikationen und Herausforderungen für CareleaverInnen
- 4.1. Fehlende Bezugspersonen nach Hilfeende
- 4.2. Fehlende Übergänge (Übergangsgestaltung)
- 4.3. Finanzen und Karriere
- 4.4. Gesundheit
- 4.5. Gesellschaftliches Stigma
- 4.6. Fortlaufende Unterstützung
- 4.7. Herausforderung als Beeinträchtigung der Entwicklung
- 4.8. Herausforderungen für junge Menschen nach §35a SGB VIII
- 5. Gesetzliche Grundlagen für ein Übergangsmanagement
- 5.1. SGB VIII in Bezug auf CareleaverInnen
- 5.2. KJSG in Bezug auf CareleaverInnen
- 6. Übergangsmanagement
- 6.1. In der Jugendhilfe
- 6.2. Vorbereitung des Übergangs
- 7. Anforderungen an die Jugendhilfe für ein Übergangsmanagement
- 7.1. Gesetzliche Anforderungen / Ansprüche
- 7.2. Relevanz für pädagogische Fachkräfte / professionelle Haltung
- 8. Übergangsmodelle und aktuelle fortlaufende Unterstützung
- 8.1. Hildesheimer Übergangsmodell
- 8.2. Übergangskonzept Kreis Lippe
- 8.3. The Careleaver Association
- 8.4. Alternative Unterstützung (Lotse, personal Advisor, etc.)
- 8.5. Careleaver Netzwerke / Selbsthilfe
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der besonderen Herausforderung von CareleaverInnen - ehemaligen jungen Menschen aus der Jugendhilfe - im Übergang in das selbstständige Leben. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die CareleaverInnen nach dem Ende der Hilfen zur Erziehung begegnen, und untersucht die Relevanz eines strukturierten Übergangsmanagements.
- Die Herausforderungen von CareleaverInnen im Übergang vom betreuten Wohnen in das selbstständige Leben.
- Die Bedeutung von Fortlaufender Unterstützung und Hilfenetzen für CareleaverInnen.
- Der aktuelle Stand der rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Übergangsmanagement in der Jugendhilfe.
- Beispiele für erfolgreiche Übergangsmodelle und Konzepte in der Jugendhilfe.
- Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte im Übergangsprozess und die Bedeutung der professionellen Haltung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und verdeutlicht die Bedeutung von Übergangsmanagement für CareleaverInnen. Kapitel 2 definiert wichtige Begrifflichkeiten wie KJSG und Ombudschaft, die im Kontext der Arbeit relevant sind.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Definition von CareleaverInnen und beleuchtet die vielfältigen Lebenswege und Erfahrungen von jungen Menschen, die aus der Jugendhilfe entlassen werden. Kapitel 4 untersucht die verschiedenen Komplikationen und Herausforderungen, mit denen CareleaverInnen im Alltag konfrontiert sind. Dazu gehören Themen wie fehlende Bezugspersonen, mangelnde finanzielle Sicherheit, Probleme im Bildungsbereich und gesellschaftliche Stigmatisierung.
Kapitel 5 analysiert die rechtlichen Grundlagen für ein Übergangsmanagement für CareleaverInnen im SGB VIII und im KJSG. Kapitel 6 befasst sich mit der konkreten Umsetzung des Übergangsmanagements in der Jugendhilfe und der Vorbereitung auf den Übergang in das selbstständige Leben.
Kapitel 7 beleuchtet die Anforderungen an die Jugendhilfe, um ein effektives Übergangsmanagement zu gewährleisten, und die Bedeutung der professionellen Haltung der pädagogischen Fachkräfte.
Kapitel 8 präsentiert verschiedene Modelle und Konzepte für ein erfolgreiches Übergangsmanagement. Es werden Beispiele aus der Praxis vorgestellt, um die Vielfältigkeit und Effektivität verschiedener Ansätze zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
CareleaverInnen, Jugendhilfe, Übergangsmanagement, Hilfen zur Erziehung, SGB VIII, KJSG, Ombudschaft, Fortlaufende Unterstützung, Herausforderungen, Übergangsgestaltung, Modelle, Konzepte.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind „Careleaver“?
Careleaver sind junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in stationärer Jugendhilfe (Heim oder Pflegefamilie) verbracht haben und nun den Übergang in die Selbstständigkeit meistern.
Warum ist der Übergang aus der Jugendhilfe so schwierig?
Oft fehlen tragfähige familiäre Netzwerke, finanzielle Sicherheit und eine kontinuierliche Begleitung, was zu Problemen bei Gesundheit, Karriere und Wohnen führen kann.
Was ändert das KJSG für Careleaver?
Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) verbessert die rechtlichen Ansprüche auf Übergangsmanagement und eine fortlaufende Unterstützung über das 18. Lebensjahr hinaus.
Was ist das „Hildesheimer Übergangsmodell“?
Es ist ein beispielhaftes Konzept für ein strukturiertes Übergangsmanagement, das junge Menschen frühzeitig auf das Leben nach der Jugendhilfe vorbereitet.
Welche Rolle spielen Ombudsstellen?
Ombudsstellen beraten junge Menschen unabhängig über ihre Rechte gegenüber dem Jugendamt und unterstützen sie bei der Durchsetzung von Hilfeansprüchen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Niklas Platzk (Author), 2023, Careleaver. Eine unbewältigte Herausforderung für die Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1361259