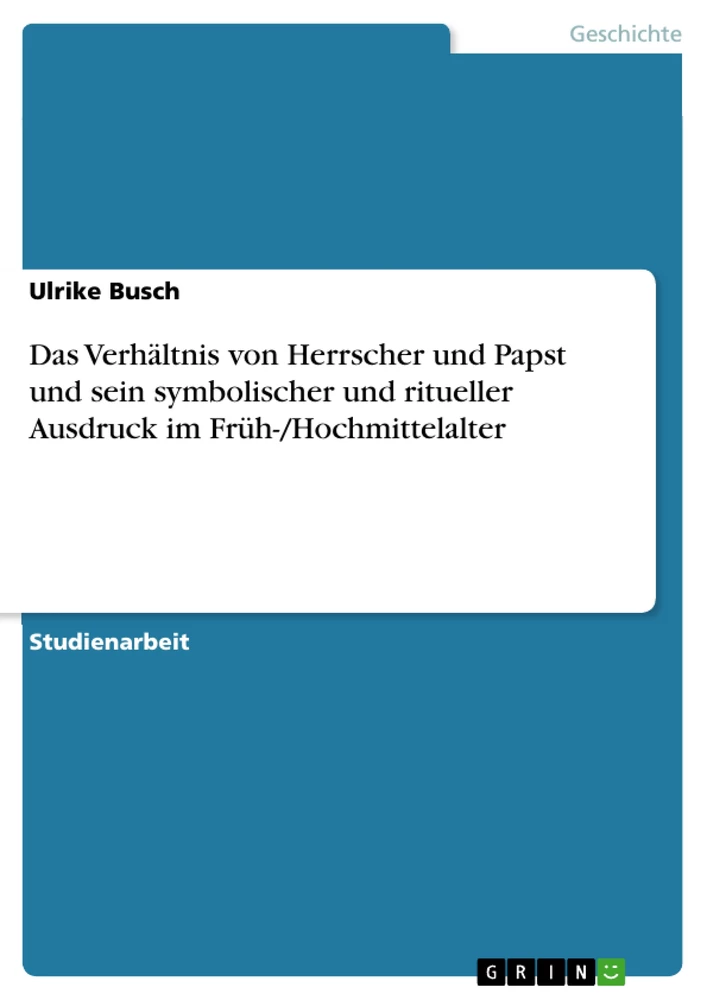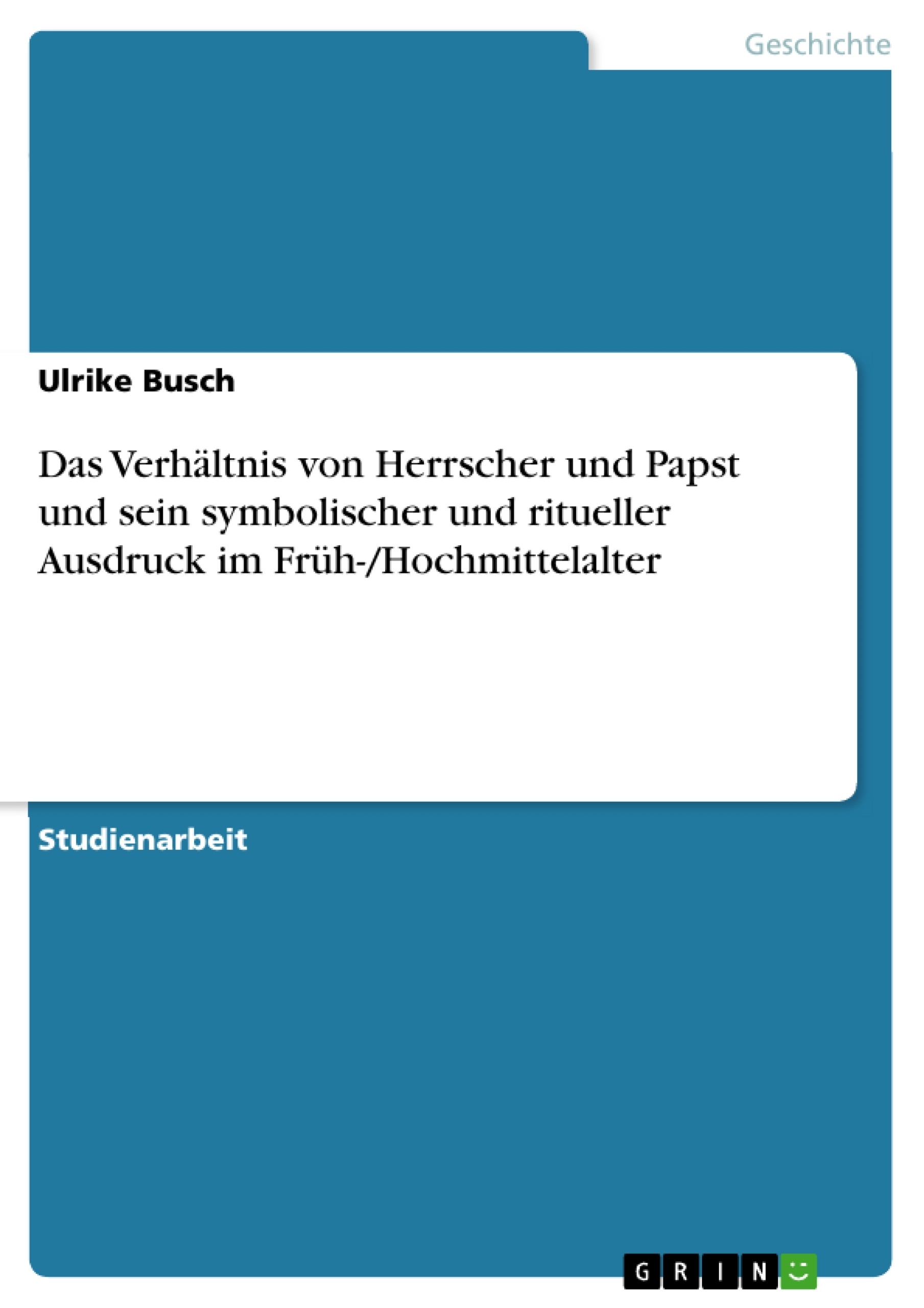Die symbolische Konfliktführung und –beilegung im Mittelalter kann unter anderem am Verhältnis von Kaiser und Papst veranschaulicht werden. Dieses Verhältnis ist ein Thema mit Tradition in der Mittelalterforschung. Der symbolischen und rituellen Darstellung dieses Verhältnisses wurde jedoch lange Zeit in der Mittelalterforschung wenig Bedeutung beigemessen. Die intensive Erforschung der Funktionen symbolischer und ritueller Kommunikation im Mittelalter ist ein relativ junger Forschungszweig, der jedoch in Münster bereits institutionell als Sonderforschungsbereich 496 "Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution" verankert ist. Dabei geht es um die Fragen des Verständnisses von Ritualen, ihrer Veränderlichkeit im Laufe des Mittelalters sowie ihrer Bedeutung für die mittelalterliche Herrschaftsordnung. Es soll vor allem die in der Forschung lange vorherrschende Meinung der "Irr- und Vorrationalität" symbolischer Kommunikation im Mittelalter widerlegt und ihre zentrale Bedeutung für das Funktionieren der damaligen Gesellschaft gezeigt werden. In dieser Arbeit werden fünf Papst-Kaiser-Begegnungen aus drei verschiedenen Phasen des Früh- und Hochmittelalters, und zwar aus dem 8., dem 11. und dem 12. Jahrhundert, näher beleuchtet. Anhand dieser Beispiele sollen das Papst-Kaiser-Verhältnis und seine Veränderungen sowie sein Ausdruck in Symbolen und Ritualen veranschaulicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beispiel I (8. Jhdt.): Die Karolinger und die Päpste
- Ponthion 754
- Paderborn 799
- Beispiel II (11. Jhdt.): Heinrich IV. und Gregor VII.: Canossa 1077
- Beispiel III (12. Jhdt.): Barbarossa und die Päpste
- Sutri 1155
- Der Frieden von Venedig 1177
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Kaiser und Papst im Früh- und Hochmittelalter, insbesondere seinen symbolischen und rituellen Ausdruck. Sie geht über die rein politische Betrachtung hinaus und beleuchtet die Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis der damaligen Herrschaftsstrukturen. Die Arbeit analysiert ausgewählte Begegnungen zwischen Kaisern und Päpsten, um Veränderungen dieses Verhältnisses und dessen rituelle Inszenierung aufzuzeigen.
- Symbolische Konfliktführung und -beilegung im Verhältnis von Kaiser und Papst
- Entwicklung und Wandel des Verhältnisses zwischen Kaiser und Papst im Früh- und Hochmittelalter
- Bedeutung symbolischer und ritueller Handlungen in der mittelalterlichen Herrschaftsordnung
- Analyse ausgewählter Papst-Kaiser-Begegnungen als Fallstudien
- Die Rolle von Ritualen in der mittelalterlichen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Verhältnisses von Kaiser und Papst im Mittelalter ein und beschreibt den Fokus auf die symbolische und rituelle Konfliktführung und -beilegung. Sie skizziert den Forschungsstand, wobei die bisherige Konzentration auf politische Aspekte und die zunehmende Berücksichtigung der symbolischen Kommunikation im jüngeren Forschungsdiskurs hervorgehoben werden. Die Arbeit wählt fünf Papst-Kaiser-Begegnungen als Fallstudien aus dem 8., 11. und 12. Jahrhundert aus, um die Veränderungen dieses Verhältnisses und seine rituelle Inszenierung zu veranschaulichen.
Beispiel I (8. Jhdt.): Die Karolinger und die Päpste: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Karolinger und den Päpsten im 8. Jahrhundert. Es zeigt den Wandel von der Zwei-Gewalten-Lehre hin zu einem Priesterkönigtum, der durch die Salbung Pippins des Jüngeren symbolisiert wird. Die enge Verflechtung von weltlicher und geistlicher Macht wird betont, wobei die relative Stärke des weltlichen Herrschers im Vergleich zum Papst hervorgehoben wird. Das Kapitel betont die friedliche Koexistenz der beiden Gewalten in dieser Epoche und bildet einen wichtigen Kontrast zu späteren, konfliktreicheren Perioden.
Beispiel II (11. Jhdt.): Heinrich IV. und Gregor VII.: Canossa 1077: (Die Zusammenfassung dieses Kapitels fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht rekonstruiert werden.)
Beispiel III (12. Jhdt.): Barbarossa und die Päpste: (Die Zusammenfassung dieses Kapitels fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht rekonstruiert werden.)
2.1 Ponthion 754: Dieses Unterkapitel analysiert die Begegnung zwischen Papst Stephan II. und Pippin dem Jüngeren in Ponthion im Jahr 754. Es untersucht unterschiedliche Quellenberichte (fränkische und päpstliche), um die tatsächlichen Ereignisse zu rekonstruieren. Die unterschiedlichen Darstellungen des Ereignisses, die jeweils die eigene Seite positiver und die andere negativer darstellen, werden analysiert. Die Bedeutung dieser Begegnung als Symbol für die Abwendung des Papsttums von Byzanz und den Beginn eines Bündnisses mit dem Westen wird hervorgehoben. Die rituellen Handlungen, wie die Demutsgeste des Papstes oder die des Königs, werden detailliert beschrieben und im Kontext der Machtverhältnisse interpretiert. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der Rituale für die symbolische Kommunikation und das Verständnis des Verhältnisses zwischen Papst und König.
Schlüsselwörter
Papst, Kaiser, Mittelalter, Symbolische Kommunikation, Rituale, Herrschaftsordnung, Konflikt, Zwei-Gewalten-Lehre, Priesterkönigtum, Karolinger, Ottonen, Canossa, Barbarossa, Ponthion, Sutri, Venedig.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kaiser und Papst im Früh- und Hochmittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Kaiser und Papst im Früh- und Hochmittelalter, mit besonderem Fokus auf die symbolische und rituelle Ausgestaltung dieses Verhältnisses. Sie geht über rein politische Aspekte hinaus und analysiert die Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis der damaligen Herrschaftsstrukturen.
Welche Zeiträume und Ereignisse werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf ausgewählte Begegnungen zwischen Kaisern und Päpsten aus dem 8., 11. und 12. Jahrhundert. Konkret werden die Beziehungen der Karolinger zu den Päpsten, das Ereignis von Canossa (Heinrich IV. und Gregor VII.), und die Auseinandersetzungen zwischen Barbarossa und den Päpsten untersucht. Spezifische Ereignisse wie Ponthion 754, Paderborn 799, Sutri 1155 und der Frieden von Venedig 1177 werden detailliert analysiert.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Fallstudien (Papst-Kaiser-Begegnungen) um Veränderungen im Verhältnis von Kaiser und Papst und deren rituelle Inszenierung aufzuzeigen. Dabei wird die symbolische Kommunikation und die Bedeutung ritueller Handlungen im mittelalterlichen Kontext hervorgehoben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die symbolische Konfliktführung und -beilegung zwischen Kaiser und Papst, die Entwicklung und den Wandel ihres Verhältnisses im Früh- und Hochmittelalter, die Bedeutung symbolischer und ritueller Handlungen in der mittelalterlichen Herrschaftsordnung, und die Rolle von Ritualen in der mittelalterlichen Gesellschaft.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf unterschiedliche Quellen, wie fränkische und päpstliche Berichte, um die Ereignisse der einzelnen Fallstudien zu rekonstruieren und zu analysieren. Die unterschiedlichen Darstellungen der Ereignisse in den Quellen werden kritisch betrachtet.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Thematik und den Forschungsstand einführt, und Kapitel zu den einzelnen Beispielen (Karolinger und Päpste, Heinrich IV. und Gregor VII., Barbarossa und die Päpste). Innerhalb der Kapitel werden oft detaillierte Analysen einzelner Begegnungen (z.B. Ponthion 754) vorgenommen.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter?
Papst, Kaiser, Mittelalter, Symbolische Kommunikation, Rituale, Herrschaftsordnung, Konflikt, Zwei-Gewalten-Lehre, Priesterkönigtum, Karolinger, Ottonen, Canossa, Barbarossa, Ponthion, Sutri, Venedig.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Die Arbeit bietet eine Zusammenfassung der Einleitung und des Kapitels zu den Karolinger und den Päpsten. Die Zusammenfassungen zu den Kapiteln über Heinrich IV./Gregor VII. und Barbarossa/Päpste fehlen im Ausgangstext.
- Quote paper
- Ulrike Busch (Author), 2005, Das Verhältnis von Herrscher und Papst und sein symbolischer und ritueller Ausdruck im Früh-/Hochmittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136126