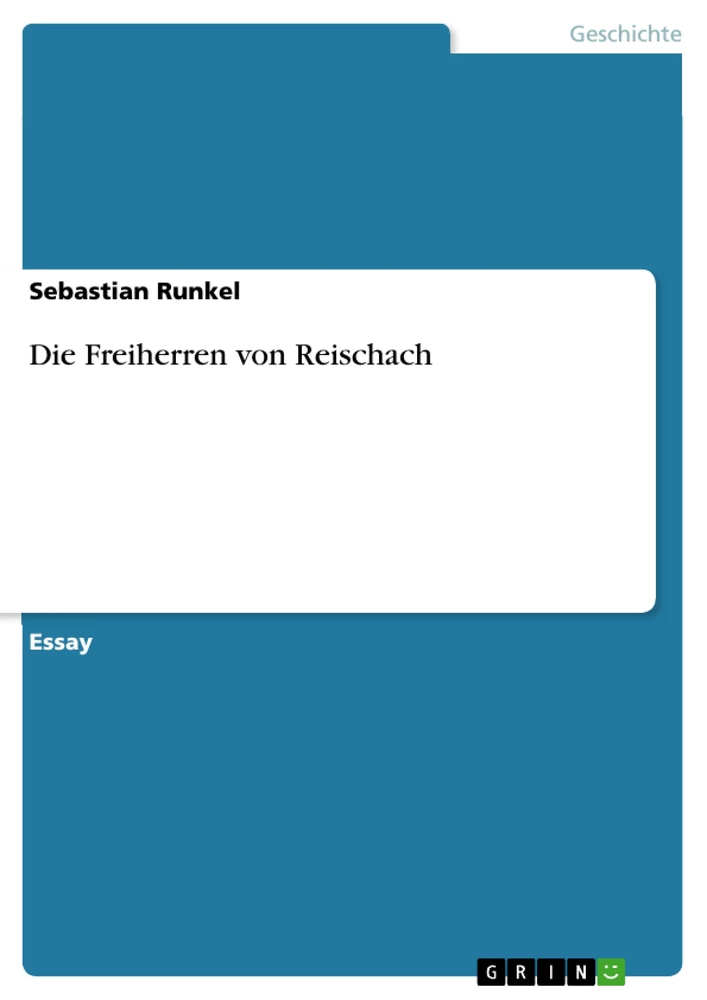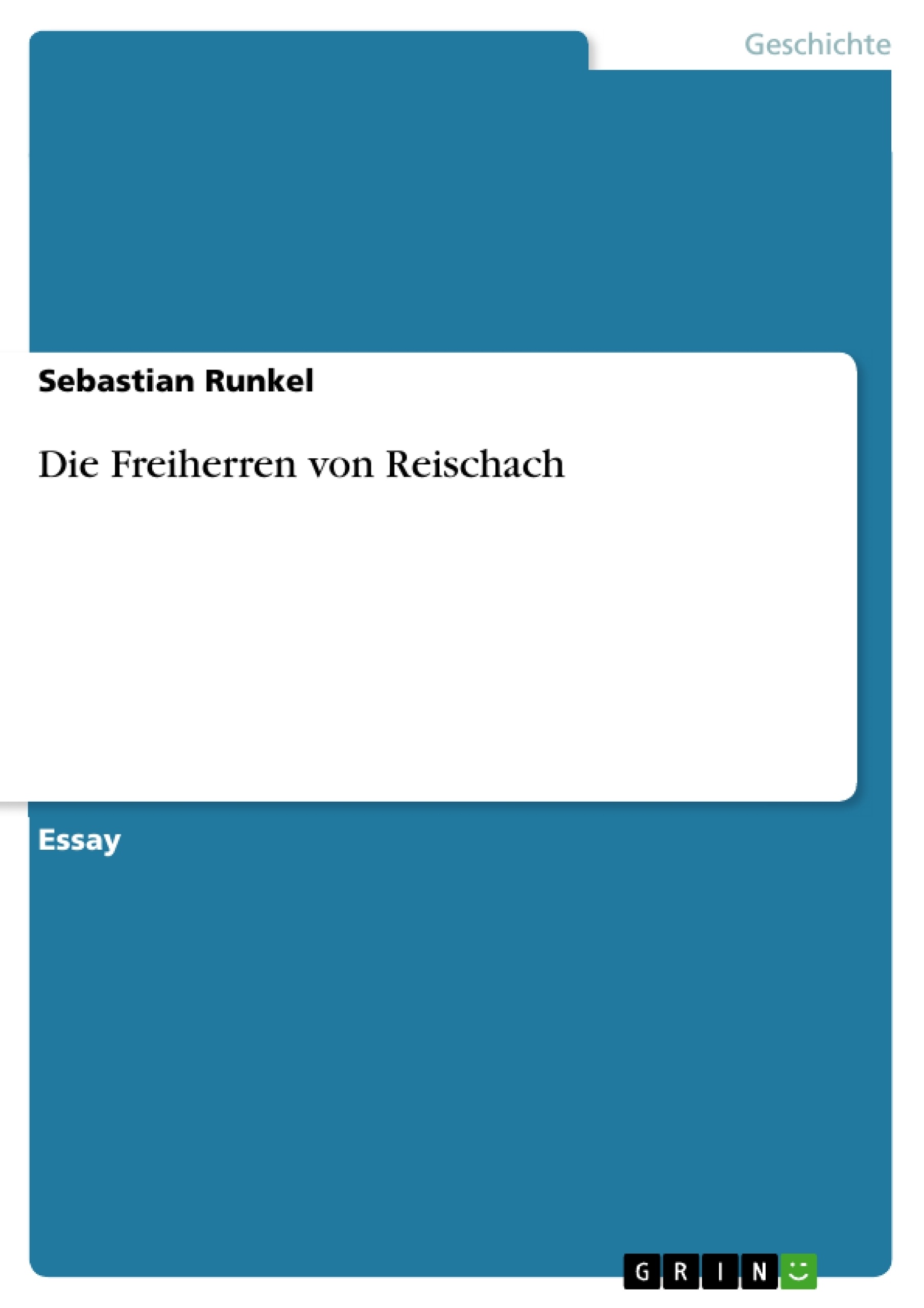Die Freiherren von Reischach waren zunächst Ministerialen des Grafen von Pfullendorf. Im weiteren Verlauf ihrer Geschichte tauchen sie zudem als Dienstmannen der Staufer auf. Ihren namengebenden Stammsitz hatten sie nahe der der Reichsstadt Pfullendorf. Mit ihrer Stammburg Burrach beim Walder Ortsteil Reischach sind sie erstmals 1191 bezeugt, ihr ältestes Mitglied, Diebold von Reischach, hingegen schon 1019. Sie sind ein typisches kleinadeliges Geschlecht, das es nie zu herausragender Berühmtheit an sich oder an einzelnen Mitgliedern brachte, deren Vertreter aber in der südwestdeutschen Geschichte, vor allem im Umfeld des Hauses Württemberg, bis in die Neuzeit immer wieder in Erscheinung traten.
Ihre zahlreichen Linien, in welche sich die Familie schon relativ früh spaltete, griffen insbesondere im 14. Jahrhundert weit über den engeren Umkreis des Stammsitzes hinaus, beispielsweise in den benachbarten Hegau, wo eine Linie 1374 die Burg Neuhewen über Engen erwarb und sich um die Burg herum eine umfangreiche Herrschaft aufbaute. 1506 brachte sie dann die Hälfte der Herrschaft Immendingen an der Donau mit der unteren Burg an sich und erwarb schließlich im Jahr 1758 die Herrschaft Hohenkrähen zwischen Engen und Singen mit dem Schloss zu Schlatt unter Krähen, das seit 1834, dem Jahr des Verkaufs der Herrschaft Immendingen, zum alleinigen Sitz dieser noch heute blühenden Linie werden sollte
Andere Linien, deren Zusammenhänge untereinander und mit der auf Neuhewen sitzenden Linie teilweise ungeklärt sind, saßen auf der Burg Vorderstoffeln (von 1403 bis 1623), in Steißlingen (im 15. und 16. Jahrhundert.), auf dem Mägdeberg (von 1528 bis 1620) und zu Aach (im 15. und 16. Jahrhundert). Archivalien, vor allem Urkunden aus dem Besitz beinahe all dieser im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Linien sind heute Bestandteile des Archivs der allein im Hegau gegenwärtig noch lebenden Linie Neuhewen-Immendingen-Schlatt. Nur vereinzelt finden sich im Schlatter Archiv Urkunden der außerhalb des Hegaus, im heutigen Landesteil Württemberg, ansässigen Linien Dietfurt, Reichenstein und Nußdorf.
Dieser Aufsatz stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Personen des Geschlechts bis zu den Anfänger der Neuzeit dar. Dabei soll auf die wichtigsten Linien im Einzelnen eingegangen werden. Hauptquelle der Informationen ist das Oberbadische Geschlechterbuch, weshalb dieses nicht jedes Mal zitiert werden soll.
Die Freiherren von Reischach waren zunächst Ministerialen des Grafen von Pfullendorf. Im weiteren Verlauf ihrer Geschichte tauchen sie zudem als Dienstmannen der Staufer auf. Ihren namengebenden Stammsitz hatten sie nahe der der Reichsstadt Pfullendorf. Mit ihrer Stammburg Burrach beim Walder Ortsteil Reischach sind sie erstmals 1191 bezeugt, ihr ältestes Mitglied, Diebold von Reischach, hingegen schon 1019. Sie sind ein typisches kleinadeliges Geschlecht, das es nie zu herausragender Berühmtheit an sich oder an einzelnen Mitgliedern brachte, deren Vertreter aber in der südwestdeutschen Geschichte, vor allem im Umfeld des Hauses Württemberg, bis in die Neuzeit immer wieder in Erscheinung traten.
Ihre zahlreichen Linien, in welche sich die Familie schon relativ früh spaltete, griffen insbesondere im 14. Jahrhundert weit über den engeren Umkreis des Stammsitzes hinaus, beispielsweise in den benachbarten Hegau, wo eine Linie 1374 die Burg Neuhewen über Engen erwarb und sich um die Burg herum eine umfangreiche Herrschaft aufbaute. 1506 brachte sie dann die Hälfte der Herrschaft Immendingen an der Donau mit der unteren Burg an sich und erwarb schließlich im Jahr 1758 die Herrschaft Hohenkrähen zwischen Engen und Singen mit dem Schloss zu Schlatt unter Krähen, das seit 1834, dem Jahr des Verkaufs der Herrschaft Immendingen, zum alleinigen Sitz dieser noch heute blühenden Linie werden sollte[1]
Andere Linien, deren Zusammenhänge untereinander und mit der auf Neuhewen sitzenden Linie teilweise ungeklärt sind, saßen auf der Burg Vorderstoffeln (von 1403 bis 1623), in Steißlingen (im 15. und 16. Jahrhundert.), auf dem Mägdeberg (von 1528 bis 1620) und zu Aach (im 15. und 16. Jahrhundert). Archivalien, vor allem Urkunden aus dem Besitz beinahe all dieser im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Linien sind heute Bestandteile des Archivs der allein im Hegau gegenwärtig noch lebenden Linie Neuhewen-Immendingen-Schlatt. Nur vereinzelt finden sich im Schlatter Archiv[2] Urkunden der außerhalb des Hegaus, im heutigen Landesteil Württemberg, ansässigen Linien Dietfurt, Reichenstein und Nußdorf.
Dieser Aufsatz stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Personen des Geschlechts bis zu den Anfänger der Neuzeit dar. Dabei soll auf die wichtigsten Linien im Einzelnen eingegangen werden. Hauptquelle der Informationen ist das Oberbadische Geschlechterbuch, weshalb dieses nicht jedes Mal zitiert werden soll.
Als ältestes Mitglied der Familie ist Diebold von Reischach 1019 nachgewiesen[3]. Er war ein bekannter Turnierritter, der überall anzutreffen war, wo ritterliche Kampfspiele ausgetragen wurden. Diese Kampfeslust, die ihn auszeichnete, vererbte sich auch auf die kommenden Geschlechter. Die Familie war außerordentlich zahlreich. Auf einer Tagung in Ulm konnte der kaiserliche Hauptmann im Schmalkaldischen Krieg, Joh. Conrad von Reischach, dem Kaiser Karl V. mit 42 Junkern seiner Sippe aufwarten. Von der Mitte des 13. Jahrhunderts an zogen sie in die Gebiete des Hegaus und des Albgaus. Sie besaßen Güter, Zehnten oder zumindest Teile von diesen, Zinsen und Gerechtsame aller Art in Bargen, Binningen unter Hohenstoffeln, Duchtlingen, Haufen, Hohenkrähen, Immendingen mit Bachzimmern und Hewenegg, Ippingen, Langenrhein, Mägdeberg, Mahlspüren, Mauenheim, Neudingen, Schlatt, Steißlingen, Stetten am Neuhewen inklusive der Burg zu Neuhewen, Gunthausen, Thalheim, Weiterdingen, Zimmerholz und Zimmern. Überdies waren sie Lehenträger der Herzöge von Österreich, der Grafen von Hewen-Lupfen-Fürstenberg, von Württemberg, Zollern, der Klöster Amtenhausen, Friedenweiler, Reichenau, St. Blasien, St. Gallen und der Markgrafen von Baden.
Viele traten in die Dienste Württembergs, Österreichs, der Schweizer Kantone Schaffhausen und Zürich und der Grafschaft Fürstenberg. Man findet sie als Äbte in den Klöstern Rheinau und St. Blasien, als Domherren in Augsburg und Konstanz. Abgesehen vom Kloster Wald erhielten viele der weiblichen Mitglieder der Familie Versorgungsstellen in den Hausklöstern des Hegauer und Baaradels in Amtenhausen, Friedenweiler, Auf Hoch in Neudingen. Das mächtige, kriegsgeübte Geschlecht wurde von den Klöstern gern als Zeugen in Stiftungsurkunden herangezogen. So werden sie beispielsweise in Salemer Urkunden 1191, 1200 und 1263 erwähnt[4].
Die Linie zu Neuhewen
Im Jahr 1369 wurde Hans von Reischach, genannt Schnabel, mit dem Zehnten zu Seedorf belehnt. Bedeutend war der Kauf der Burg Neuhewen im Jahr 1974. Dieser Kauf von den Gebrüdern Reinhard, Ulrich und Heinrich von Neuneck, an welche die Burg verpfändet war, wurde ihm von Herzog Luitpold von Österreich gestattet. 1376 will er mit Graf Heinrich von Montfort und anderen die Sühne wegen der ‚bösen Fastnacht’ in Basel halten. Hans von Reischach war Ritter und mit Verene Studengast verheiratet. Zudem war er Bürge für die Städte Konstanz und Ravensburg im Jahr 1384. Er starb im Jahr 1391.
Über seinen Bruder Eck von Reischach ist nicht so viel bekannt. Bezeugt sind Stiftungen verschiedener Jahrestage. Überdies hatte er zwei Gattinnen.
Hans von Reischach hatte zwei Söhne, Emann und Konrad. Über Emann von Reischach ist bekannt, dass er 1438 als Lehen von Lupfen das „Wasser an der Aitrach“[5] und einen Hof in Pfohren erhielt. Außerdem wurde 1403 ein Burgfrieden zu Neuhewen von Burkart von Neuneck und Eck von Reischach zu Stoffeln zwischen Hans, Eberhard und Konrad von Reischach vermittelt Er und sein Bruder Konrad mehrten den Besitz des Vaters durch verschiedene Käufe in Zimmerholz und Mauenheim.
[...]
[1] Maurer, H.: Das Archiv der Freiherren von Reischach im Schloß zu Schlatt u. Kr.. Inventar der Urkunden, Bände und Akten, Singen 1969, S. 3.
[2] Zur Geschichte des Archivs und seiner Inhalte siehe ebd., S. 3ff.
[3] Baumann, W.: Immendingen, Geschichte eines ehemaligen reichsritterschaftlichen Fleckens, Karlsruhe 1937, S. 69.
[4] Ebd. S. 69.
[5] Baumann, W.: Immendingen, S. 70.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Freiherren von Reischach?
Ein südwestdeutsches Adelsgeschlecht, das ursprünglich als Ministerialen der Grafen von Pfullendorf und später der Staufer in Erscheinung trat.
Wo befand sich der Stammsitz der Familie?
Der namengebende Stammsitz lag nahe Pfullendorf, mit der Stammburg Burrach beim Ortsteil Reischach.
Welche Linien der Familie Reischach gab es im Hegau?
Besonders bedeutend war die Linie Neuhewen-Immendingen-Schlatt. Andere saßen auf Vorderstoffeln, Steißlingen und dem Mägdeberg.
Wer war das älteste nachgewiesene Mitglied?
Diebold von Reischach, der bereits im Jahr 1019 urkundlich erwähnt wurde.
In welchen Diensten standen die Familienmitglieder?
Sie dienten dem Haus Württemberg, Österreich, Schweizer Kantonen und traten als Äbte oder Domherren in kirchliche Dienste.
- Citar trabajo
- Sebastian Runkel (Autor), 2009, Die Freiherren von Reischach, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136160