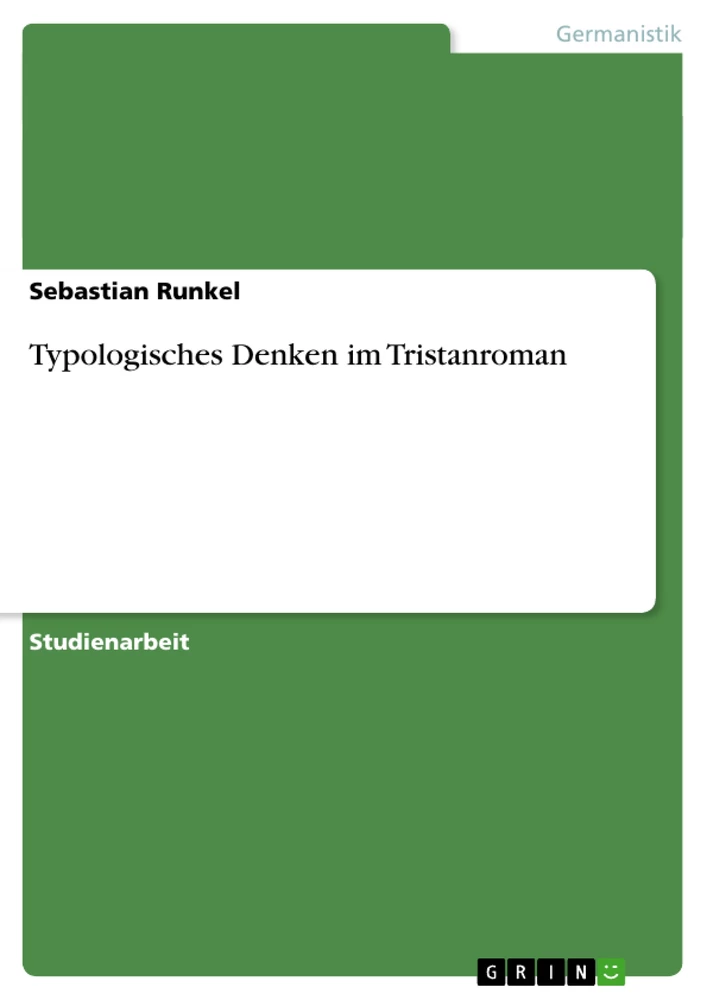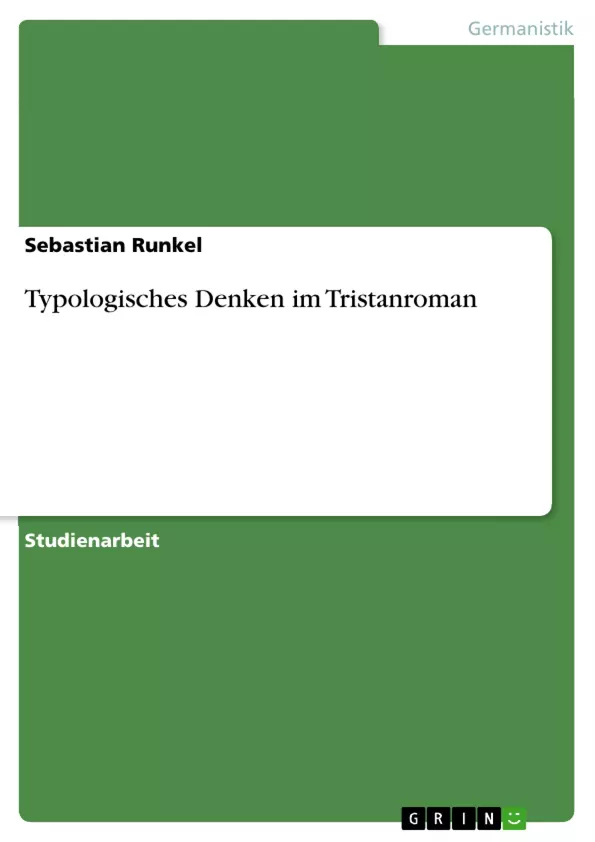Ich möchte mich in dieser Hausarbeit mit ausgewählten Textstellen aus dem Tristanroman Gottfrieds von Straßburg beschäftigen. Zwei Fragestellungen sollen dabei im Mittelpunkt stehen:
(1) Inwiefern finden sich Formen der Adaption und Überbietung von antiken Stoffen in Gottfrieds Roman?
(2) Gibt es Hinweise darauf, dass Gottfried nicht nur Stoffe und Personen der Antike zu überbieten versucht, sondern auch seine ‚Zeitgenossen’?
Bei der Untersuchung der Textstellen, so meine These, wird sich herausstellen, dass sich bei Gottfried ein ausgeprägtes Maß an typologischem Denken feststellen lässt. Es wird nicht einfach von der Helena des alten Griechenlands gesprochen, das wäre zu einfach. Kurz darauf findet man die Überbietung dieser Person, natürlich durch Personen oder Begebenheiten des Gottfriedschen Textes. Das Alte wird gelobt, um durch die Überbietung des Gelobten das Eigene noch größer zu machen. Diese These soll anhand mehrer Textstellen auf ihre Richtigkeit geprüft werden.
Doch möchte ich noch eine zweite Frage damit in Verbindung bringen. Belässt es Gottfried dabei, die Antike zu überbieten? Um diese Frage zu klären, muss man sich, wie ich denke, dem berühmten Literaturexkurs Gottfrieds zuwenden. Denn hier unterzieht der Autor selbst seine ‚Kollegen’ der Kritik. Nachdem er sich seiner Unfähigkeit anscheinend bewusst geworden ist und diese vehement beteuert, lobt er die meisten seiner Zeitgenossen über die Maßen wegen ihrer Dichtkunst. Doch wurde immer wieder angenommen, dass Gottfried dieses nur als Mittel zum Zweck verwendet, um sich selbst auf ganz subtile Art und Weise zu stilisieren. Da er sich selbst noch über die so gerühmten Kollegen stelle, betont er durch das zunächst erwähnte Lob für die Kollegen ganz besonders seiner herausragende Position, die über allen anderen steht. Ich schließe mich dieser These an und möchte anhand von Ausschnitten des Literaturexkurses diese begründen.
So lässt sich im Vorfeld folgende Position formulieren: Gottfried stellt sich in seinem Roman über die Antike und deren Überlieferungen. Doch belässt er es nicht dabei, sondern gibt in seinem Roman auch ganz deutlich zu verstehen, dass er auch über den besten und gerühmtesten Dichtern seiner Zeit steht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Typologie
- 3. Typologisches Denken im Tristanroman
- 4. Der Literaturexkurs
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das typologische Denken in Gottfried von Straßburgs Tristanroman. Die zentrale Fragestellung ist, inwieweit Gottfried antike Stoffe adaptiert und überbietet und ob er sich auch über seine Zeitgenossen stellt. Die Arbeit analysiert ausgewählte Textstellen, um diese Fragen zu beantworten und Gottfrieds Schreibweise zu beleuchten.
- Adaption und Überbietung antiker Stoffe in Gottfrieds Tristan
- Typologisches Denken als Methode in der Textinterpretation
- Gottfrieds Positionierung gegenüber seinen Zeitgenossen
- Analyse des Literaturexkurses als Selbstdarstellung
- Die Rolle von Figuren wie Isolde im Kontext der typologischen Überbietung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: Wie adaptiert und überbietet Gottfried von Straßburg antike Stoffe in seinem Tristanroman? Und gibt es Hinweise darauf, dass er nicht nur die Antike, sondern auch seine Zeitgenossen überbieten möchte? Die These der Arbeit ist, dass bei Gottfried ein ausgeprägtes typologisches Denken vorliegt, bei dem antike Vorbilder durch Figuren und Ereignisse des Romans überboten werden, um das Eigene hervorzuheben. Diese These wird im weiteren Verlauf anhand ausgewählter Textstellen geprüft, wobei auch der Literaturexkurs eine zentrale Rolle spielt, um Gottfrieds Selbstpositionierung zu analysieren.
2. Typologie: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Typologie im Kontext der Arbeit. Im Gegensatz zur allgemeinen Typenlehre wird hier die bibelexegetische Methode der Typologie betrachtet, bei der Ereignisse, Personen oder Dinge aus dem Alten und Neuen Testament in einen Sinnzusammenhang gebracht werden. Diese Methode wurde auch in der europäischen Literatur von ca. 800 - 1800 angewendet und findet sich auch in Gottfrieds Tristanroman wieder. Es wird die Inbezugsetzung von antiken und zeitgenössischen Personen und Ereignissen erläutert, wobei die Antike oft als adaptiert und überboten dargestellt wird. Der Literaturexkurs wird als besonders wichtiges Beispiel für diese Überbietung hervorgehoben.
3. Typologisches Denken im Tristanroman: Dieses Kapitel analysiert konkrete Textstellen, um die These des typologischen Denkens bei Gottfried zu belegen. Ein Beispiel ist die Beschreibung Isoldes Schönheit, die als Überbietung antiker Schönheitsideale interpretiert wird. Die Kapitel beleuchtet wie Gottfried durch die Überbietung des antiken Vorbildes seine eigenen Figuren und Ereignisse aufwertet. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie Gottfried durch die Referenz auf die Antike und die gleichzeitige Überbietung derselben seine eigene literarische Leistung hervorhebt.
Schlüsselwörter
Typologie, Gottfried von Straßburg, Tristanroman, Antike, Adaption, Überbietung, Literaturexkurs, Zeitgenossen, Selbstpositionierung, literarische Leistung.
Häufig gestellte Fragen zum Tristanroman von Gottfried von Straßburg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das typologische Denken im Tristanroman von Gottfried von Straßburg. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit Gottfried antike Stoffe adaptiert und überbietet und ob er sich damit über seine Zeitgenossen stellt. Die Arbeit untersucht, wie Gottfried durch die Referenz auf und gleichzeitige Überbietung antiker Vorbilder seine eigene literarische Leistung hervorhebt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Typologie, Typologisches Denken im Tristanroman, Der Literaturexkurs (wird im Detail nicht im Inhaltsverzeichnis beschrieben, aber in der Zusammenfassung der Kapitel), und Fazit (nicht im Detail beschrieben).
Was wird unter "Typologie" in diesem Kontext verstanden?
Die Arbeit versteht unter Typologie die bibelexegetische Methode, bei der Ereignisse, Personen oder Dinge aus dem Alten und Neuen Testament in einen Sinnzusammenhang gebracht werden. Diese Methode wurde auch in der europäischen Literatur angewendet und findet sich im Tristanroman wieder. Es geht um die Inbezugsetzung von antiken und zeitgenössischen Personen und Ereignissen, wobei die Antike oft als adaptiert und überboten dargestellt wird.
Wie wird die These des typologischen Denkens bei Gottfried belegt?
Die These wird durch die Analyse konkreter Textstellen belegt. Ein Beispiel ist die Beschreibung Isoldes Schönheit, die als Überbietung antiker Schönheitsideale interpretiert wird. Die Analyse zeigt, wie Gottfried durch die Überbietung antiker Vorbilder seine eigenen Figuren und Ereignisse aufwertet und seine literarische Leistung hervorhebt.
Welche Rolle spielt der Literaturexkurs?
Der Literaturexkurs spielt eine zentrale Rolle in der Analyse von Gottfrieds Selbstpositionierung und wird als besonders wichtiges Beispiel für die Überbietung antiker Vorbilder betrachtet. Er dient der Analyse von Gottfrieds Schreibweise und seiner Stellung zu seinen Zeitgenossen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Typologie, Gottfried von Straßburg, Tristanroman, Antike, Adaption, Überbietung, Literaturexkurs, Zeitgenossen, Selbstpositionierung, literarische Leistung.
Welche zentrale Fragestellung wird behandelt?
Die zentrale Fragestellung ist, inwieweit Gottfried antike Stoffe adaptiert und überbietet und ob er sich auch über seine Zeitgenossen stellt.
Wie wird die These der Arbeit formuliert?
Die These der Arbeit lautet, dass bei Gottfried ein ausgeprägtes typologisches Denken vorliegt, bei dem antike Vorbilder durch Figuren und Ereignisse des Romans überboten werden, um das Eigene hervorzuheben.
- Citation du texte
- Sebastian Runkel (Auteur), 2008, Typologisches Denken im Tristanroman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136162