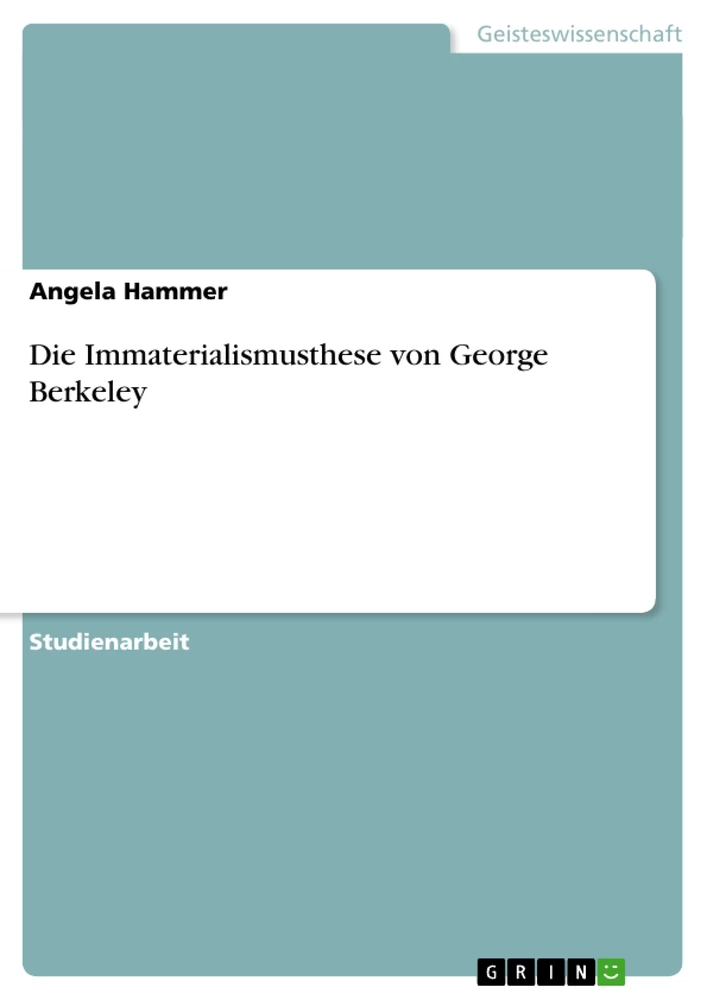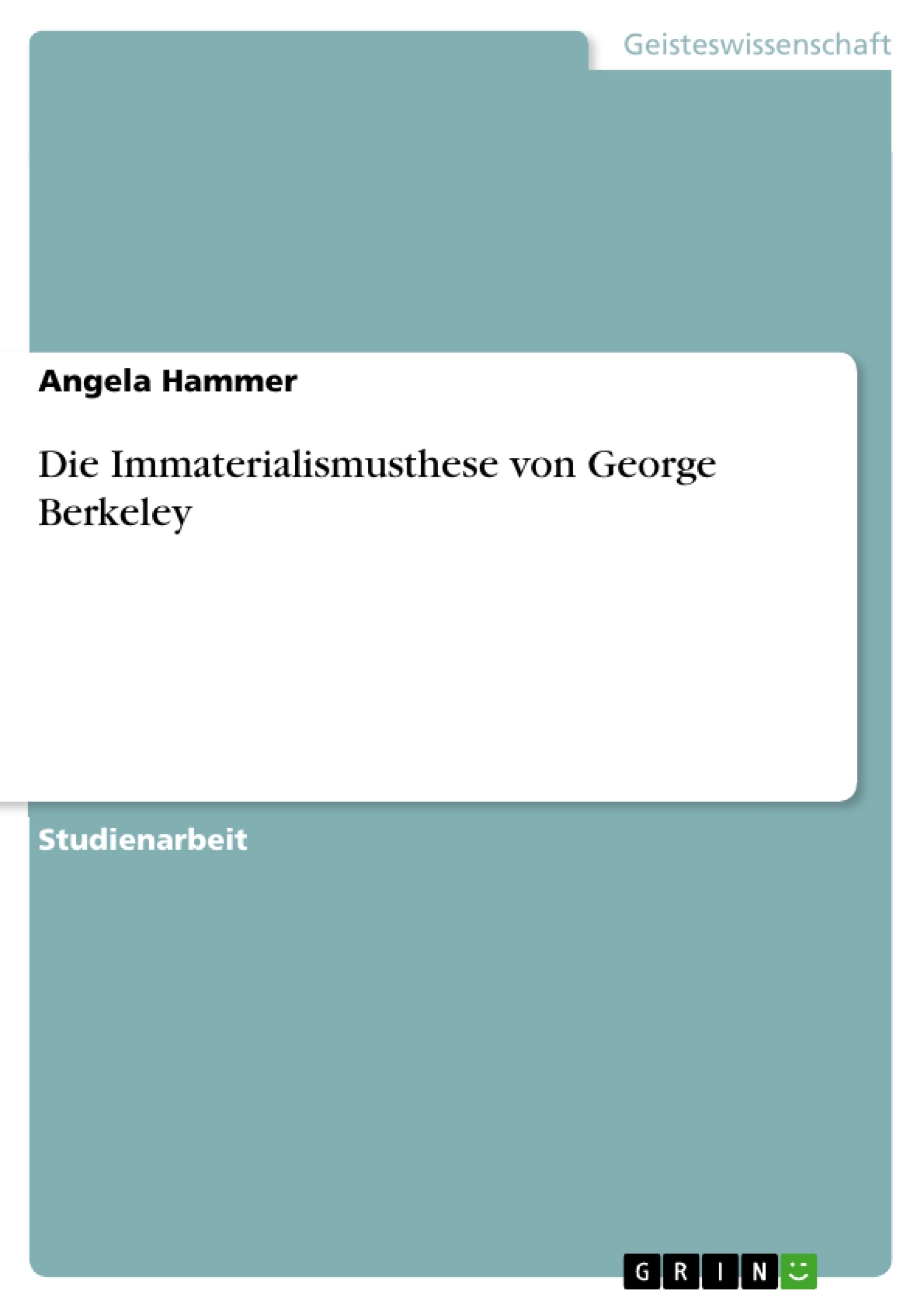George Berkeley (1685-1753), irischer Philosoph und ab 1734 Bischof von Cloyne gehört in
das „Lager“ der Empiristen. Die Frage, die den Nährboden seiner philosophischen Früchte
bildet, ist folgende:
Wie kann der Mensch zu sicherer Erkenntnis von der Wirklichkeit gelangen?
Diese Frage beschäftigt die Philosophen seit jeher, allerdings hat sich das Geschäft der
Erkenntnissuche seit dem großen französischen Rationalisten René Descartes (1596-1650)
neu orientiert. Immense Fortschritte in den Naturwissenschaften und in der Mathematik
beeinflußen nicht nur den Alltag des Menschen, sondern auch das Bild des Menschen in
dieser neu strukturierten Welt. Die neuen, naturwissenschaftlichen Erkenntnisse führen
automatisch zu neuen philosophischen Denkansätzen. Descartes als „Vater der Neuzeit“ setzte
mit seinem methodischen Zweifel den Grundstein für ein neues philosophisches
Denkgebäude, in welches später auch Berkeley Einzug halten wird.
Ein weiterer wichtiger Bewohner dieses neuen Gebäudes ist der englische Empirist John
Locke (1632-1704). Sein Einfluß auf Berkeleys Denken soll im Folgenden noch ausführlich
dargestellt werden. Berkeley findet früh seinen eigenen Raum in dem neuen Denkgebäude und entwickelt eine
erkenntnistheoretische Theorie, die man kurz die „Immaterialismusthese“ nennt. Diese These
besagt, daß der Begriff der Materie überflüssig ist und daß das Sein auf die Formel „esse est
percipi vel percipere“ (Sein ist wahrgenommen werden oder wahrnehmen) reduziert werden
kann. Die gesamte Philosophie Berkeleys dient der Verteidigung und Erklärung dieser „esse
est percipi vel percipere“ – Formel. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Drei Dialoge zwischen Hylas und Philonous“ – die Hauptquelle
- Hinführung zu John Locke hinsichtlich Berkeleys Philosophie
- Die primären und sekundären Eigenschaften bei Locke
- Die primären und sekundären Eigenschaften bei Berkeley
- Die sekundären Eigenschaften
- Die primären Eigenschaften
- Die Ursache der Vorstellungen
- Das Skeptizismus-Problem
- Die theistische Antwort auf den Skeptizismus
- Zusammenfassung der Immaterialismusthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die erkenntnistheoretische Theorie des irischen Philosophen George Berkeley, insbesondere seine Immaterialismusthese, die besagt, dass die Existenz von Materie unabhängig vom Geist nicht beweisbar ist. Berkeley argumentiert, dass das Sein auf die Formel "esse est percipi vel percipere" (Sein ist wahrgenommen werden oder wahrnehmen) reduziert werden kann.
- Berkeleys Kritik am Materialismus und seine Verteidigung des Immaterialismus
- Die Rolle der Wahrnehmung und des Geistes in der Erkenntnis
- Berkeleys Auseinandersetzung mit John Locke und dessen Philosophie
- Der Einfluss von Descartes und der Naturwissenschaften auf Berkeleys Denken
- Der Zusammenhang zwischen Berkeleys Philosophie und seiner theologischen Position
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation und das Problem der Erkenntnisgewinnung in Berkeleys Zeit dar, welches durch den Einfluss der Naturwissenschaften und den methodischen Zweifel Descartes geprägt wurde. Sie führt die zentrale Frage nach der sichereren Erkenntnis der Wirklichkeit und den Einfluss von John Locke auf Berkeleys Denken ein.
Das zweite Kapitel widmet sich Berkeleys Hauptwerk „Drei Dialoge zwischen Hylas und Philonous“, welches die Immaterialismusthese systematisch darstellt. Die Dialoge zwischen dem Materialisten Hylas und dem Immaterialisten Philonous verdeutlichen Berkeleys Argumentation und führen den Leser Schritt für Schritt zur Erkenntnis des Immaterialismus.
Das dritte Kapitel beleuchtet den Einfluss von John Locke auf Berkeleys Philosophie, insbesondere im Hinblick auf Lockes Unterscheidung zwischen primären und sekundären Eigenschaften. Berkeley kritisiert Lockes Theorie und argumentiert, dass auch primäre Eigenschaften nur als Vorstellungen im Geist existieren.
Das vierte Kapitel behandelt die Ursache der Vorstellungen und stellt Berkeleys Gottesbeweis dar. Durch die theistische Antwort auf den Skeptizismus versucht Berkeley, die Möglichkeit sicherer Erkenntnis zu gewährleisten und die „Überheblichkeit“ der Mathematiker und ihren Einfluss auf die theologische Debatte zu konterkarieren.
Schlüsselwörter
Immaterialismus, Esse est percipi, Wahrnehmung, Geist, Materie, John Locke, Descartes, Gottesbeweis, Skeptizismus, Szientismus, Sinnlichkeit, „Drei Dialoge zwischen Hylas und Philonous“
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Berkeleys Formel „esse est percipi“?
„Sein ist wahrgenommen werden“. Berkeley vertritt die These, dass Dinge nur existieren, insofern sie von einem Geist wahrgenommen werden; eine geistunabhängige Materie gibt es nicht.
Wie unterscheidet sich Berkeley von John Locke?
Während Locke zwischen primären (objektiven) und sekundären (subjektiven) Eigenschaften unterscheidet, argumentiert Berkeley, dass auch primäre Eigenschaften wie Ausdehnung nur Vorstellungen im Geist sind.
Was ist die Hauptquelle für Berkeleys Immaterialismusthese?
Sein Werk „Drei Dialoge zwischen Hylas und Philonous“, in dem ein Materialist und ein Immaterialist die Natur der Wirklichkeit diskutieren.
Wie löst Berkeley das Problem des Skeptizismus?
Durch eine theistische Antwort: Gott garantiert die Beständigkeit und Ordnung unserer Wahrnehmungen, auch wenn kein menschlicher Geist sie gerade betrachtet.
Welchen Einfluss hatte René Descartes auf Berkeley?
Descartes' methodischer Zweifel legte den Grundstein für die neuzeitliche Erkenntnistheorie, in der Berkeley seinen Platz als radikaler Empirist fand.
- Citation du texte
- Angela Hammer (Auteur), 2003, Die Immaterialismusthese von George Berkeley, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13617