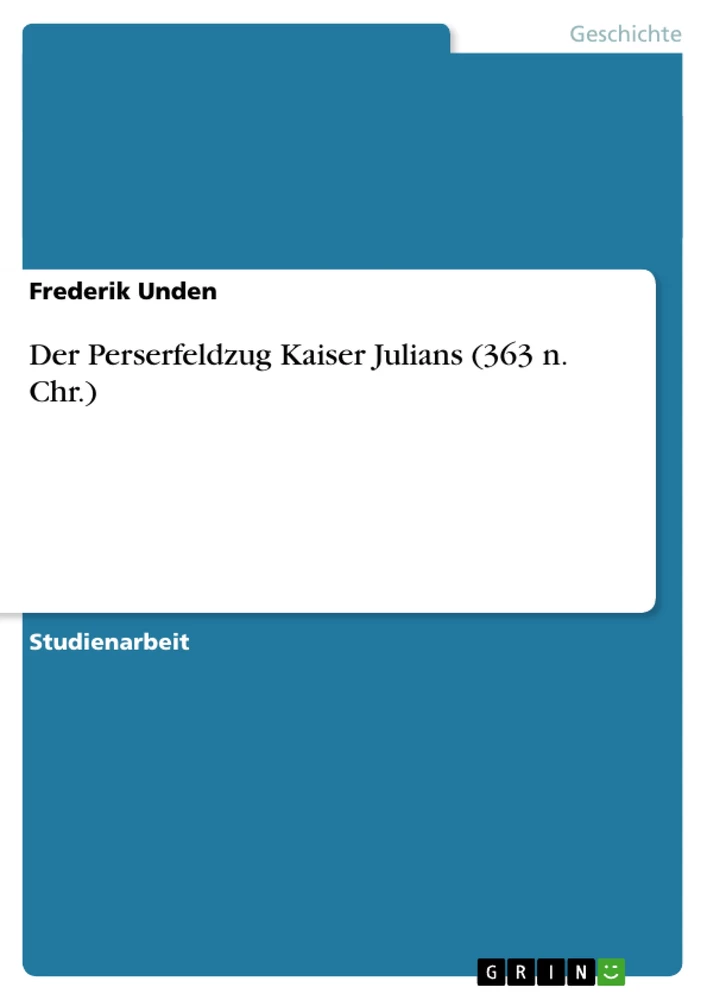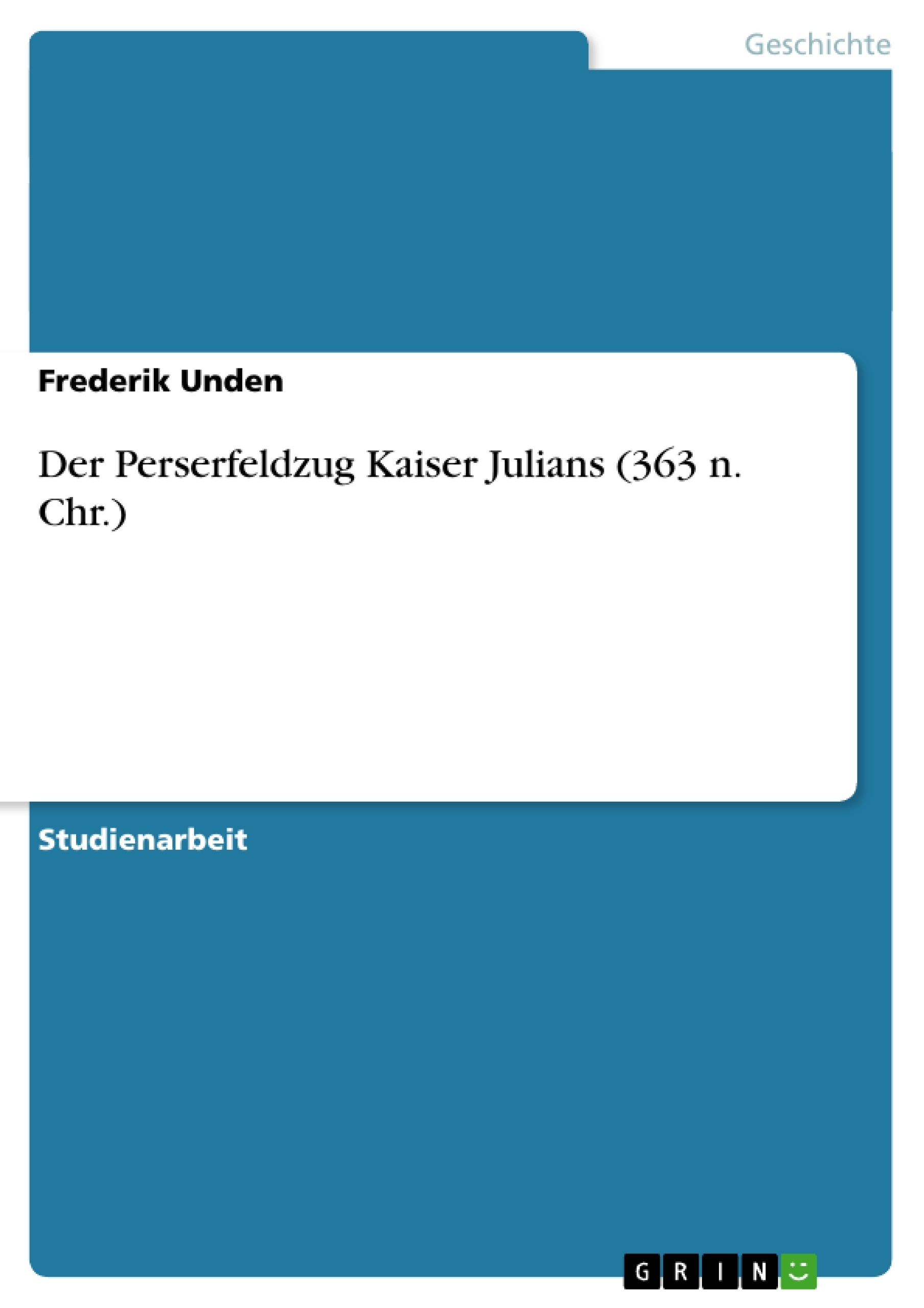Die Auseinandersetzungen zwischen West und Ost, zwischen Okzident und Orient, zwischen
dem römischen Imperium und dem persischen Großreich waren ein Leitmotiv römischer
Geschichte. Das Aufeinandertreffen zweier völlig verschiedenen Kulturen mit
unterschiedlichen Lebensweisen, Religionen, Sprachen und Herrschaftsformen bewirkte eine
tiefe Kluft zwischen diesen beiden, die sich, verstärkt durch Fremdheit und Vorurteilen
gegenüber dem Kontrahenten, häufig in militärischen Konflikten entlud. Zudem stellte sich
dem ernormen ‚Sendungsbewusstsein’ Roms, fremden Völkern die Zivilisation zu bringen,
der tief in der persischen Ideologie verankerte Weltherrschaftsanspruch entgegen. Folglich
waren Konflikte unausweichlich und mit wechselseitigem Erfolg lieferten sich beide Seiten
große Schlachten. Erinnert sei dabei an die Niederlage des Triumvirn M. Licinius Crassus, der
53 v. Chr. vor den Toren Karrhaes zusammen mit etwa 40000 römischen Soldaten den Tod
fand. Keine andere Macht konnte solch große Erfolge gegen die Römer vorweisen, wie die
persische. Auch war es keiner anderen Macht je gelungen, einen römischen Kaiser gefangen
zu nehmen. Dieses unerhörte Ereignis geschah 260 n. Chr. als Šāpūr I. die Römer bei Edessa
besiegte und Kaiser Valerianus in seine Gewalt brachte. 298 n. Chr. konnten die Römer einen
wichtigen Sieg erringen, der zu einem 40 jährigen Friedensvertrag führte. Der am Ende des 3.
Jahrhunderts zustande gekommene Frieden zwischen Rom und dem Sāsānidenreich endete
unter Šāpūr II. (309-397), der die offensive Westpolitik der frühen Sāsānidenkönige
erneuerte. Die gegenüber dem westlichen Gegenspieler erhobenen Ansprüche zielten nicht
nur auf die Wiedergewinnung der 298 verlorenen Gebiete, sondern auf ganz Mesopotamien
und Armenien ab. Julian, der dem eher defensiv eingestellten Constantius II. auf den
Kaiserthron nachfolgte, erneuerte die römische Offensive im Osten, um die Verhältnisse an
der Ostgrenze des römischen Reiches endgültig zu klären.
Im Folgenden soll nun der Perserkrieg Julians, der in antiken Quellen und hier besonders bei
Ammianus Marcellinus’ Augenzeugenbericht viel Beachtung gefunden hat, ausführlich
erläutert werden. Neben einem kurzen Exkurs zum Heerwesen der Sāsāniden, wird
abschließend analysiert, inwiefern der Perserkrieg Julians die mit ihm verbundenen Ziele und
Vorgaben erfüllen konnte und welche Folgen sich für das römische Imperium ergaben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kaiser Julians Kriegsplan und -taktik
3. Offener Widerstand innerhalb der römischen Bevölkerung
4. Kriegsverlauf bis vor die Mauern Ktesiphons
5. Das Heerwesen der Sāsāniden
6. Die unheilvolle Wende
7. Der Friedensvertrag zwischen Jovianus und Šāpūr II
8. Resümee
9. Bibliographie
1. Einleitung
Die Auseinandersetzungen zwischen West und Ost, zwischen Okzident und Orient, zwischen dem römischen Imperium und dem persischen Großreich waren ein Leitmotiv römischer Geschichte. Das Aufeinandertreffen zweier völlig verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Lebensweisen, Religionen, Sprachen und Herrschaftsformen bewirkte eine tiefe Kluft zwischen diesen beiden, die sich, verstärkt durch Fremdheit und Vorurteilen gegenüber dem Kontrahenten, häufig in militärischen Konflikten entlud. Zudem stellte sich dem ernormen ‚Sendungsbewusstsein’ Roms, fremden Völkern die Zivilisation zu bringen, der tief in der persischen Ideologie verankerte Weltherrschaftsanspruch entgegen. Folglich waren Konflikte unausweichlich und mit wechselseitigem Erfolg lieferten sich beide Seiten große Schlachten. Erinnert sei dabei an die Niederlage des Triumvirn M. Licinius Crassus, der 53 v. Chr. vor den Toren Karrhaes zusammen mit etwa 40000 römischen Soldaten den Tod fand. Keine andere Macht konnte solch große Erfolge gegen die Römer vorweisen, wie die persische. Auch war es keiner anderen Macht je gelungen, einen römischen Kaiser gefangen zu nehmen. Dieses unerhörte Ereignis geschah 260 n. Chr. als Šāpūr I. die Römer bei Edessa besiegte und Kaiser Valerianus in seine Gewalt brachte. 298 n. Chr. konnten die Römer einen wichtigen Sieg erringen, der zu einem 40 jährigen Friedensvertrag führte. Der am Ende des 3. Jahrhunderts zustande gekommene Frieden zwischen Rom und dem Sāsānidenreich endete unter Šāpūr II. (309-397), der die offensive Westpolitik der frühen Sāsānidenkönige erneuerte. Die gegenüber dem westlichen Gegenspieler erhobenen Ansprüche zielten nicht nur auf die Wiedergewinnung der 298 verlorenen Gebiete, sondern auf ganz Mesopotamien und Armenien ab. Julian, der dem eher defensiv eingestellten Constantius II. auf den Kaiserthron nachfolgte, erneuerte die römische Offensive im Osten, um die Verhältnisse an der Ostgrenze des römischen Reiches endgültig zu klären.
Im Folgenden soll nun der Perserkrieg Julians, der in antiken Quellen und hier besonders bei Ammianus Marcellinus’ Augenzeugenbericht viel Beachtung gefunden hat, ausführlich erläutert werden. Neben einem kurzen Exkurs zum Heerwesen der Sāsāniden, wird abschließend analysiert, inwiefern der Perserkrieg Julians die mit ihm verbundenen Ziele und Vorgaben erfüllen konnte und welche Folgen sich für das römische Imperium ergaben.
2. Kaiser Julians Kriegsplan und -taktik
Bevor Julian zum Feldzug gegen die Sāsāniden antrat, entwarf er während seines Aufenthalts in Antiochien einen Kriegsplan, der im Vergleich zu seinen Vorgängern erfolgreich verlaufen und nicht in einer Katastrophe enden sollte.
Sein Ziel war es die Hauptstadt des Sāsānidenreiches, Ktesiphon, so schnell wie möglich zu erobern. Wer die alte Hauptstadt der Parther und jetzige Residenz der Sāsāniden am Unterlauf des Tigris besaß, beherrschte auch das südliche Zweistromland bis zum Persischen Golf und mit ihm den Seehandel nach Indien und Arabien herum.[1] Folglich wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis Šāpūrs Heeresmacht endgültig besiegt werden würde.
Der kürzeste Weg an die persische Grenze führte über Edessa und Nisibis und diese Marschroute bot den Vorteil, dass er ein Ausweichen in die nahegelegenen Berge gestattete, in denen die Perser ihrer Hauptwaffe, die Reiterei weniger wirkungsvoll einsetzen konnten als in den Ebenen Mesopotamiens.[2] Da schon Julians Vorgänger, Constantius II., diesen Weg bevorzugte, war davon auszugehen, dass Šāpūr II. mit einem Angriff von Nisibis aus rechnete.
Folglich wollte Julian sein Heer in Karrhae in zwei Teile auftrennen, wobei sich der erheblich kleinere Teil unter Procopius’ und Sebastianus’ Führung auf den Weg nach Nisibis machen sollte, um dort der Hauptstreitkraft Šāpūrs entgegenzutreten bzw. mit den Armeniern vereinigt nach Norden auszuweichen.[3]
Währenddessen wollte Julian mit dem Großteil des Heeres Richtung Süden bis zum Euphrat marschieren, um dort mit Hilfe der eigens aufgebauten ‚Euphratflotte’ schnellstmöglich, dem Fluss folgend, Ktesiphon erreichen und erobern, ehe das Heer Šāpūrs, der unterdessen durch Procopius und Sebastianus im Norden festgehalten wurde, heranrücken konnte.[4] Bemerkte Šāpūr die Täuschung und wandte sich gegen Julian, sollte Procopius und Sebastianus, mit den Armeniern vereint, Šāpūr hinterher ziehen, wodurch das persische Heer im entscheidenden Kampf von zwei Seiten attackiert werden konnte, wie Zosimos berichtet: „[…] to this man [Procopius] Julian, on the grounds of blood-relationship, had entrusted a certain portion of his forces and had given instructions that he march with Sebastianus through Adiabene, and join him as he was going by another route to meet the enemy […]”[5]
Fiel Šāpūr II. oder würde er gefangen genommen, bestand möglicherweise die Absicht seinen älteren, im römischen Exil lebenden, Bruder Hormisdas, auf den sāsānidischen Thron zu setzen.[6]
Um seinen Kriegsplan zu verwirklichen bedurfte es strengster Geheimhaltung, auf die Julian größten Wert legte, wie bei Libanios geschildert wird: „This was as follows: he knew the great advantages of secrecy; the broadcasting of information is valueless, whereas its concealment can be of great assistance; and so he did not reveal the time of his invasion, its proposed route, or his tactics. In fact, he disclosed nothing of what he had in mind, for he was well aware that news once blurted out is picked up by spies.”[7]
3. Offener Widerstand innerhalb der römischen Bevölkerung
Im Gegensatz zu Julians Erwartungen traf der geplante Perserfeldzug auf enormen Widerstand seitens der römischen Bevölkerung. Zahlreiche Truppenkontingente des mobilen römischen Bewegungsheeres wurden in den Osten verlegt, die ursprünglich eigentlich als strategische Reserve für die bedrohten Rhein- und Donaugrenzen vorgesehen waren.[8] Der Westen des römischen Imperiums musste somit fürchten, Ziel neuer Germanenangriffe zu werden. Darüber hinaus zehrte Julians Unternehmen an den ohnehin schon knappen Ressourcen des Reiches, wobei besonders die östlichen Provinzen die Hauptlast tragen mussten, da sie für die Versorgung des Heeres mit Nahrungsmitteln, Waffen und Geld aufkommen mussten.[9] Diese zusätzliche Belastung für die römische Bevölkerung stand zudem in krassem Widerspruch zu Julians Intention die Abgabenlast zu senken und führte letztendlich zu einer heftigen Ablehnung gegen den Feldzug.[10] Verstärkt wurde diese Abneigung durch den öffentlichen Konsens, dass die bisherige defensive Verteidigungsstrategie von Julians Vorgänger, Constantius II., gut gewesen sei und eine Abkehr von dieser nur ins Verderben führe.[11]
Im Westen beeinflussten die Zweifel an einem erfolgreichen Perserkrieg auch die Weissagungen der offiziellen Orakel, die Julian rieten, nicht gegen den Willen der Götter zu handeln.[12] Ammianus berichtet hierzu:
„inter ipsa enim exordia procinctus Parthici disponendi nuntiatum est Constantinopolim terrae pulsu uibratam; quod horum periti minus laetum esse pronuntiabant aliena peruadere molienti rectori ideoque intempestiuo conatu desistere suadebant ita demum haec et similia contemni oportere firmantes, cum irruentibus armis externis lex una sit et perpetua salutem omni ratione defendere nihil remittentem uigoris. isdem diebus nuntiatum est ei per litteras Romae super hoc bello libros Sibyllae consultos, ut iusserat, imperatorem eo anno discedere a limitibus suis aperto prohibuisse responso.”[13]
Zu Julians Enttäuschung riet das erbetene sybillinische Orakel vom bevorstehenden Perserfeldzug ab, doch dies hinderte ihn jedoch nicht daran, die Vorbereitungen zum Krieg unvermindert weiterzubetreiben und seinen Plan in die Wirklichkeit umzusetzen. Die Auslegung von Orakeln und göttlichen Vorzeichen war dehnbar und außerdem gab es in Julians nahem Umfeld genügend Gegenstimmen, die positive Zeichen für einen Feldzug erblickten.[14]
[...]
[1] Vgl. Seeck: Sapor II., RE 49, Stuttgart 1920, Sp. 2344f.
[2] Vgl. ebd.
[3] Vgl. ebd.
[4] Vgl. ebd., Sp. 2345.
[5] Zos. IV, 4.
[6] Vgl. Seeck: Sapor II., Sp. 2345.
[7] Liban. or. XVIII, 213.
[8] Vgl. Klaus Bringmann: Kaiser Julian. Darmstadt 2004, S. 174.
[9] Vgl. ebd.
[10] Vgl. ebd.
[11] Vgl. ebd., S. 175.
[12] Vgl. Gerhard Wirth: Julians Perserkrieg. Kriterien einer Katastrophe. In: Richard Klein (Hrsg.): Julian
Apostata. Wege der Forschung (Bd. 509). Darmstadt 1978, S. 465.
[13] Amm. XXIII, 1, 7.
[14] Vgl. Klaus Rosen: Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser. Stuttgart 2006, S. 332.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel von Kaiser Julians Perserfeldzug im Jahr 363 n. Chr.?
Julian wollte die Verhältnisse an der Ostgrenze endgültig klären, indem er die sassanidische Hauptstadt Ktesiphon eroberte und möglicherweise den persischen König Šāpūr II. stürzte.
Welche Taktik verfolgte Julian bei seinem Angriff?
Er täuschte einen Angriff im Norden vor, während er mit der Hauptstreitkraft und einer Euphratflotte überraschend nach Süden Richtung Ktesiphon vorstieß. Er legte dabei größten Wert auf Geheimhaltung.
Warum gab es Widerstand innerhalb der römischen Bevölkerung gegen den Krieg?
Der Feldzug entzog den Grenzen an Rhein und Donau Truppen, belastete die östlichen Provinzen finanziell massiv und widersprach der bisherigen erfolgreichen Verteidigungsstrategie seines Vorgängers.
Welche Rolle spielten Orakel und Weissagungen für Julian?
Obwohl offizielle Orakel und sybillinische Bücher vor dem Krieg warnten, ignorierte Julian diese Zeichen oder ließ sie von seinem Umfeld positiv umdeuten, um seinen Plan weiterzuverfolgen.
Wie endete der Feldzug und welche Folgen hatte er für Rom?
Der Feldzug endete in einer Katastrophe: Julian fiel in einer Schlacht, und sein Nachfolger Jovianus musste einen schmachvollen Friedensvertrag unterzeichnen, der Gebietsabtretungen an die Perser vorsah.
- Citar trabajo
- Frederik Unden (Autor), 2008, Der Perserfeldzug Kaiser Julians (363 n. Chr.), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136181