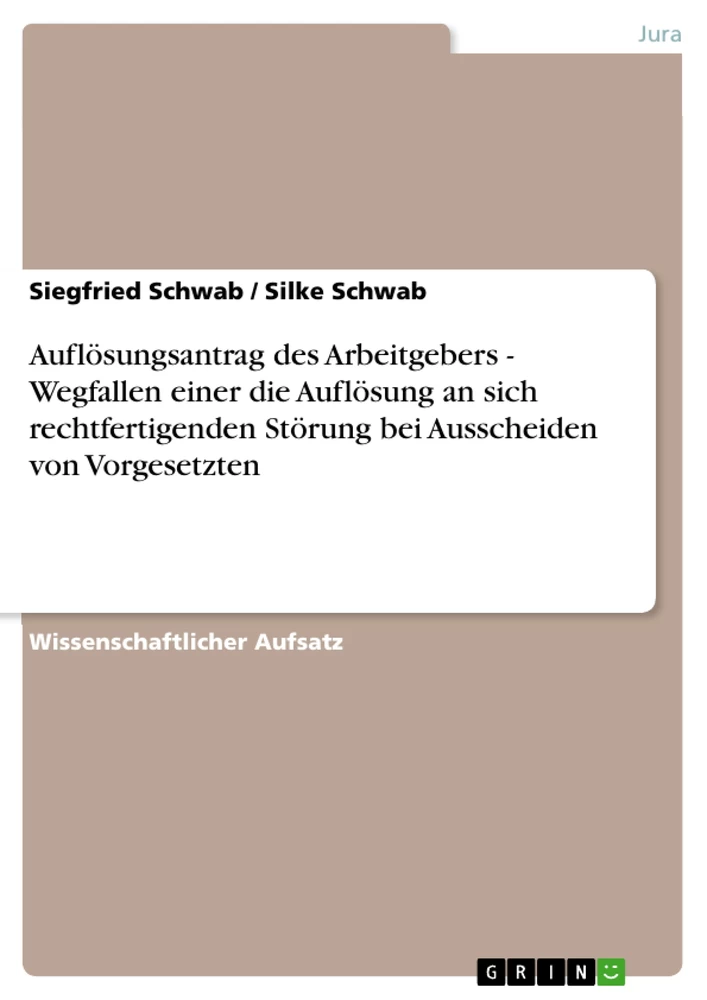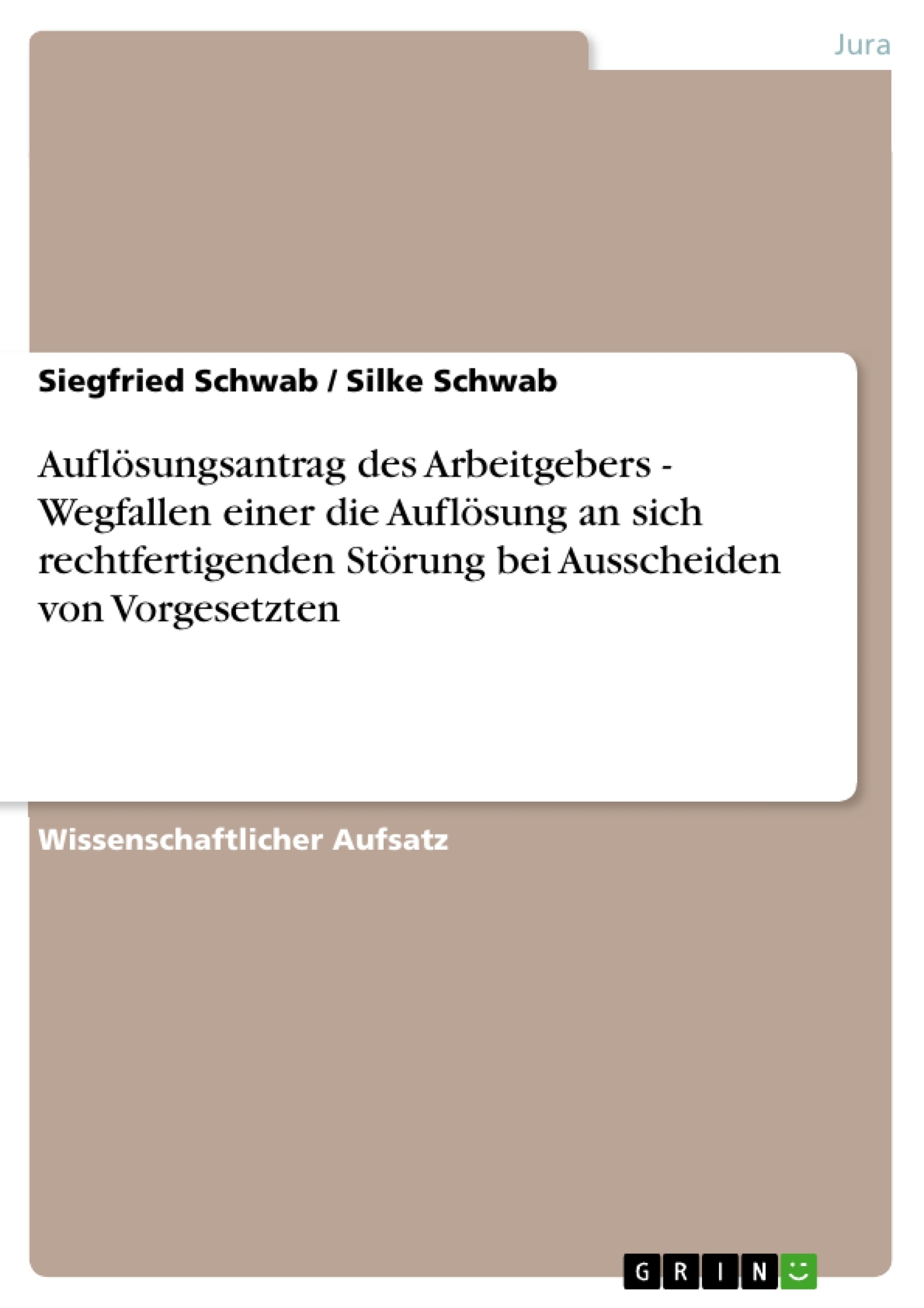§ 9 KSchG ersetzt die fehlende soziale Rechtfertigung der Kündigung. Der ArbG hat bei gerichtlicher Auflösung eine angemessene Abfindung an den ArbG zu bezahlen. Diese ist ein vermögensrechtliches Äquivalent für den Verlust des Arbeitsplatzes. Sie hat primär keinen Entgeltcharakter. Die Abfindung und Abfindungszahlung hat eine nicht zu unterschätzende Präventivfunktion. Dadurch soll der ArbG davon abgehalten werden, „leichtfertig“ eine Kündigung auszusprechen. Entgeltcharakter hat die Abfindung, soweit das Arbeitsverhältnis durch die gerichtliche Entscheidung früher aufgelöst wurde als es durch eine wirksame Kündigung aufgelöst würde. Z.B. bei einer unwirksamen außerordentlichen Kündigung mit dem Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung. Bei einer außerordentlichen Kündigung mit Auslauffrist am letzten Tag der Frist.
Als Prozesshandlung ist die Stellung des Auflösungsantrags grundsätzlich bedingungsfeindlich. Sie kann aber von innerprozessualen Bedingungen abhängig gemacht werden, z. B. der ArbN stellt den Auflösungsantrag für den Fall, dass er mit seiner Kündigungsklage obsiegt, d. h. die Kündigung sozialwidrig ist.
Dies zeigt sich darin, dass nach § 9 Abs. 1 S. 3 in den Fällen einer sozialwidrigen ordentlichen Kündigung beide Arbeitsvertragsparteien bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz den Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses unabhängig von einer vorherigen Einwilligung des Prozessgegners oder einer Zulassung des Gerichts wegen Sachdienlichkeit im Sinne des § 263 ZPO stellen können. Die Entscheidung der Arbeitsvertragsparteien über ihr Auflösungsbegehren unterliegt keinerlei prozessualen Beschränkungen.
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer ordentlichen, auf betriebsbedingte Gründe gestützten Kündigung sowie über einen Auflösungsantrag der beklagten Arbeitgeberin. Der Kläger hat beantragt, festzustellen, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis aufgrund Arbeitgeberkündigung vom 30. Juli 2003 nicht aufgelöst wird, sondern unverändert fortbesteht.
Aufgrund der prozessualen Äußerungen des ArbN bzw. dessen Vertreters beantragte die Beklagte, die Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Den Äußerungen des Klägers sei deutlich zu entnehmen, dass er keinerlei Respekt vor dem Management der Beklagten und ihren Vertriebsleitern habe. Darüber hinaus stellten die zunächst wahrheitswidrigen Behauptungen des Klägers in der Klageschrift zum Zugang der Kündigung einen versuchten Prozessbetrug dar.
Inhaltsverzeichnis
- Auflösungsantrag des Arbeitgebers
- Zulässig nur bei vorausgegangener ordentlicher Kündigung
- Antragsberechtigt sind nur der Kläger oder der Beklagte
- Als Prozesshandlung ist die Stellung des Auflösungsantrags grundsätzlich bedingungsfeindlich
- Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage
- Nach der Grundkonzeption des Kündigungsschutzgesetzes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Auflösungsantrag des Arbeitgebers im deutschen Kündigungsschutzrecht. Sie analysiert die Zulässigkeit, die Antragsberechtigung und die prozessualen Aspekte dieses Antrags, insbesondere im Kontext einer ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung. Die Arbeit beleuchtet auch die Bedeutung der Vertrauensgrundlage und die Anforderungen an die Auflösungsgründe.
- Zulässigkeit des Auflösungsantrags des Arbeitgebers
- Antragsberechtigung und prozessuale Aspekte
- Bedeutung der Vertrauensgrundlage für die weitere Zusammenarbeit
- Anforderungen an die Auflösungsgründe
- Der Auflösungsantrag im Kontext der Sozialwidrigkeit der Kündigung
Zusammenfassung der Kapitel
Auflösungsantrag des Arbeitgebers: Der Text beginnt mit einer Einleitung zum Thema Auflösungsantrag des Arbeitgebers im Kontext eines Kündigungsschutzprozesses. Er stellt die Ausgangssituation dar, in der ein Arbeitnehmer gegen eine Kündigung klagt und der Arbeitgeber hilfsweise die Auflösung des Arbeitsverhältnisses beantragt. Der Text unterstreicht die Bedeutung des Kontextes – nämlich dass der Antrag auf Auflösung nur in Verbindung mit einer bereits ausgesprochenen Kündigung zulässig ist.
Zulässig nur bei vorausgegangener ordentlicher Kündigung: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit der Zulässigkeit des Auflösungsantrags. Es wird betont, dass ein solcher Antrag im Regelfall nur nach einer ordentlichen Kündigung zulässig ist und nicht nach einer außerordentlichen Kündigung. Ausnahmen werden diskutiert, etwa wenn eine ordentliche Kündigung vorsorglich ausgesprochen wurde oder eine Umdeutung der außerordentlichen Kündigung in eine ordentliche zulässig ist. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) wird eingehend zitiert und analysiert, um die rechtlichen Grundlagen zu verdeutlichen.
Antragsberechtigt sind nur der Kläger oder der Beklagte: Dieses Kapitel legt dar, wer antragsberechtigt ist. Es wird klargestellt, dass nur der Kläger (Arbeitnehmer) oder der Beklagte (Arbeitgeber) einen Auflösungsantrag stellen kann. Das Gericht kann nicht von Amts wegen die Auflösung des Arbeitsverhältnisses vornehmen, sondern entscheidet nur über die Zulässigkeit und Berechtigung des Antrags. Die unterschiedlichen juristischen Ansätze und die Auslegung des Antrags im Prozess werden erläutert.
Als Prozesshandlung ist die Stellung des Auflösungsantrags grundsätzlich bedingungsfeindlich: Hier wird die prozessuale Natur des Auflösungsantrags beleuchtet. Obwohl grundsätzlich bedingungsfeindlich, kann der Antrag von innerprozessualen Bedingungen abhängig gemacht werden, wie z.B. vom Ausgang der Kündigungsschutzklage. Der Zeitpunkt der Antragstellung und die Möglichkeit der Rücknahme des Antrags werden ausführlich behandelt, ebenso die Rechtsprechung des BAG zu diesem Thema. Der Text beleuchtet die Auslegungsmöglichkeiten des Antrags und die Bedeutung der Einlassung der Parteien zur Abfindungshöhe.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage: Dieses Kapitel befasst sich mit dem maßgeblichen Zeitpunkt für die Beurteilung der Auflösungsgründe. Es wird deutlich gemacht, dass der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz entscheidend ist. Ein zwischenzeitlicher Wandel der betrieblichen Verhältnisse, z.B. ein Wechsel des Vorgesetzten, kann berücksichtigt werden. Die Rechtsprechung wird herangezogen um die komplexen Aspekte dieses Themas zu erläutern.
Nach der Grundkonzeption des Kündigungsschutzgesetzes: Abschließend wird die Grundkonzeption des Kündigungsschutzgesetzes in Bezug auf den Auflösungsantrag erläutert. Es wird die Priorität des Bestandsschutzes betont und die Ausnahmefunktion des Auflösungsantrags hervorgehoben. Die strengen Anforderungen an die Auflösungsgründe werden dargelegt und die Rolle zusätzlicher Spannungen während eines Kündigungsschutzprozesses im Zusammenhang mit der Zulässigkeit des Antrags diskutiert. Die Rechtsprechung des BAG wird umfassend analysiert um die Argumentation zu stützen.
Schlüsselwörter
Auflösungsantrag, Kündigungsschutzgesetz, Kündigungsschutzklage, ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung, Sozialwidrigkeit, Vertrauensverhältnis, Abfindung, Prozesshandlung, Bundesarbeitsgericht (BAG).
Häufig gestellte Fragen zum Auflösungsantrag des Arbeitgebers im Kündigungsschutzrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Auflösungsantrag des Arbeitgebers im deutschen Kündigungsschutzrecht. Sie analysiert dessen Zulässigkeit, Antragsberechtigung und prozessuale Aspekte, insbesondere im Kontext ordentlicher und außerordentlicher Kündigungen. Die Bedeutung der Vertrauensgrundlage und die Anforderungen an die Auflösungsgründe werden ebenfalls beleuchtet.
Wann ist ein Auflösungsantrag des Arbeitgebers zulässig?
Ein Auflösungsantrag des Arbeitgebers ist in der Regel nur nach einer ordentlichen Kündigung zulässig, nicht nach einer außerordentlichen Kündigung. Ausnahmen sind möglich, z.B. bei einer vorsorglich ausgesprochenen ordentlichen Kündigung oder einer Umdeutung der außerordentlichen Kündigung in eine ordentliche Kündigung. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist maßgeblich für die Beurteilung der Zulässigkeit.
Wer ist antragsberechtigt?
Antragsberechtigt ist ausschließlich der Kläger (Arbeitnehmer) oder der Beklagte (Arbeitgeber). Das Gericht kann die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht von Amts wegen anordnen, sondern entscheidet lediglich über die Zulässigkeit und Berechtigung des Antrags.
Welche prozessuale Bedeutung hat der Auflösungsantrag?
Der Auflösungsantrag ist grundsätzlich eine bedingungsfeindliche Prozesshandlung. Er kann jedoch von innerprozessualen Bedingungen abhängig gemacht werden, z.B. vom Ausgang der Kündigungsschutzklage. Zeitpunkt der Antragstellung, Rücknahmemöglichkeit und die Rechtsprechung des BAG dazu sind wichtige Aspekte. Die Auslegungsmöglichkeiten des Antrags und die Bedeutung der Einlassung der Parteien zur Abfindungshöhe spielen ebenfalls eine Rolle.
Wann ist der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Auflösungsgründe?
Maßgeblich für die Beurteilung der Auflösungsgründe ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz. Ein zwischenzeitlicher Wandel der betrieblichen Verhältnisse kann jedoch berücksichtigt werden. Die Rechtsprechung des BAG bietet hier wichtige Orientierung.
Welche Rolle spielt das Kündigungsschutzgesetz?
Das Kündigungsschutzgesetz betont den Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses. Der Auflösungsantrag stellt eine Ausnahme dar und unterliegt strengen Anforderungen an die Auflösungsgründe. Zusätzliche Spannungen während des Kündigungsschutzprozesses können die Zulässigkeit des Antrags beeinflussen. Die Rechtsprechung des BAG ist hier entscheidend.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thematik?
Die zentralen Schlüsselwörter sind: Auflösungsantrag, Kündigungsschutzgesetz, Kündigungsschutzklage, ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung, Sozialwidrigkeit, Vertrauensverhältnis, Abfindung, Prozesshandlung, Bundesarbeitsgericht (BAG).
- Citation du texte
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Auteur), Dipl.-Betriebswirtin (BA) Silke Schwab (Auteur), 2009, Auflösungsantrag des Arbeitgebers - Wegfallen einer die Auflösung an sich rechtfertigenden Störung bei Ausscheiden von Vorgesetzten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136256