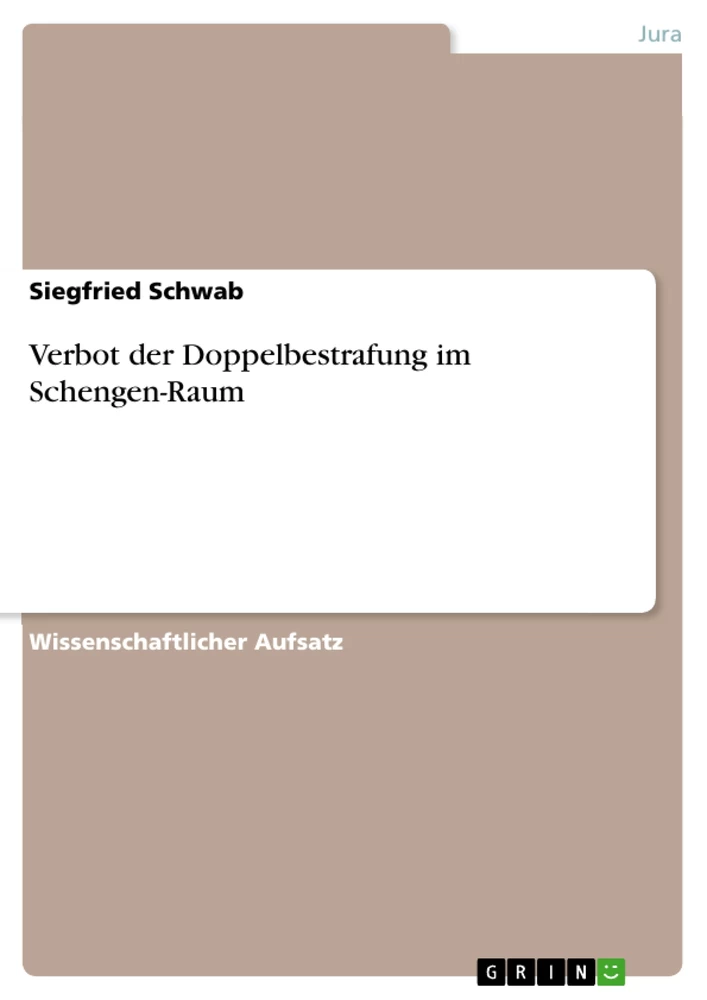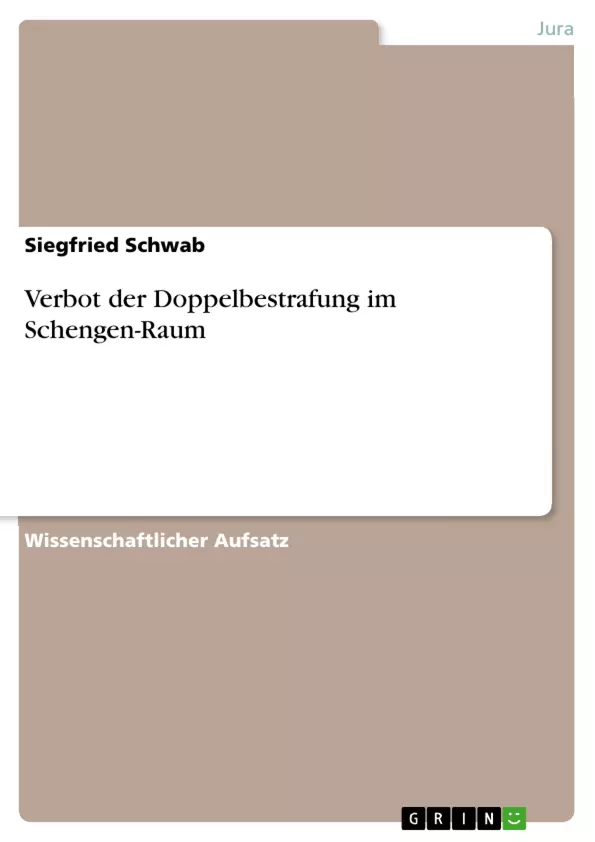Das Verbot der doppelten Verurteilung wegen derselben Tat gilt auch im Fall einer Verurteilung, die nie unmittelbar vollstreckt werden konnte. Damit soll vermieden werden, dass eine Person auf Grund des Umstands, dass sie ihr Recht auf Freizügigkeit ausübt, wegen derselben Tat im Hoheitsgebiet mehrerer Vertragsstaaten verfolgt wird.
Vertragspartner des in der luxemburgischen Stadt Schengen am 19. Juni 1990 (Inkrafttreten am 26. März 1995) unterzeichneten Übereinkommens waren zunächst die Benelux-Länder, Deutschland und Frankreich. Dem Übereinkommen sind später Italien (1990), Portugal und Spanien (1991), Griechenland (1992), Österreich (1995) sowie 1996 die nordischen Staaten Dänemark, Finnland und Schweden beigetreten. Diese drei Länder waren bereits Mitglieder der sog. Nordischen Passunion. Der Erhalt der Freizügigkeit im Bereich der Nordischen Passunion machte es notwendig, dass alle Schengen-Staaten mit den restlichen Staaten der Nordischen Passunion, Norwegen und Island, ein Kooperationsabkommen abschließen.
Neben den Nicht-EU-Staaten Norwegen und Island hat nun auch die Schweiz anlässlich des Rates der Innen- und Justizminister am 26. Oktober 2004 ein Schengen-Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Die Schweiz hat sich damit verpflichtet, den Schengen-Besitzstand vollständig zu übernehmen.
Großbritannien und Irland nehmen nur in eingeschränktem Umfang am Schengener Vertragswerk teil; sie beteiligen sich an den Maßnahmen zur polizeilichen und strafrechtlichen Zusammenarbeit
Verbot der Doppelbestrafung im Schengen-Raum[1]
Das Verbot der doppelten Verurteilung[2] wegen derselben Tat gilt auch im Fall einer Verurteilung, die nie unmittelbar vollstreckt werden konnte. Damit soll vermieden werden, dass eine Person auf Grund des Umstands, dass sie ihr Recht auf Freizügigkeit ausübt, wegen derselben Tat im Hoheitsgebiet mehrerer Vertragsstaaten verfolgt wird.
Klaus Bourquain, ein deutscher Staatsangehöriger, der in der französischen Fremdenlegion diente, wurde 1961 von einem französischen Militärgericht in Algerien erlassenen Urteil wegen Desertion und eines Tötungsdelikts in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Herr Bourquain bei dem Versuch zu desertieren einen anderen Fremdenlegionär deutscher Staatsangehörigkeit, der ihn an der Flucht hindern wollte, erschossen hat. Herr Bourquain, der sich in die DDR absetzte, ist nie vor diesem Gericht erschienen. Nach dem 1961 anwendbaren Militärgerichtsgesetzbuch wäre die Strafe im Fall des Wiederauftauchens von Herrn Bourquain nicht vollstreckt worden, sondern es wäre ein neuer Prozess in seiner Gegenwart eröffnet worden und die eventuelle Verhängung einer Strafe wäre von dessen Ausgang abhängig gewesen. Nach dem Urteil des Militärgerichts wurde gegen Herrn Bourquain weder in Frankreich noch in Algerien ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Im Jahr 2002 erhob die Staatsanwaltschaft Regensburg gegen Herrn Bourquain in Deutschland Anklage wegen der in Algerien begangenen Straftat. Zur Zeit der Einleitung des neuen Prozesses in Deutschland konnte die 1961 verhängte Strafe in Frankreich nicht vollstreckt werden, da sie zum einen verjährt war und das Land zum anderen ein Amnestiegesetz für die Ereignisse in Algerien erlassen hatte.
[...]
[1] EuGH, Urt. v. 11. 12. 2008 – C-297/07 – mit einer Einführung von Prof. Dr. Dr. Siegfried Schwab, Mag. rer. publ.
Vertragspartner des in der luxemburgischen Stadt Schengen am 19. Juni 1990 (Inkrafttreten am 26. März 1995) unterzeichneten Übereinkommens waren zunächst die Benelux-Länder, Deutschland und Frankreich. Dem Übereinkommen sind später Italien (1990), Portugal und Spanien (1991), Griechenland (1992), Österreich (1995) sowie 1996 die nordischen Staaten Dänemark, Finnland und Schweden beigetreten. Diese drei Länder waren bereits Mitglieder der sog. Nordischen Passunion. Der Erhalt der Freizügigkeit im Bereich der Nordischen Passunion machte es notwendig, dass alle Schengen-Staaten mit den restlichen Staaten der Nordischen Passunion, Norwegen und Island, ein Kooperationsabkommen abschließen.
Neben den Nicht-EU-Staaten Norwegen und Island hat nun auch die Schweiz anlässlich des Rates der Innen- und Justizminister am 26. Oktober 2004 ein Schengen-Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Die Schweiz hat sich damit verpflichtet, den Schengen-Besitzstand vollständig zu übernehmen.
Großbritannien und Irland nehmen nur in eingeschränktem Umfang am Schengener Vertragswerk teil; sie beteiligen sich an den Maßnahmen zur polizeilichen und strafrechtlichen Zusammenarbeit.
[2] Ne bis in idem, elementarer Grundsatz des Strafprozessrechts (durch Art. 103 Abs. 3 GG grundrechtsartig geschützt), dass wegen einer Tat, die rechtskräftig abgeurteilt worden ist, nicht noch einmal ein Strafverfahren eingeleitet werden kann (bei öffentlich Bediensteten sind ggf. zusätzliche disziplinarische Maßnahmen möglich). Auch ein rechtskräftig Freigesprochener darf nicht in einem anderen Verfahren wegen derselben Tat verurteilt werden. In seltenen Ausnahmefällen ist eine Wiederaufnahme des Verfahrens (§§ 359 ff.) zulässig, Duden Recht A-Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf. 1. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2007. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2007. Teilweise wird in der Literatur und Rechtsprechung angenommen, der Grundsatz „ne bis in idem gelte nur bei inländischen Verurteilungen.. Dem kann nicht gefolgt werden. Art. 103 Abs. 3 GG folgt aus der grundgesetzlich anerkannten Freiheit und Würde des Menschen. Dieser Grundsatz wird verletzt, wenn nach Aburteilung in einem rechtsstaatlichen Verfahren – wie in Belgien – die erneute Verwicklung in ein Strafverfahren möglich ist. Art 103 Abs 3 GG verbietet die mehrfache Bestrafung wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze. Dieses Prozessgrundrecht gibt dem Bürger die Garantie, nach einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung in derselben Sache nicht erneut strafrechtlich belangt zu werden, es gewährleistet sozusagen eine gewisse Rechtssicherheit des Einzelnen, Radtke, in Epping/Hillgruber, Beck'scher Online-Kommentar, Art. 103 RN 43. Das Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung bildet damit ein verfassungsrechtlich garantiertes Prozesshindernis (vgl v.Münch/Kunig/Kunig GG Art 103 Rn 36; Dreier/Schulze-Fielitz GG Art 103 Abs 3 Rn 15). Entscheidungen, die ein solches Prozesshindernis bilden, sind zunächst Urteile verurteilender oder freisprechender Art (Sachurteile), die (einst umstrittene) Sperrwirkung von Strafbefehlen ist in § 373 a StPO normiert (vgl. BVerfGE 65, 377, 382 f = NJW 1984, 604; v.Münch/Kunig/Kunig GG Art 103 RN 46). Maßgebend ist, dass durch die vorliegende Entscheidung ein Mindestmaß an Klärung hinsichtlich des staatlichen Strafanspruchs durch das Gericht erfolgt ist. Schwierigkeiten bei der Anwendung des Art 103 Abs 3 GG ergeben sich bei der Bestimmung des Begriffs „ dieselbe Tat“, weil kein originärer verfassungsrechtlicher Tatbegriff existiert. einen „geschichtlichen Vorgang, auf welchen Anklage und Eröffnungsbeschluss hinweisen und innerhalb dessen der Angeklagte als Täter oder Teilnehmer einen Straftatbestand verwirklicht haben soll“ (BVerfGE 23, 191, 202; BVerfGE 45, 434; BVerfGE 56, 22, 28; BVerfG v 16.3.2006 – 2 BvR 111/06 = BeckRS 2006 22726 - „Tat“ i.S. des Art. 103 III GG ist danach der geschichtliche - und damit zeitlich und sachverhaltlich begrenzte - Vorgang, auf welchen Anklage und Eröffnungsbeschluss hinweisen und innerhalb dessen der Angeklagte als Täter oder Teilnehmer einen Straftatbestand verwirklicht haben soll. Ob verschiedene Urteile dieselbe Tat i.S. des Art. 103 III GG betreffen, ist unabhängig von dem Begriff der Tateinheit (§ 52 StGB) zu beurteilen (vgl. BVerfGE 45, 434 <435>), weil die Rechtsfiguren der Tateinheit (§ 52 StGB) und der Tatidentität (Art. 103 III GG) verschiedene Zwecke verfolgen (vgl. BVerfGE 56, 22 <30 f.>). Ein durch den Rechtsbegriff der Tateinheit (§ 52 StGB) zusammengefasster Sachverhalt wird jedoch in der Regel auch verfassungsrechtlich eine einheitliche prozessuale Tat darstellen (Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 11. 1. 2005 - 2 BvR 2125/04 -, juris). Umgekehrt bilden mehrere i.S. von § 53 StGB sachlich-rechtlich selbständige Handlungen grundsätzlich nur dann eine einheitliche prozessuale Tat, wenn die einzelnen Handlungen nicht nur äußerlich ineinander übergehen, sondern wegen der ihnen zugrunde liegenden Vorkommnisse unter Berücksichtigung ihrer strafrechtlichen Bedeutung auch innerlich derart miteinander verknüpft sind, dass der Unrechts- und Schuldgehalt der einen Handlung nicht ohne die Umstände, die zu der anderen Handlung geführt haben, richtig gewürdigt werden kann und ihre getrennte Würdigung und Aburteilung als unnatürliche Aufspaltung eines einheitlichen Lebensvorgangs empfunden würde). Die Definition ist nicht identisch mit dem strafprozessualen Tatbegriff der §§ 155, 264 StPO (BVerfGE 56, 22, 34 f = NJW 1981, 1433)
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Verbot der Doppelbestrafung (Ne bis in idem)?
Es ist ein elementarer Grundsatz, dass niemand wegen derselben Tat, die bereits rechtskräftig abgeurteilt wurde, erneut strafrechtlich verfolgt werden darf. Dies gilt im Schengen-Raum auch grenzüberschreitend.
Gilt das Verbot auch, wenn eine Strafe nie vollstreckt wurde?
Ja, laut EuGH-Urteil gilt das Verbot der doppelten Verurteilung auch dann, wenn die ursprüngliche Strafe (z.B. wegen Verjährung oder Amnestie) nie unmittelbar vollstreckt werden konnte.
Welche Länder gehören zum Schengen-Raum?
Ursprünglich waren es die Benelux-Länder, Deutschland und Frankreich. Später kamen u.a. Italien, Spanien, Österreich, die nordischen Staaten sowie assoziierte Mitglieder wie Norwegen, Island und die Schweiz hinzu.
Was ist eine "prozessuale Tat" im Sinne des Art. 103 Abs. 3 GG?
Eine Tat ist ein geschichtlicher, zeitlich und sachverhaltlich begrenzter Vorgang. Ob es sich um "dieselbe Tat" handelt, wird unabhängig von der rein rechtlichen Tateinheit (§ 52 StGB) beurteilt.
Nehmen Großbritannien und Irland voll am Schengen-Abkommen teil?
Nein, sie nehmen nur in eingeschränktem Umfang teil, primär an den Maßnahmen zur polizeilichen und strafrechtlichen Zusammenarbeit.
- Citation du texte
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Auteur), 2009, Verbot der Doppelbestrafung im Schengen-Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136260