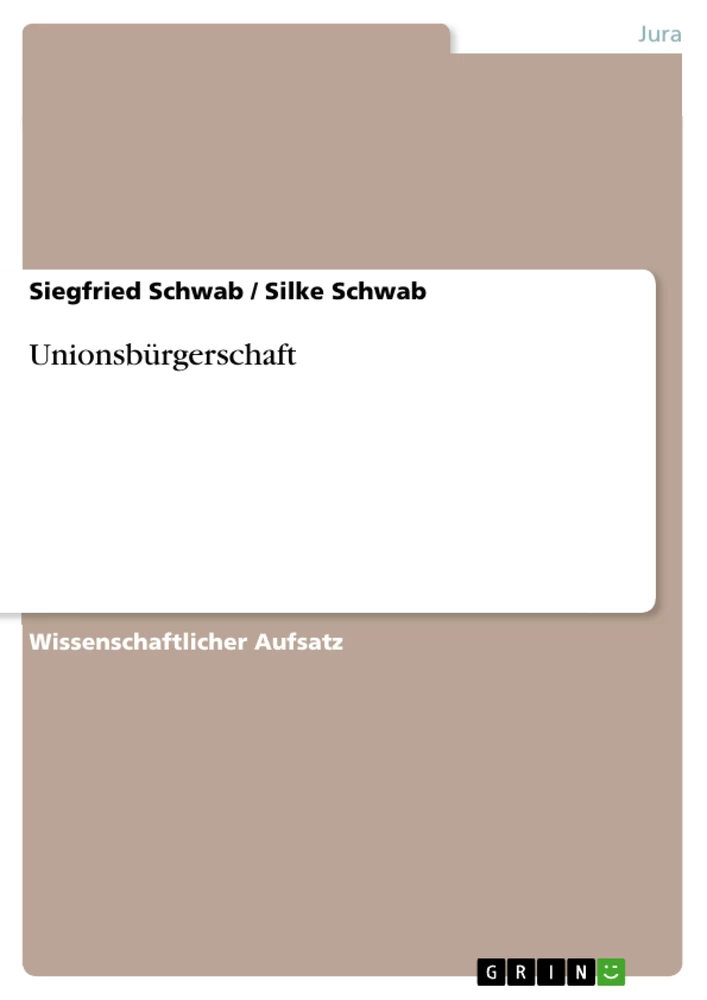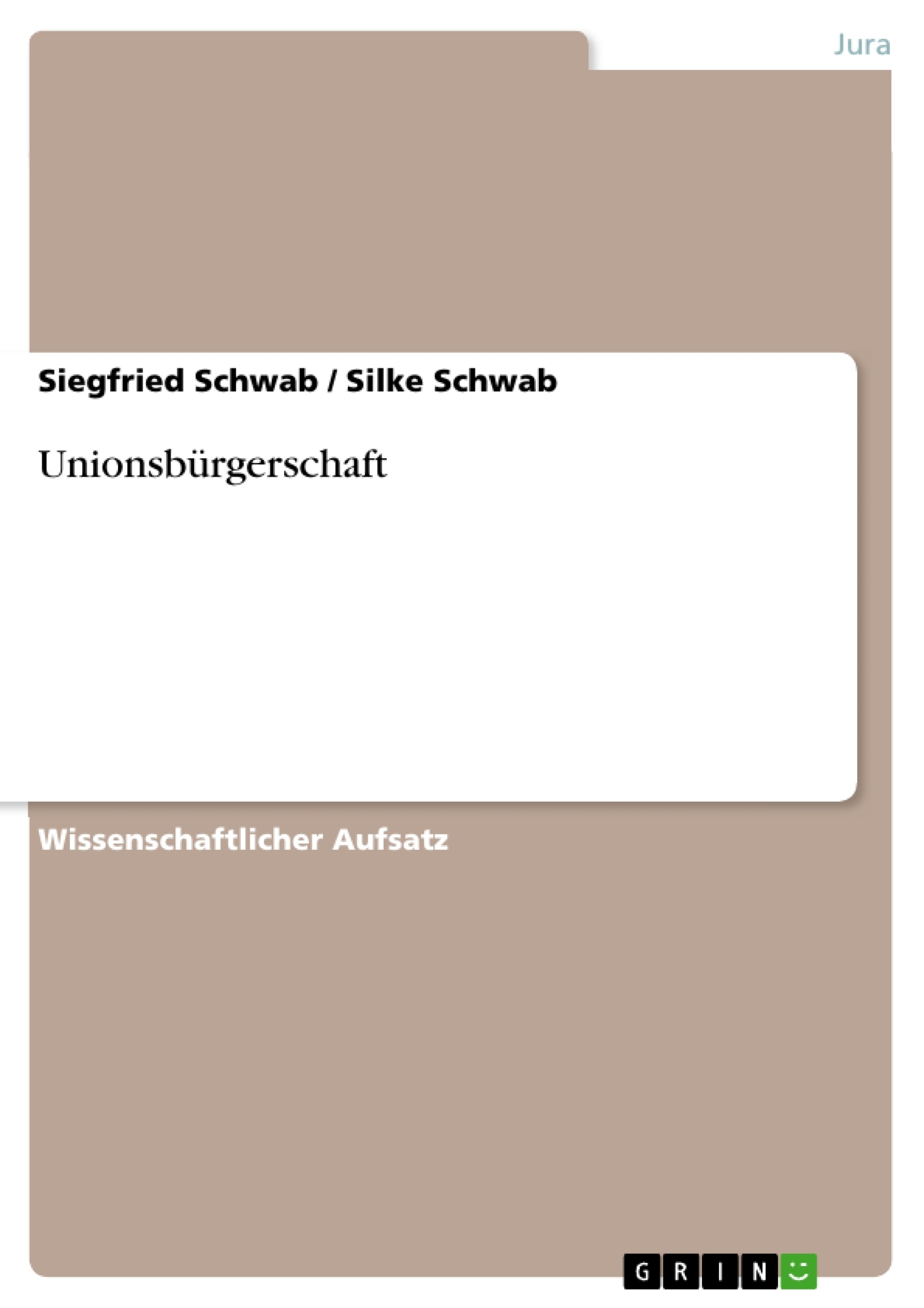Der Raum der Freiheit, der Sicherheit im Rahmen einer liberalisierten Ordnungspolitik und des Rechts zur inneren Liberalisierung und Aufhebung der Binnengrenzen ist größer geworden, Nettesheim, Grundrechtskonzeption des EuGH. Mit der EU Grundrechtscharta wird die Hoffnung auf einen weiter verbesserten Grundrechtsschutz gegen Akte der EU verbunden. Zahlreiche Artikel sind den EMRK Garantien nachgebildet. Art. 52 Abs. 3 GrCh regelt den Einfluss der EMRK im Recht der Charta querschnittartig. Der Vertrag von Lissabon greift die Neubestimmung der Grundlagen und des System des Grundrechtsschutzes neu auf. Die Grundrechte verstärken die marktrechtlichen Grundfreiheiten im Sinne eines verschärften Rechtfertigungszwangs für beabsichtigte Beschränkungen. Sie sichern damit individuelle Freiräume. Gleichzeitig können sie aber auch Rechtfertigungsstandards für Einschränkungen der Marktfreiheiten bilden, vgl. Skouris, Das Verhältnis von Grundfreiheiten und Grundstrukturen im Gemeinschaftsrecht. Diese Marktfreiheiten (freier Verkehr von Waren und Personen, Dienstleistungen und Kapital) sind Stützpfeiler des Binnenmarktes. Sie haben eine gemeinsame Struktur als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot. Für alle gilt ein vierstufiger Rechtfertigungsstandard:
1. sie müssen in nicht diskriminierender Weise angewandt werden
2. sie müssen aus Gründen der Allgemeinheit gerechtfertigt sein
3. sie müssen geeignet sein
4. sie müssen erforderlich und angemessen sein.
5. Schließlich muss ein gemeinschaftsrechtlich anerkannter Belang vorliegen.
In Bezug auf das Recht der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, die auf Arbeitsuche in einem anderen Mitgliedstaat sind, hat die Prüfung der ersten Frage nichts ergeben, was die Gültigkeit von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/ 38/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/ 68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/ 221/ EWG, 68/ 360/ EWG, 72/ 194/ EWG, 73/ 148/ EWG, 75/ 34/ EWG, 75/ 35/ EWG, 90/ 364/ EWG, 90/ 365/ EWG und 93/ 96/ EWG berühren könnte.
"Unionsbürgerschaft“
Freizügigkeit - Art. 12 EG und 39 EG - Richtlinie 2004/ 38/ EG - Art. 24 Abs. 2 - Gültigkeitsprüfung - Staatsangehörige eines Mitgliedstaats - Berufstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat - Höhe des Entgelts und Dauer der Tätigkeit - Aufrechterhaltung der Rechtsstellung eines 'Arbeitnehmers' - Anspruch auf Leistungen für Arbeitsuchende*[1]
1. In Bezug auf das Recht der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, die auf Arbeitsuche in einem anderen Mitgliedstaat sind, hat die Prüfung der ersten Frage nichts ergeben, was die Gültigkeit von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/ 38/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/ 68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/ 221/ EWG, 68/ 360/ EWG, 72/ 194/ EWG, 73/ 148/ EWG, 75/ 34/ EWG, 75/ 35/ EWG, 90/ 364/ EWG, 90/ 365/ EWG und 93/ 96/ EWG berühren könnte.
2. Art. 12 EG steht einer nationalen Regelung nicht entgegen, die die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten von Sozialhilfeleistungen ausschließt, die Drittstaatsangehörigen gewährt werden.[2]
In den verbundenen Rechtssachen C-22/ 08 und C-23/ 08 betreffend Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Sozialgericht Nürnberg (Deutschland) mit Entscheidungen vom 18. Dezember 2007, beim Gerichtshof eingegangen am 22. Januar 2008, in den Verfahren Athanasios Vatsouras (C-22/ 08), Josif Koupatantze (C-23/ 08) gegen Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 erlässt DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)
Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung der Art. 12 EG und 39 EG sowie die Gültigkeit von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/ 38/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/ 68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/ 221/ EWG, 68/ 360/ EWG, 72/ 194/ EWG, 73/ 148/ EWG, 75/ 34/ EWG, 75/ 35/ EWG, 90/ 364/ EWG, 90/ 365/ EWG und 93/ 96/ EWG (ABl. L 158, S. 77 und - Berichtigungen - ABl. 2004, L 229, S. 35, L 197, S. 34, sowie ABl. 2007, L 204, S. 28).[3]
* Mit vertiefenden Ergänzungen und Erläuterungen von Prof. Dr. Dr. Siegfried Schwab, Mag. rer. publ. unter Mitarbeit von Diplom-Betriebswirtin (BA) Silke Schwab.
Der Raum der Freiheit, der Sicherheit im Rahmen einer liberalisierten Ordnungspolitik und des Rechts zur inneren Liberalisierung und Aufhebung der Binnengrenzen ist größer geworden, Nettesheim, Grundrechtskonzeption des EuGH, EuR 2009, Heft 1 024ff. Nettesheim spricht von einer „Enträumlichung der Macht“; gerade sie macht es aber notwendig zur Schaffung und Gewährleistung eines Integrationsverbundes und zur Sicherstellung von Legitimität[1] (vgl. Luhmann, Legitimation durch Verfahren, „Recht ist was Recht ist“ - Luhmann verband das gegenwärtige Recht mit der funktional differenzierten Gesellschaft. Recht in der modernen, komplexen Gesellschaft "auf sich selbst gestellt“ – und dennoch soll es Rechtsstaatlichkeit sichern). Mit der EU Grundrechtscharta wird die Hoffnung auf einen weiter verbesserten Grundrechtsschutz gegen Akte der EU verbunden, vgl. Schmahl, Grundrechtsschutz im Dreieck von EU, EMRK und nationalem Verfassungsrecht, EuR 2008, Beiheft 1, 007. Zahlreiche Artikel sind den EMRK Garantien nachgebildet. Art. 52 Abs. 3 GrCh regelt den Einfluss der EMRK im Recht der Charta querschnittartig. Der Vertrag von Lissabon greift die Neubestimmung der Grundlagen und des System des Grundrechtsschutzes neu auf. Die Grundrechte verstärken die marktrechtlichen Grundfreiheiten im Sinne eines verschärften Rechtfertigungszwangs für beabsichtigte Beschränkungen. Sie sichern damit individuelle Freiräume. Gleichzeitig können sie aber auch Rechtfertigungsstandards für Einschränkungen der Marktfreiheiten bilden, vgl. Skouris, Das Verhältnis von Grundfreiheiten und Grundstrukturen im Gemeinschaftsrecht, DÖV 2006, 89ff. Diese Marktfreiheiten (freier Verkehr von Waren und Personen, Dienstleistungen und Kapital) sind Stützpfeiler des Binnenmarktes, Art. 14 Abs. 2 EG. Sie haben eine gemeinsame Struktur als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot. Für alle gilt ein vierstufiger Rechtfertigungsstandard, EuGH, RS C – 55/94, Slg. 1995, 4165 RN 37 (Gebhard):
- sie müssen in nicht diskriminierender Weise angewandt werden
- sie müssen aus Gründen der Allgemeinheit gerechtfertigt sein
- sie müssen geeignet sein
- sie müssen erforderlich und angemessen sein.
- Schließlich muss ein gemeinschaftsrechtlich anerkannter Belang vorliegen.
[...]
[1] EuGH, Urteil vom 4. 6. 2009 - C-22/08.
[2] Nach ständiger Rechtsprechung verbietet der Gleichheitssatz nicht nur offensichtliche Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, sondern auch alle versteckten Formen der Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zu dem gleichen Ergebnis führen, vgl. u. a. Urteile vom 12. Februar 1974 in der Rechtssache 152/ 73, Sotgiu, Slg. 1973, 153, RN 11, und vom 15. März 2005 in der Rechtssache C-209/ 03, Bidar, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, RN 51. Eine nationale Regelung die den Bezug von Überbrückungsgelt von den Ort der Schuldbildung abhängig macht, schafft eine unterschiedliche Behandlung von Bürgern, die ihre höhere Schulbildung im Regelungsstaat erhalten haben, und denjenigen, gegenüber denjenigen die sie in einem anderen Mitgliedstaat abgeschlossen haben, da nur die Erstgenannten Anspruch auf Überbrückungsgeld haben. Eine solche Regelung birgt die Gefahr, dass hauptsächlich die Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten benachteiligt werden. Denn da sie die Bewilligung des Überbrückungsgeldes davon abhängig macht, dass der Antragsteller das erforderliche Abschlusszeugnis in Belgien erhalten hat, kann sie von den inländischen Staatsangehörigen leichter erfüllt werden. Eine solche unterschiedliche Behandlung kann nur dann gerechtfertigt werden, wenn sie auf objektiven, von der Staatsangehörigkeit der betroffenen unabhängigen Erwägungen beruht und in einem angemessenen Verhältnis zu dem Zweck steht, der mit den nationalen Rechtsvorschriften zulässigerweise verfolgt wird (Urteile vom 23. Mai 1996 in der Rechtssache C-237/ 94, O'Flynn, Slg. 1996, I-2617, RN 19, und Collins, RN 66. Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, ist es ein legitimes Anliegen des Gesetzgebers, sich einer tatsächlichen Beziehung zwischen demjenigen, der Überbrückungsgeld beantragt, und dem betroffenen räumlichen Arbeitsmarkt vergewissern zu wollen.
[3] Die Erwägungsgründe 1 und 9 der Richtlinie 2004/ 38 haben folgenden Wortlaut:
(1) Die Unionsbürgerschaft verleiht jedem Bürger der Union das elementare und persönliche Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der im Vertrag und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.
(9) Die Unionsbürger sollten das Aufenthaltsrecht im Aufnahmemitgliedstaat für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten haben, ohne jegliche Bedingungen oder Formalitäten außer der Pflicht, im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu sein, unbeschadet einer günstigeren Behandlung für Arbeitsuchende gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs."
4 Art. 6 der Richtlinie 2004/ 38 sieht vor:
"(1) Ein Unionsbürger hat das Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten, wobei er lediglich im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein muss und ansonsten keine weiteren Bedingungen zu erfüllen oder Formalitäten zu erledigen braucht.
(2) Absatz 1 gilt auch für Familienangehörige im Besitz eines gültigen Reisepasses, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen und die den Unionsbürger begleiten oder ihm nachziehen."
Häufig gestellte Fragen
Was beinhaltet das Recht auf Freizügigkeit in der EU?
Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (Richtlinie 2004/38/EG).
Können EU-Bürger von Sozialleistungen ausgeschlossen werden?
Die Richtlinie erlaubt unter bestimmten Bedingungen den Ausschluss von Sozialhilfe während der ersten drei Monate oder während der Arbeitsuche.
Was besagt Art. 12 EG (heute Art. 18 AEUV)?
Er verbietet jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit innerhalb des Anwendungsbereichs der Verträge.
Wann behält man den Status als „Arbeitnehmer“?
Auch bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit kann der Status unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Meldung beim Arbeitsamt) erhalten bleiben.
Was ist der vierstufige Rechtfertigungsstandard des EuGH?
Beschränkungen der Marktfreiheiten müssen nicht diskriminierend, durch Allgemeinwohl gerechtfertigt, geeignet sowie erforderlich und angemessen sein.
- Quote paper
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Author), Dipl.-Betriebswirtin (BA) Silke Schwab (Author), 2009, Unionsbürgerschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136263