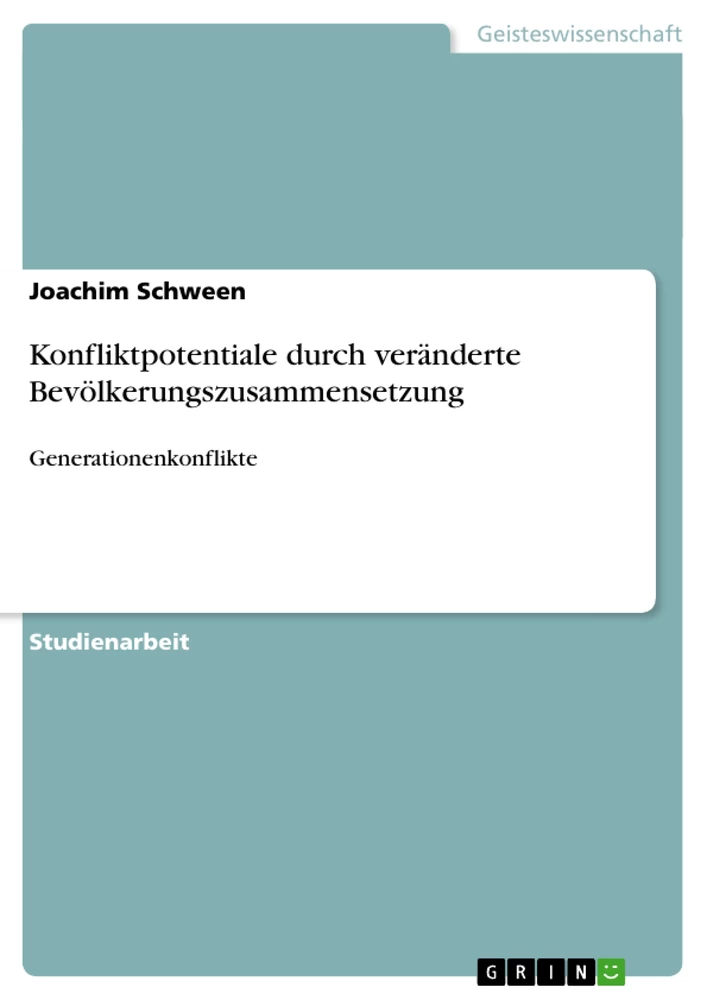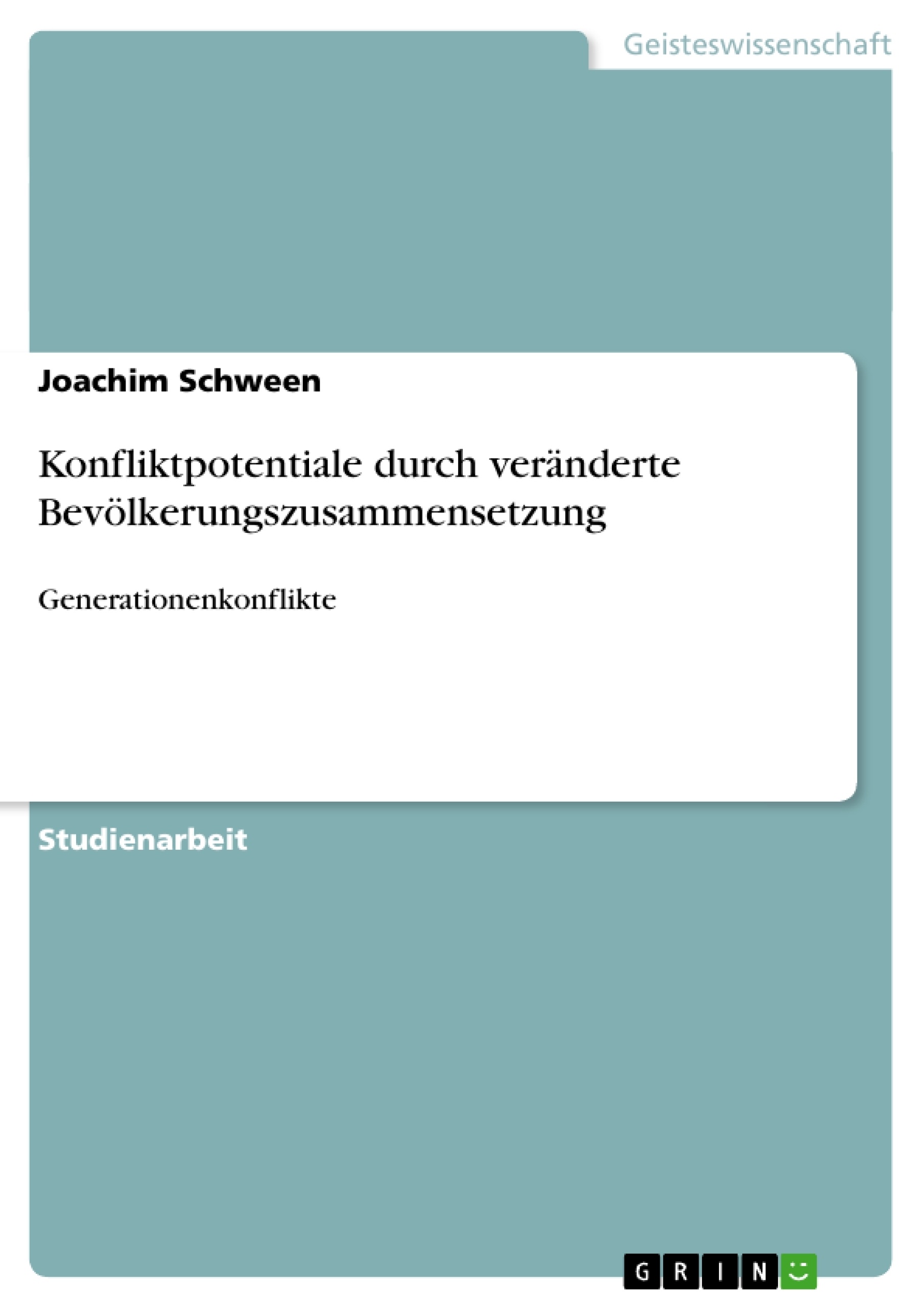Der Anteil der über 65 - Jährigen wird gemäß der von der Bundesregierung durchgeführten Modellberechnung von 10,8 % im Jahr 1960 auf 30,6 % im Jahr 2040 ansteigen. (Grieswelle 2002, S. 38) Der Altenquotient, der das Verhältnis der Personen im Rentenalter zu Personen im erwerbsfähigen Alter angibt, steigt sogar von 17,9 % im Jahre 1960 auf 56,2 % im Jahre 2040 an, weist also einen drastischen Anstieg aus. (Grieswelle 2002, S. 38) Diesem Sachverhalt kann allerdings entgegenhalten werden, dass die Festlegung der dem Altenquotienten zugrundeliegenden Parameter wie z.B. die angenommene Entwicklung von Lebenserwartung und Geburtenrate oder auch die Definition des Erwerbsalters je nach Intention variabel sind und die Intervalle für diese Parameter so festgelegt werden können, dass ein ganz bestimmtes – durch die Wahl geeigneter Intervalle unter Umständen absichtlich herbeigeführtes – Ergebnis für den Altenquotienten dabei herauskommt. So wird der Altenquotient in der Politik häufig als Instrument verwendet, um die sozialen Sicherungssysteme in Frage zu stellen. (Reuter 2004, S. 1, ff.) Außerdem berücksichtigt der Altenquotient weder den Produktivitätsfortschritt noch die Tatsache, dass das Erwerbspersonenpotential nicht gleichzusetzen ist mit der Anzahl der Menschen, die tatsächlich erwerbstätig sind. (Reuter 2004, S. 3)
Andererseits ist die Anzahl der Erwerbstätigen natürlich immer abhängig von der Größe des Erwerbspersonenpotentials, da sie immer nur einen Teil dieses Potentials ausmachen kann. Besorgniserregend mag daher für manchen die Information sein, dass das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (im folgenden: IAB) nach 2010 eine deutliche Verringerung des Erwerbspersonenpotentials in Deutschland prognostiziert, nämlich eine Abnahme von 38,5 Mio. Menschen im Jahr 2010 auf 24,8 Millionen Menschen im Jahr 2040. Dieser Prognosevariante liegt die Annahme zugrunde, dass es in Deutschland keine Zuwanderung geben wird. Ferner wird von gleichbleibender Erwerbsbeteiligung ausgegangen. (Grieswelle 2002, S. 38, f.)
Gliederung
1 Einleitung
2 Tendenzen demografischen Wandels
2.1 Ursachen, Ausmaß und Konsequenzen
2.2 Auswirkungen auf Sozialsysteme und Arbeitsmarkt
3 Verhältnisse der Generationen zueinander
3.1 Generationenbeziehungen in der Gesellschaft
3.2 Familiäre Bindungen und Wohnverhältnisse
3.3 Pflegebedürftigkeit
3.4 Kinderarmut
4 Generationenvertrag im demografischen Wandel
4.1 Soziale Sicherung, Generationenvertrag und deren Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt
4.2 Aktuelle und zukünftige Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Renten-versicherung
4.3 Gerechte Beteiligung der Generationen an der Erwerbsarbeit
4.4 Lösungsansätze
4.5 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Der demografische Wandel und die Frage, wie er sich für die verschiedenen Generationen unserer Gesellschaft auswirken wird, ist ein Thema, dass in den Medien immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei ist festzuhalten, dass die demografische Entwicklung sowohl Chancen als auch Risiken beinhaltet: Als erfreulich kann angesehen werden, dass die Lebenserwartung der Menschen ansteigt, und viele Menschen dadurch die Möglichkeit erhalten, ein langes - und im Idealfall - auch gesundes Leben zu führen. In der öffentlichen Diskussion taucht dieses Thema allerdings eher in Verbindung mit den damit verbundenen Risiken auf: Die Gefährdungen der sozialen Sicherungssysteme, mögliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auch ein erhöhter Pflegebedarf sind Diskussionspunkte mit viel Konfliktpotential, die in diesem Zusammenhang immer wieder aufgegriffen werden, und die im Rahmen dieser Hausarbeit thematisiert werden sollen.
Ein in der Öffentlichkeit ebenfalls viel diskutiertes Thema ist der Generationenvertrag, und die Frage ob das praktizierte Umlageverfahren noch zeitgemäß ist. Schließlich soll neben den Finanzierungsfragen auch das
gesellschaftliche Leben in Familie und Gesellschaft, d.h. das Verhältnis der Generationen zueinander untersucht werden. Es sei noch kurz darauf hingewiesen, dass die Ausführungen weitestgehend auf Deutschland beschränkt sind.
2 Tendenzen demografischen Wandels
2.1 Ursachen, Ausmaß und Konsequenzen
In diesem Kapitel soll darauf eingegangen werden, welche Faktoren den demografischen Wandel in unserer Gesellschaft hervorgerufen haben, welche Ausmaße er bis heute angenommen hat, und welche Auswirkungen er für die Gesellschaft in Zukunft haben wird.
Zunächst ist festzuhalten, dass der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung steigen wird, was im Wesentlichen auf zwei Gründe zurückzuführen ist: Auf die Zunahme der durchschnittlichen Lebenserwartung und auf die Abnahme der Geburtenrate, bzw. ihre Verharrung auf einem niedrigen Niveau. (Grieswelle 2002, S. 36) Als eine der Hauptursachen für die höhere Lebenserwartung ist sicherlich der medizinische Fortschritt zu nennen. Hinzu kommen das Gesundheitsbewusstsein jedes einzelnen und der persönliche Lebensstil z.B. in Bezug auf gesunde Ernährung, sportliche Aktivitäten, und Alkohol– und Nikotinkonsum. Unterschiedliche Lebensstile in Bezug auf diese Punkte erklären auch, warum Frauen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben als Männer. Während Männer zu einem eher risikoreichen Verhalten neigen, tendieren Frauen zu einer gesundheitsbewussteren Lebensweise. (Schinkel 2007, S. 21)
Auch der Entwicklungsstand einer Bevölkerung in Bezug auf die Punkte soziale Sicherheit, Bildung und Umwelt beeinflusst die Lebenserwartung stark, was auch die Unterschiede zwischen den Lebenserwartungen in den Entwicklungsländern und den Industrienationen erklärt. (Schinkel 2007, S. 21)
Schließlich sind als Ursachen für den Anstieg der Lebenserwartung noch die Verringerung der Säuglingssterblichkeit und veränderte Ursachen der Alterssterblichkeit zu nennen. Für den zuletzt genannten Punkt sind heutzutage Kreislauferkrankungen und bösartige Tumorneubildungen maßgeblich, während früher Infektionskrankheiten eine häufige Todesursache war. (Schinkel 2007, S. 21)
Von den vielfältigen Ursachen für eine abnehmende oder stagnierende Geburtenrate sollen hier nur einige genannt werden: Die Aufgeklärtheit der Bevölkerung in den Industrienationen und damit auch das Wissen wie man Geburten verhindern kann, führen dazu, dass eine bewusste Entscheidung für oder gegen den Nachwuchs getroffen werden kann.
Auch ein veränderter Wertewandel in Bezug auf Ehe, Familie und Kinder sowie ein allgemeiner Trend zur Individualisierung und Selbstverwirklichung sind als Ursachen der abnehmenden oder stagnierenden Geburtenrate anzusehen. Nennenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Bildung in unserer Gesellschaft ein höherer Stellenwert beigemessen wird als früher: Eine höhere Bedeutung von Bildung wirkt sich insofern auf die Geburtenrate aus, als das sie mit längeren Ausbildungszeiten einhergeht, was in der Regel zu einem höheren Alter der Frau bei Heirat und Erstgeburt führt. (Schinkel 2007, S. 21)
Um die Ausmaße der demografischen Entwicklung zu veranschaulichen, sind daher die zusammengefasste Geburtenziffer und die Nettoreproduktionsziffer (im Folgenden: NRZ) als aussagefähige Kennzahlen heranzuführen.
Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt an, wie viele Kinder im Durchschnitt von gebärfähigen Frauen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes geboren werden. Diese ergibt sich für ein Kalenderjahr aus der Summe der altersspezifischen Geburtenziffern aller Frauen zwischen 15 und 50 Jahre. Sie stagniert in Westdeutschland seit 1972 auf niedrigem Niveau und liegt zurzeit bei 1,4 je Frau. (Roloff 2005, S. 22, f.) Die NRZ gibt an, ob die durchschnittliche Anzahl der Mädchen, die je gebärfähiger Frau geboren werden, ausreicht, um die jetzigen Mütter als zukünftige Mütter zahlenmäßig zu ersetzen, wobei der Wert „1“ Bestandserhaltung bedeutet. Für die Berechnung der NRZ wird von gleichbleibenden altersspezifischen Geburtenziffern und von Weitergeltung der aktuellen Sterbetafeln ausgegangen. Außerdem werden nur die lebend geborenen Mädchen berücksichtigt. Sie betrug 1996 für Deutschland 0,63, woraus hervorgeht, dass die künftige Müttergeneration um 37 % zahlenmäßig kleiner sein wird als die Generation ihrer Mütter. (Grieswelle 2002, S. 37) Die zusammengefasste Geburtenziffer ist somit eine Maßzahl für das Geburtenniveau, während die NRZ Aufschluss darüber gibt, ob das Bestandserhaltungsniveau erreicht wurde, bzw. wie weit man davon entfernt ist.
Neben der Betrachtung der zusammengefassten Geburtenziffer und der NRZ können auch die Entwicklungen von Altenquotient und Erwerbspersonenpotential Aufschluss darüber geben, welche Ausmaße der demografische Wandel angenommen hat und welche Konsequenzen sich daraus für die Bevölkerung der Zukunft ergeben können. Die bereits angeführten Ursachen für den demografischen Wandel führen zum einen zu einem starken Anstieg des Anteils der über 65-Jährigen: Ihr Anteil wird gemäß der von der Bundesregierung durchgeführten Modellberechnung von 10,8 % im Jahr 1960 auf 30,6 % im Jahr 2040 ansteigen. (Grieswelle 2002, S. 38) Der Altenquotient, der das Verhältnis der Personen im Rentenalter zu Personen im erwerbsfähigen Alter angibt, steigt sogar von 17,9 % im Jahre 1960 auf 56,2 % im Jahre 2040 an, weist also einen drastischen Anstieg aus. (Grieswelle 2002, S. 38) Diesem Sachverhalt kann allerdings entgegenhalten werden, dass die Festlegung der dem Altenquotienten zugrundeliegenden Parameter wie z.B. die angenommene Entwicklung von Lebenserwartung und Geburtenrate oder auch die Definition des Erwerbsalters je nach Intention variabel sind und die Intervalle für diese Parameter so festgelegt werden können, dass ein ganz bestimmtes – durch die Wahl geeigneter Intervalle unter Umständen absichtlich herbeigeführtes – Ergebnis für den Altenquotienten dabei herauskommt. So wird der Altenquotient in der Politik häufig als Instrument verwendet, um die sozialen Sicherungssysteme in Frage zu stellen. (Reuter 2004, S. 1, ff.) Außerdem berücksichtigt der Altenquotient weder den Produktivitätsfortschritt noch die Tatsache, dass das Erwerbspersonenpotential nicht gleichzusetzen ist mit der Anzahl der Menschen, die tatsächlich erwerbstätig sind. (Reuter 2004, S. 3)
Andererseits ist die Anzahl der Erwerbstätigen natürlich immer abhängig von der Größe des Erwerbspersonenpotentials, da sie immer nur einen Teil dieses Potentials ausmachen kann. Besorgniserregend mag daher für manchen die Information sein, dass das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (im folgenden: IAB) nach 2010 eine deutliche Verringerung des Erwerbspersonenpotentials in Deutschland prognostiziert, nämlich eine Abnahme von 38,5 Mio. Menschen im Jahr 2010 auf 24,8 Millionen Menschen im Jahr 2040. Dieser Prognosevariante liegt die Annahme zugrunde, dass es in Deutschland keine Zuwanderung geben wird. Ferner wird von gleichbleibender Erwerbsbeteiligung ausgegangen. (Grieswelle 2002, S. 38, f.)
Als weitere Konsequenz ergibt sich neben dem sinkenden Erwerbspersonenpotential auch eine Alterung desselben. Laut Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes werden die Altersgruppen der 35-49-Jährigen und der 20-34-Jährigen mittelfristig unterschiedlich stark sinken, während bei der Altersgruppe der 50 – 64-Jährigen nur ein sehr geringer Rückgang erwartet wird. Dies würde dazu führen, dass die zuletzt genannte Gruppe im Jahr 2050 die zahlenmäßig stärkste Gruppe innerhalb des Arbeitskräftepotentials stellt. (Roloff 2005, S. 35)
Im krassen Gegensatz hierzu steht die heutige Erwerbsquote dieser Altersgruppen: Sie betrug im Mai 2004 bei der Altersgruppe der 55–64 Jährigen 45%, bei der Altersgruppe der 60–64 Jährigen sogar nur noch rund 25 %, was auch auf Frühverrentungen und Vorruhestandsregelungen zurückzuführen ist. (Roloff 2005, S. 35, f)
Der Tatsache, dass die Altersgruppe der über 50-Jährigen laut der oben erwähnten Berechnungen mittelfristig gesehen die zahlenmäßig stärkste Gruppe des Arbeitskräftepotentials darstellen wird, steht der Trend gegenüber, dass die Personalentscheider vieler Unternehmen verstärkt dazu neigen, ihre Belegschaft zu „verjüngen“, indem sie möglichst viele junge Menschen einzustellen, ältere Menschen in den Vorruhestand schicken, und Bewerbern, die älter als 50 Jahre alt sind, oft keine Chance mehr geben. Bei Fortschreitung und Eskalation dieser beiden gegenläufigen Entwicklungen droht ein massiver Generationenkonflikt, der jedoch dadurch entschärft werden könnte, dass die Unternehmen das Potential der über 50-Jährigen erkennen und Bewerber dieser Altersgruppe nicht mehr kategorisch ablehnen.
In Kapitel 4.3: Gerechte Beteiligung der Generationen an der Erwerbsarbeit“ wird das Thema „Höhere Erwerbsbeteilung Älterer“ noch mal aufgegriffen.
2.2 Auswirkungen auf Sozialsysteme und Arbeitsmarkt
Auch die Auswirkungen des demografischen Wandels auf Sozialsysteme und Arbeitsmarkt sind ein Thema, das in den Medien immer wieder aufgegriffen und diskutiert wird. Besonders der Sozialstaat wird in Frage gestellt, was häufig mit einem steigenden Altenquotienten begründet wird. Ob der Sozialstaat als solcher aufrechterhalten werden kann, hängt nicht zuletzt auch von der Arbeitsmarktsituation ab, da es die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind, die den Sozialstaat finanziell tragen. (Schinkel 2007, S. 37) In diesem Zusammenhang wird oft das Umlageverfahren angeprangert, welches hier am Beispiel der Rentenversicherung kurz erläutert werden soll: Es läuft in der Praxis so ab, dass die von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in die Rentenversicherung eingezahlten Beiträge umgehend wieder an die leistungsberechtigten Rentner ausgezahlt werden. Dies beinhaltet insofern Konfliktpotential, als dass die Anzahl der „Einzahler“ abnimmt während die Anzahl der Rentner zunimmt.
Vor diesem Hintergrund wird der Generationenvertrag, der zum einen die eben beschriebenen, immer größer werdenden Belastungen der jetzigen Beitragszahler beinhaltet, ihnen aber angesichts der geringen Geburtenrate und steigenden Lebenserwartung eine spätere Versorgung in dieser Form nicht mehr garantieren kann, oft als gefährdet dargestellt. (Schinkel 2007, S. 37, f.)
Wenn in der Gesellschaft über die Legitimität des Generationenvertrags als gesellschaftlich akzeptiertem Konsens diskutiert wird, mag das für manchen den Anschein erwecken, als würde es sich dabei um eine rein moralische Verpflichtung gegenüber der vorangegangenen Generation handeln, die mit Hoffnung und Vertrauen in die nachfolgende Generation einhergeht. In Wirklichkeit aber ist der Generationenvertrag von Regierung und Parlament gesetzlich verankert. Die Betroffenen haben kaum Möglichkeiten, etwas an der Ausgestaltung dieses Gesetzes zu ändern. (Buttler 1997, S. 91)
Umso problematischer stellen sich daher die möglichen Auswirkungen der demografischen Entwicklungen auf den Arbeitsmarkt dar: Wenn die Erwerbstätigen die Beitragsbelastung als zu groß empfinden, kann das zur Folge haben, dass die Leistungsbereitschaft sinkt, Mehrverdienst unattraktiv wird und dadurch der wirtschaftliche Fortschritt beeinträchtigt wird. (Buttler 1997, S. 91)
[...]
- Citar trabajo
- Joachim Schween (Autor), 2008, Konfliktpotentiale durch veränderte Bevölkerungszusammensetzung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136311