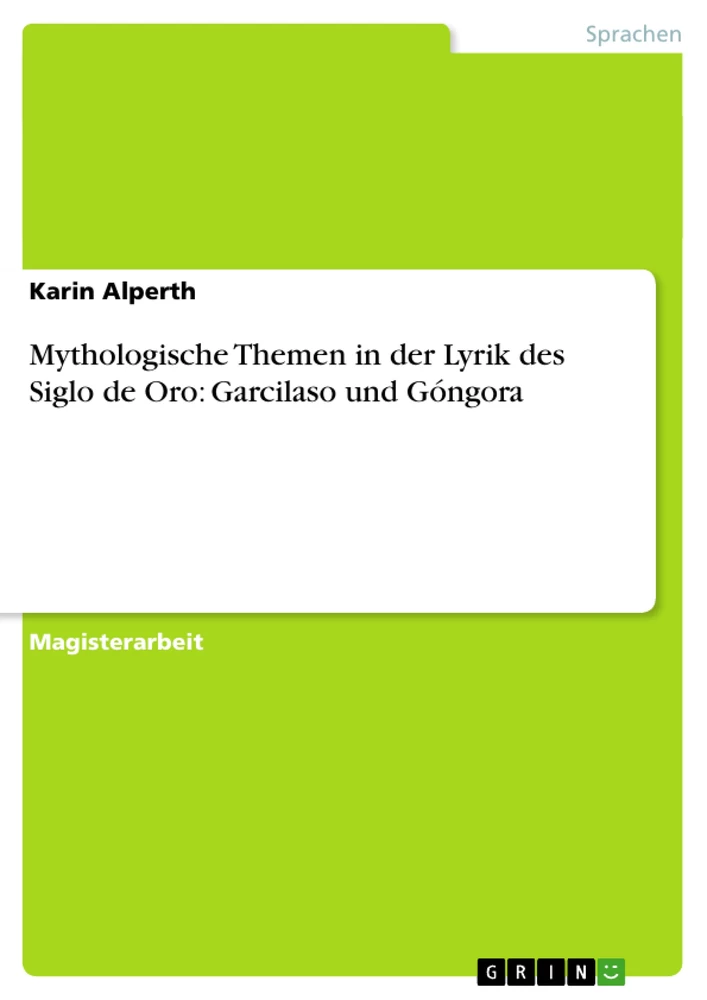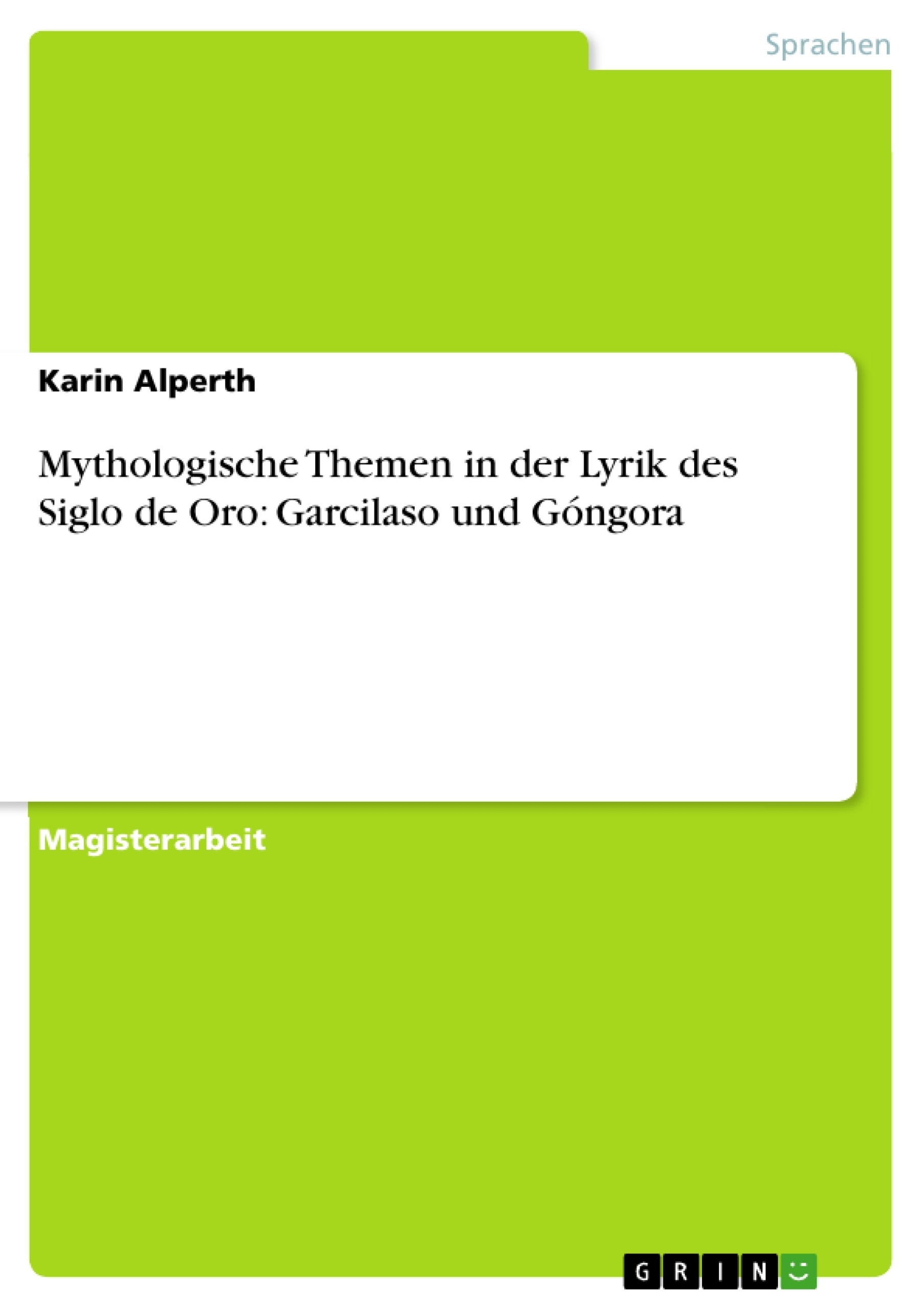Mythologische Themen begleiten und beeinflussen seit Jahrtausenden das Leben und Denken der Menschen. Die vormals religiöse Bedeutung mythologischer Figuren in der Antike wandelte sich im Laufe der Zeit zu einem schöngeistigen Interesse in Literatur und Kunst. Somit eroberte die Mythenwelt der Griechen und Römer anhand zahlreicher rezipierter Stoffe und mythologischer Kompilationen auch das nachchristliche Europa, einschließlich der Iberischen Halbinsel. Die Rezeption klassisch-mythologischer Quellen in der spanischen Literatur ist dabei von so großem Umfang, daß hier nur die mythologischen Themen in der Lyrik des Siglo de Oro am Beispiel von Garcilaso de la Vega und Luis de Góngora y Argote vorgestellt und untersucht werden sollen. Beide Dichter waren herausragende Persönlichkeiten und Repräsentanten ihrer jeweiligen Epochen: Garcilaso revolutionierte die Renaissancelyrik, während Góngora der Barockliteratur eine nachhaltige Prägung verlieh. Aus dem außerordentlich umfangreichen Werk dieser Autoren beschränken wir uns auf eine Auswahl ihrer mythologische Sonette, die Einblicke in deren Rezeption mythologischer Themen geben soll. Dabei kommt dem Petrarksimus und der italienischen Renaissancelyrik eine besondere Bedeutung zu, wie im Folgenden anhand der antikisierenden und italianisierenden Tendenzen beider Dichter zu sehen sein wird. Ehe die Sonette einer eingehenden Analyse auf syntagmatisher, pragmatischer und semantischer Ebene unterzogen werden, soll zunächst geklärt werden, was sich hinter dem Begriff der Mythologie verbirgt, und welche Zwecke und Funktionen sie im Laufe der Jahre hatte. In diesem Zusammenhang sollen Quellen aufgezeigt werden, die in Mittelalter und Neuzeit die Grundlage mythologischer Rezeption und Verarbeitung in Europa, insbesondere natürlich auch in Spanien, gebildet haben könnten. Im analytischen und wichtigsten Teil der Arbeit, der insbesondere auf der Sonettinterpretation aufbaut, wird anhand der Sonettinhalte versucht werden, die Funktion mythologischer Einschübe in den Texten zu ermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mythen und ihre Funktion
- Mythenrezeption in Spanien
- Mittelalter (bis 1500)
- Neuzeit
- Lyrik des Siglo de Oro (Überblick)
- Renaissance
- Barock
- Warum fiel die Wahl auf Garcilaso und Góngora?
- Garcilasos mythologische Sonette
- Orpheus-Mythos (Sonett XV „Si quejas y lamentos pueden tanto“)
- Daphne-Mythos (Sonett XIII, „A Dafne ya los brazos le crecían“)
- Ironisierung des Leander-Mythos (Sonett XXIX, „Pasando el mar Leandro el animoso“)
- Nymphen als Trostspender (Sonett XI, „Hermosas ninfas que en el rio metidas“)
- Góngoras mythologische Sonette
- Liebe als Gefahr
- Sonett „La dulce boca que a gustar convida“
- Sonett „No destrozada nave en roca dura“
- Orpheus-Variationen
- Sonett „Ni en este monte este aire“
- Sonett „Herido el blanco pie del hierro breve“
- Pastoraler Diskurs (Sonett „Al tronco Filis de un laurel sagrado“)
- Liebe als Gefahr
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Verwendung mythologischer Themen in der spanischen Lyrik des Siglo de Oro. Sie analysiert die Werke von Garcilaso de la Vega und Luis de Góngora y Argote, zwei bedeutenden Dichtern ihrer jeweiligen Epochen, und untersucht, wie sie mythologische Elemente in ihre Sonette einbauen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Funktion dieser mythologischen Einschübe zu ermitteln und ihren Beitrag zum Gesamtverständnis der Gedichte zu beleuchten.
- Die Rezeption klassischer Mythen in der spanischen Literatur
- Die Funktion und Bedeutung von Mythen in der Renaissance und im Barock
- Der Einfluss des Petrarkismus und der italienischen Renaissancelyrik
- Die Verwendung mythologischer Themen in den Sonetten von Garcilaso und Góngora
- Die Interpretation und Analyse der Sonette auf syntagmatischer, pragmatischer und semantischer Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert den Hintergrund der Rezeption klassischer Mythen in der spanischen Literatur. Sie stellt die beiden untersuchten Dichter, Garcilaso de la Vega und Luis de Góngora y Argote, sowie den Kontext ihrer literarischen Epochen vor. Kapitel 2 befasst sich mit der Definition und Funktion von Mythen. Es wird erläutert, wie Mythen in der Antike entstanden sind und welche Bedeutung sie für verschiedene Kulturen hatten. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Rezeption klassischer Mythen in Spanien, wobei die Entwicklung von der mittelalterlichen bis zur neuzeitlichen Literatur beleuchtet wird. Kapitel 4 behandelt die Lyrik des Siglo de Oro im Allgemeinen und stellt die wichtigsten Merkmale der Renaissance- und Barocklyrik dar. Kapitel 5 erklärt, warum die Wahl auf Garcilaso und Góngora fiel und welche Besonderheiten ihre Werke auszeichnen. Die folgenden Kapitel analysieren die mythologischen Sonette beider Dichter. Kapitel 6 analysiert Garcilasos Sonette und Kapitel 7 Góngoras Sonette. Dabei wird auf die verwendeten Mythen, ihre Funktion und ihre Bedeutung für das Gesamtverständnis der Gedichte eingegangen. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse abgeschlossen.
Schlüsselwörter
Mythologie, Siglo de Oro, spanische Lyrik, Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora y Argote, Renaissance, Barock, Petrarkismus, Sonett, Orpheus, Daphne, Leander, Nymphen, Liebe, Gefahr, pastoraler Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Welche Epoche der spanischen Literatur behandelt diese Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem Siglo de Oro, dem Goldenen Zeitalter der spanischen Literatur, insbesondere mit der Renaissance und dem Barock.
Welche Dichter werden als Beispiele herangezogen?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Garcilaso de la Vega für die Renaissance und Luis de Góngora für den Barock.
Welche Mythen werden in Garcilasos Sonetten analysiert?
Analysiert werden unter anderem der Orpheus-Mythos, der Daphne-Mythos und die Ironisierung des Leander-Mythos.
Wie unterscheidet sich Góngoras Nutzung der Mythologie?
Góngora nutzt Mythen oft komplexer und im Kontext barocker Stilmittel, um Themen wie die Gefahr der Liebe oder pastorale Diskurse darzustellen.
Welchen Einfluss hatte der Petrarkismus?
Der Petrarkismus und die italienische Renaissancelyrik bildeten die formale und inhaltliche Grundlage für die antikisierenden Tendenzen beider Dichter.
Was war die Funktion mythologischer Einschübe in dieser Zeit?
Mythen dienten nicht mehr religiösen Zwecken, sondern als schöngeistiges Ausdrucksmittel, um Emotionen zu verschlüsseln oder ästhetische Ideale zu vermitteln.
- Quote paper
- Karin Alperth (Author), 2002, Mythologische Themen in der Lyrik des Siglo de Oro: Garcilaso und Góngora, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13632