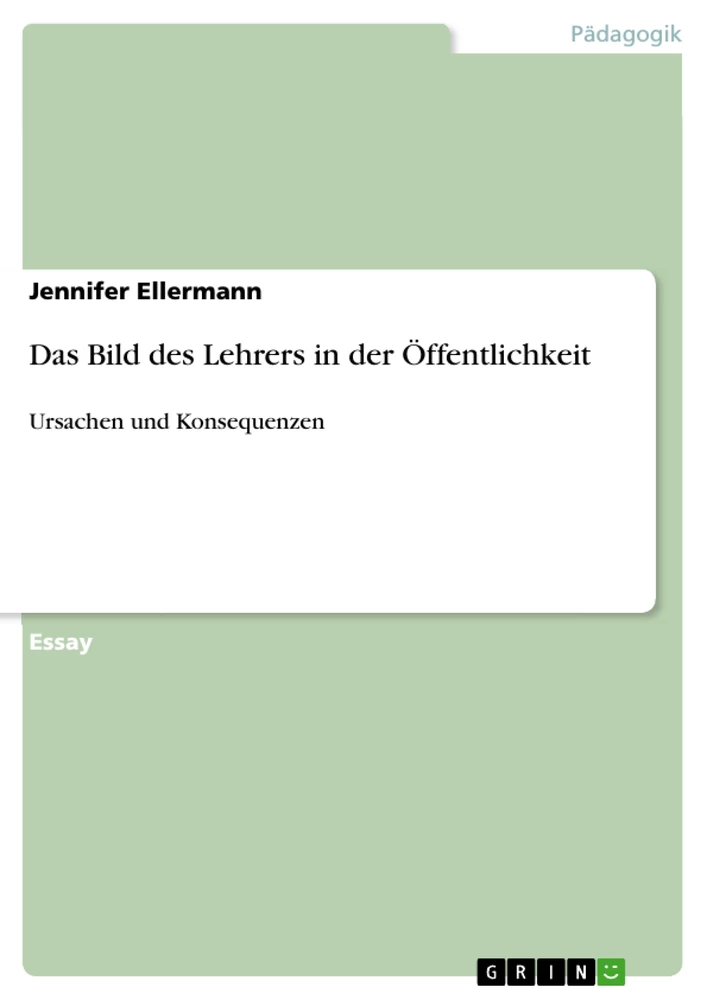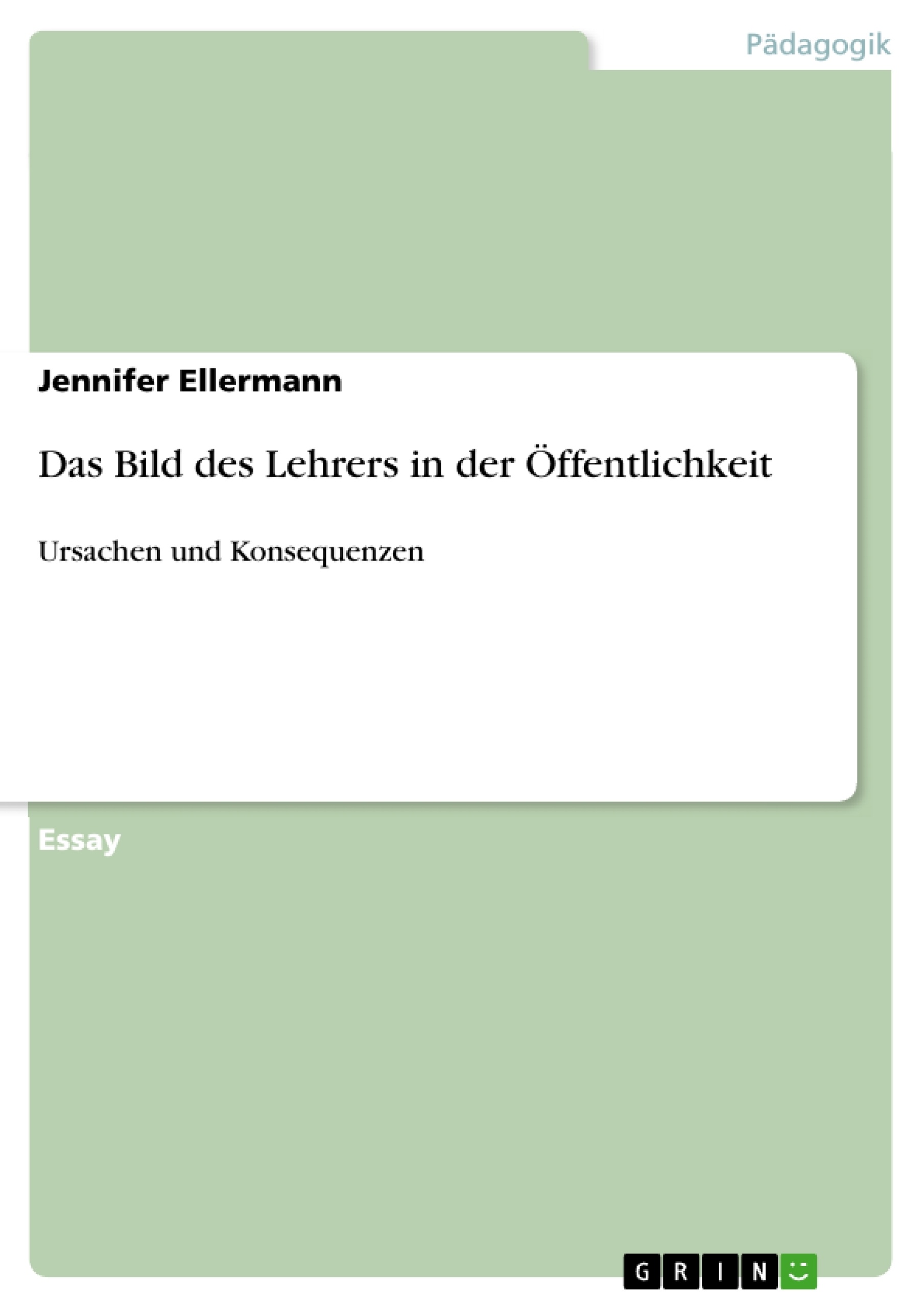„Würde der Lehrer sich umschauen, sähe er sich umringt von Menschen, die für Geld alles tun würden – sogar arbeiten.“
Mit diesem Zynismus deutet die Autorin des Lehrer-Hasser-Buches, Lotte Kühn, die Ausmaße der vermeintlichen Faulheit eines Berufsstandes an, der nicht erst seit der Diskreditierung des Bildungssystems im Zuge der Pisa-Studie einigen Hohn und Spott über sich ergehen lassen muss. So fügt sich die Autorin und alleinerziehende Mutter vierer Kinder scheinbar nahtlos in den allgemeinen Missmut über die Leistung der deutschen Pädagogen ein und forciert mit ihrem Beitrag eine Kultur des „Lehrer-Bashings“. Aber stellen Kühns Ausführungen wirklich ein repräsentatives Bild der öffentlichen Meinung dar oder ist die vorgebliche Allgemeingültigkeit nur ihrem pauschalisierenden und pointierten Schreibstil geschuldet? „Ist die veröffentlichte Meinung auch die Meinung der Öffentlichkeit?“ Wenn ja, wo liegen die Gründe für das negative Image, welche Konsequenzen hat es für die Leistungsbereitschaft und das Selbstbild der Lehrer, sowie für die Berufswahl angehender Studenten?bEine fundierte Äußerung über die öffentliche Meinung zum Berufsstand Lehrer kann am besten vor dem Hintergrund einer repräsentativen Meinungsumfrage getätigt werden; Letztere führt das Allensbacher Institut für Demoskopie in mehrjährigen Intervallen zur Erstellung einer Berufprestige-Skala durch, zuletzt Anfang 2008. Gebeten werden die Probanden dabei aus einer Auswahl an Berufen die fünf auszuwählen, vor denen sie am meisten Achtung haben. Das Ergebnis aus dem Jahr 2008 - verglichen mit der vorangegangenen Umfrage aus dem Jahr 2003 - deutet entgegen des vermeintlichen Prestigeverlustes einen Imagegewinn der Lehrer an, da sie um sechs Prozentpunkte zulegen konnten und nun hinter den wiederholt erstrangigen Ärzten, den Pfarrern und Hochschulprofessoren auf dem vierten Platz gelandet sind. Entscheidend ist dabei jedoch die Berücksichtigung der Tatsache, dass bei den Umfragen zwischen Grundschullehrern und Studienräten differenziert wird; so rosig also der Status der Primarpädagogen anmutet, so deprimierend wirkt der abgeschlagene zwölfte Platz der Gymnasiallehrer (Insgesamt stehen 17 Berufe zur Auswahl).
„Würde der Lehrer sich umschauen, sähe er sich umringt von Menschen, die für Geld alles tun würden – sogar arbeiten.“[1]
Mit diesem Zynismus deutet die Autorin des Lehrer-Hasser-Buches, Lotte Kühn, die Ausmaße der vermeintlichen Faulheit eines Berufsstandes an, der nicht erst seit der Diskreditierung des Bildungssystems im Zuge der Pisa-Studie einigen Hohn und Spott über sich ergehen lassen muss. So fügt sich die Autorin und alleinerziehende Mutter vierer Kinder scheinbar nahtlos in den allgemeinen Missmut über die Leistung der deutschen Pädagogen ein und forciert mit ihrem Beitrag eine Kultur des „Lehrer-Bashings“. Aber stellen Kühns Ausführungen wirklich ein repräsentatives Bild der öffentlichen Meinung dar oder ist die vorgebliche Allgemeingültigkeit nur ihrem pauschalisierenden und pointierten Schreibstil geschuldet? „Ist die veröffentlichte Meinung auch die Meinung der Öffentlichkeit?“[2] Wenn ja, wo liegen die Gründe für das negative Image, welche Konsequenzen hat es für die Leistungsbereitschaft und das Selbstbild der Lehrer, sowie für die Berufswahl angehender Studenten?
Eine fundierte Äußerung über die öffentliche Meinung zum Berufsstand Lehrer kann am besten vor dem Hintergrund einer repräsentativen Meinungsumfrage getätigt werden; Letztere führt das Allensbacher Institut für Demoskopie in mehrjährigen Intervallen zur Erstellung einer Berufprestige-Skala durch, zuletzt Anfang 2008.[3] Gebeten werden die Probanden dabei aus einer Auswahl an Berufen die fünf auszuwählen, vor denen sie am meisten Achtung haben. Das Ergebnis aus dem Jahr 2008 - verglichen mit der vorangegangenen Umfrage aus dem Jahr 2003 - deutet entgegen des vermeintlichen Prestigeverlustes einen Imagegewinn der Lehrer an, da sie um sechs Prozentpunkte zulegen konnten und nun hinter den wiederholt erstrangigen Ärzten, den Pfarrern und Hochschulprofessoren auf dem vierten Platz gelandet sind. Entscheidend ist dabei jedoch die Berücksichtigung der Tatsache, dass bei den Umfragen zwischen Grundschullehrern und Studienräten differenziert wird; so rosig also der Status der Primarpädagogen anmutet, so deprimierend wirkt der abgeschlagene zwölfte Platz der Gymnasiallehrer (Insgesamt stehen 17 Berufe zur Auswahl).
Die Prämisse eines Prestigeverlustes scheint also zumindest für einen Teil der Lehrerschaft zutreffend zu sein, bedenkt man, dass gemäß der Umfrage sogar Atomphysiker in Zeiten breiter Kernkraft-Ressentiments und renitenter Castor- Transport-
Blockaden ein höheres gesellschaftliches Ansehen genießen. Doch wo liegen die Ursachen dafür? Trifft das Magazin „Der Spiegel“ den Punkt, wenn es davon spricht, dass „Lehrpersonen […] überfordert (seien), unmotiviert, zu alt, nicht auf dem aktuellen Stand des Geschehens, […] intrigant, larmoyant[4] – und sogar gewalttätig“[5], ist der Lehrerberuf vielleicht sogar ein „,Auffangbecken für Studienversager, Mittelmäßige, Unentschlossene, Ängstliche und Labile, kurz gesagt für Doofe, Faule und Kranke’“[6], wie es der „Focus“ erkannt zu haben meint?
Die Autoren Barz und Singer stimmen dieser einseitigen Schuldzuweisung nicht zu; vielmehr erhärten sie die These von Terhart[7],
[...]
[1] Kühn, Lotte: Das Lehrer-Hasser-Buch. Eine Mutter rechnet ab. Knaur Taschenbuch Verlag. München 2005, S. 95.
[2] Barz, Heiner; Singer, Thomas: Das Bild des Lehrers in der Öffentlichkeit. Variationen über einen einstmals geschätzten Berufsstand. In: Die Deutsche Schule, 91. 4/1999. S.437.
[3] Vgl. http://www.ifd-allensbach.de/news/prd_0802.html
[4] Larmoyant: sentimental-weinerlich
[5] Blömeke, Sigrid: Das Lehrerbild in Printmedien. Inhaltsanalyse von „Spiegel“- und „Focus“-Berichten seit 1990. In: Die Deutsche Schule, 97. 2005/1, S.28.
[6] Ebd., S. 28.
[7] Ewald Terhart ist ein deutscher Erziehungswissenschaftler, der u.a. Bücher über das Lehrerbild, den Lehrerberuf und deren Perspektiven geschrieben hat.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das öffentliche Ansehen von Lehrern in Deutschland?
Das Ansehen ist gespalten: Während Grundschullehrer ein hohes Prestige genießen, rangieren Gymnasiallehrer in Umfragen oft deutlich weiter hinten.
Was versteht man unter „Lehrer-Bashing“?
Darunter versteht man die pauschale Abwertung des Lehrerberufs in Medien und Öffentlichkeit, oft verbunden mit Vorwürfen wie Faulheit oder Inkompetenz.
Welchen Einfluss hatte die PISA-Studie auf das Lehrerbild?
Die PISA-Studie führte zu einer verstärkten öffentlichen Kritik am Bildungssystem und diskreditierte zeitweise die Leistungen der deutschen Pädagogen.
Wie schneiden Lehrer im Vergleich zu anderen Berufen ab?
Laut Allensbacher Berufprestige-Skala liegen Lehrer insgesamt auf den vorderen Plätzen, hinter Ärzten und Professoren, wobei die Differenzierung nach Schulform entscheidend ist.
Welche Folgen hat ein negatives Image für den Berufsstand?
Ein negatives Image kann die Leistungsbereitschaft senken, das Selbstbild der Lehrer schädigen und die Berufswahl potenzieller Lehramtsstudenten negativ beeinflussen.
- Citar trabajo
- Jennifer Ellermann (Autor), 2008, Das Bild des Lehrers in der Öffentlichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136338