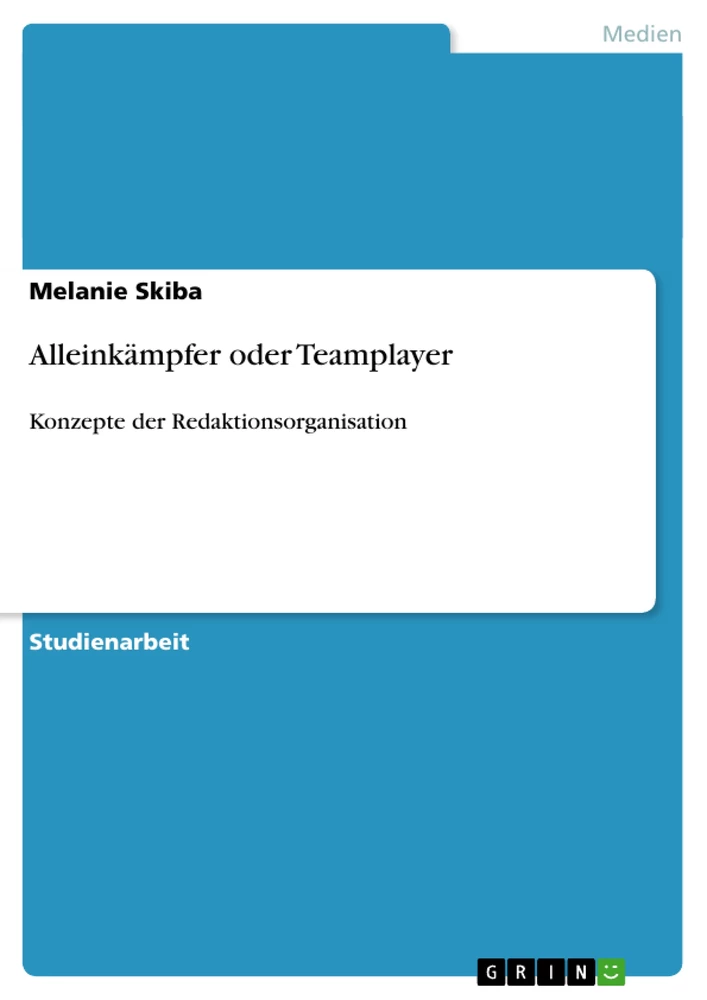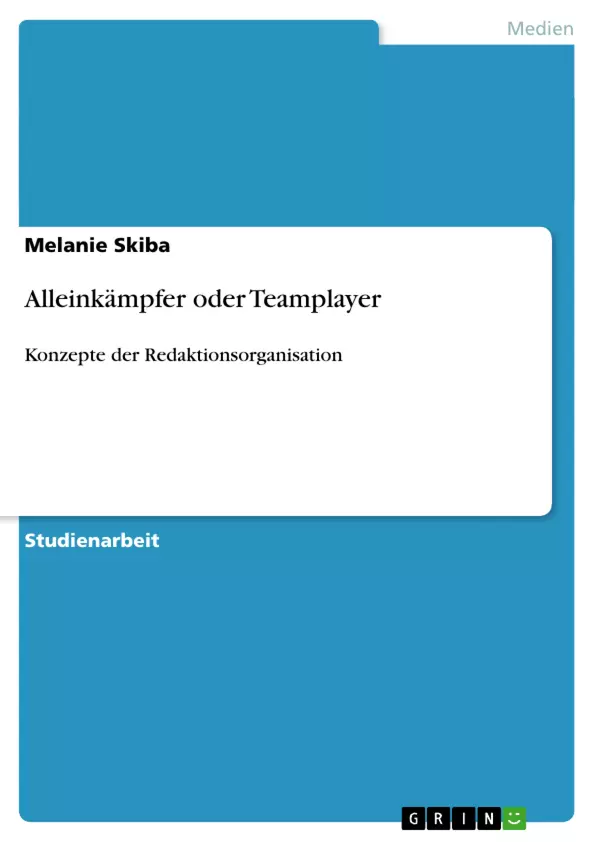Wie soll das Printprodukt „Zeitung“ im „gnadenlosen Konkurrenzkampf“ mit den weitaus schnelleren elektronischen Medien wie etwa Fernsehen oder Internet bestehen? Wie unterschiedlich die Lösungsansätze verschiedener Experten hinsichtlich dieser Fragestellung auch sein mögen, in einem wesentlichen Punkt stimmen sie wohl alle überein: Sowohl das Endprodukt Zeitung als auch die Arbeitsweise innerhalb der Redaktionen muss einer grundsätzlichen Transformation unterworfen werden, „[...] um sich den Herausforderungen der gewandelten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu stellen“. Seit Mitte der 90er Jahre haben sich demzufolge neue Strukturen und Konzepte der Redaktionsorganisation herausgebildet, auf deren Darstellung und Analyse die vorliegende Seminararbeit letztlich abzielt. Aber um eine adäquate Bewertung moderner Organisationsformen vornehmen zu können, ist es zunächst einmal vonnöten, Charakteristika sowie Stärken und Schwächen traditioneller Redaktionskomplexe näher zu beleuchten. Aus diesem Grund befassen sich die ersten beiden Gliederungspunkte meiner Arbeit mit tradierten Hierarchie- sowie Ressortstrukturen, deren Grundelemente auch im Journalismus des 21. Jahrhunderts noch weitverbreitet sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Alleinkämpfer oder Teamkämpfer? – Konzepte der Redaktionsorganisation im Wandel der Zeit
2. Die Machtverteilung innerhalb der Redaktion
2.1. Hierarchischer Aufbau einer traditionellen Redaktion
2.1.1. Der Verleger
2.1.2. Der Chefredakteur
2.1.3. Der Chef vom Dienst
2.1.4. Die Ressortleiter
2.1.5. Die Redakteure
2.2. Die „Innere Pressefreiheit“
2.3. Die Redaktionskonferenz
3. Wesen der Ressortstruktur sowie deren Stärken und Schwächen
4. „Reinventing the newsroom“ – Neue Konzepte der Redaktionsorganisation
4.1. Maßnahmen zur Aufweichung der klassischen Ressortstruktur
4.1.1 Verstärkte Anwendung themenorientierter Gliederungsprinzipien
4.1.2. Bildung ressortübergreifender Teams
4.1.3. Rotation der Redakteure
4.2. Innovative Einrichtungen der redaktionellen Umgestaltung
4.2.1. „Newsrooms without walls“ als Patentrezept?
4.2.2. Der „Newsdesk“ als Schaltzentrale der Redaktion
4.2.3. Das „News-& Editoring-System”
4.3. Kritische Einstellung der Redakteure zu den Modernisierungsmaßnahmen
5. Klassische Ressortstruktur vs. moderne Redaktionskonzepte
Bibliografie
1. Alleinkämpfer oder Teamkämpfer? – Konzepte der Redaktionsorganisation im Wandel der Zeit
Wie soll das Printprodukt „Zeitung“ im „ gnadenlosen Konkurrenzkampf“[1] mit den weitaus schnelleren elektronischen Medien wie etwa Fernsehen oder Internet bestehen?
Wie unterschiedlich die Lösungsansätze verschiedener Experten hinsichtlich dieser Fragestellung auch sein mögen, in einem wesentlichen Punkt stimmen sie wohl alle überein: Sowohl das Endprodukt Zeitung als auch die Arbeitsweise innerhalb der Redaktionen muss einer grundsätzlichen Transformation unterworfen werden, „[...] um sich den Herausforderungen der gewandelten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu stellen“[2].
Seit Mitte der 90er Jahre haben sich demzufolge neue Strukturen und Konzepte der Redaktionsorganisation herausgebildet, auf deren Darstellung und Analyse die vorliegende Seminararbeit letztlich abzielt.
Aber um eine adäquate Bewertung moderner Organisationsformen vornehmen zu können, ist es zunächst einmal vonnöten, Charakteristika sowie Stärken und Schwächen traditioneller Redaktionskomplexe näher zu beleuchten. Aus diesem Grund befassen sich die ersten beiden Gliederungspunkte meiner Arbeit mit tradierten Hierarchie- sowie Ressortstrukturen, deren Grundelemente auch im Journalismus des 21. Jahrhunderts noch weitverbreitet sind.
2. Die Machtverteilung innerhalb der Redaktion
Ebenso wie jedes andere privatwirtschaftlich vertriebene Produkt, unterliegt das Produkt Zeitung letzten Endes dem kommerziellen Zwang, ein möglichst großes Publikum erreichen zu müssen. Allerdings ist keineswegs von der Hand zu weisen, dass Kriterien wie publizistischer Qualität im Produktionsprozess einer Zeitung genauso starke Geltung zukommt[3]. Aus dieser Dualität der Zielvorstellungen ergibt sich zwangsläufig eine Trennung der beiden Sphären Verlag und Redaktion.
2.1. Hierarchischer Aufbau einer traditionellen Redaktion
2.1.1. Der Verleger
Der Verleger koordiniert in seiner Funktion als „[...] haftender Inhaber [...], Organisator und Leiter des Unternehmens“[4] somit diese beiden Bereiche, wodurch ihm sowohl die publizistische als auch die wirtschaftliche Gesamtverantwortung für den Konsumgegenstand Zeitung übertragen sind[5]. Daher erscheint die Aussage durchaus angemessen, er agiere nicht nur in unternehmerischer Weise, sondern auch als Publizist (vgl. Brand/Schulze, S. 62). Diese Doppelfunktion ermöglicht es ihm darüber hinaus, „[...] Typ, Richtung, Kontinuität und regelmäßiges Erscheinen [...]“ (ebd.) der Zeitung zu gewährleisten.
Hieraus kann gefolgert werden, dass dem Verleger die oberste Einscheidungsgewalt gegenüber allen Teilen der Redaktion obliegt. Allerdings greift ein kluger Verleger - um mit den Worten Emil Dovifats zu sprechen - nur dann in die Arbeitsabläufe in seiner Redaktion ein, „[...] wenn es im Gesamtinteresse der Zeitung erforderlich ist“ (ebd.).
2.1.2. Der Chefredakteur
An der Spitze der Redaktion ist der Chefredakteur angesiedelt, dessen primäre Pflicht in der Wahrung der vom Verleger vorgegebenen publizistischen Grundhaltung („Blattlinie“) besteht (vgl. ebd. S. 63). Infolgedessen bestimmt er über „[...] den zu veröffentlichenden Stoff“[6] und koordiniert die redaktionellen Vorgänge. Dadurch fungiert er zwangsläufig als Instrument des Interessenausgleichs zwischen den Instanzen Redaktion, Verlag und Leserschaft (vgl. Pürer/Raabe, S. 256) und repräsentiert das redaktionelle Gefüge folglich nach innen und außen.
Während der Chefredakteur noch vor einigen Jahrzehnten durch Beisteuerung z.B. von Leitartikeln blattmachende und schreibende Funktionen gleichermaßen in seiner Person vereint hat, ist er nun verstärkt ausschließlich als „[...] Manager mit vielfältigen Organisations-, Administrations- und Kooperationsaufgaben“ (ebd.) tätig.
2.1.3. Der Chef vom Dienst
Die „wichtigste Stütze des Chefredakteurs“ (Von La Roche, S. 42) ist zweifelsohne der Chef vom Dienst. Indem dieser den einzelnen Ressorts redaktionellen Raum zuweist (vgl. ebd.) und die Anzeigenplatzierung übernimmt, steuert er nämlich die Zusammenarbeit von „Redaktion, Anzeigenabteilung und Technik“[7]. Es lässt sich wohl unschwer nachvollziehen, dass die Tätigkeit des Chefs vom Dienst ergo eine beständige Gratwanderung „[...] zwischen der kommerziell orientierten Anzeigenabteilung und der publizistisch- politisch engagierten Redaktion“ (ebd.) darstellt.
2.1.4. Die Ressortleiter
Da klassische Redaktionssysteme ja eine starre Ressortgliederung aufweisen, befinden sich auf der nächsten Stufe der redaktionellen Binnenhierarchie die Ressortleiter, welche unabdingbar für Leitung, Kontrolle und Koordination des ihnen unterstellten Ressorts sind (vgl. Pürer/Raabe, S. 257). Aus dieser Verantwortung leitet sich selbstverständlich die „[...] presserechtliche Verantwortung [der Ressortleiter] für redaktionelle Inhalte aus ihrem Ressort“ (ebd.) ab.
2.1.5. Die Redakteure
Insofern als die Redakteure nach eingehender Recherchearbeit Wort- und Bildbeiträge erstellen und diese in vielen Fällen selbst mit redaktionell- technischen Mitteln ausgestalten (vgl. Brand/Schulze, S. 63), bilden sie quasi das geistige Fundament einer jeden Zeitungsredaktion.
Von kardinaler Bedeutung ist, dass sich eine Differenzierung zwischen festangestellten, also beständig in ein Ressort eingebundenen, Redakteuren sowie freien Mitarbeiten vornehmen lässt. Letztere sind insbesondere für Lokal- und Regionalzeitungen unentbehrlich, weil deren festangestellte Journalisten ohne sie wohl kaum die große Masse an lokalen Veranstaltungen wahrzunehmen imstande wären.
2.2. Die „Innere Pressefreiheit“
Dieses eben erörterte hierarchische Modell der Redaktionsstruktur weist ohne Zweifel dem Verleger als oberstem Führungsorgan die Grundsatz- und Richtlinienkompetenz zu, wobei dem einzelnen Redakteur bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung seiner Artikel selbstverständlich eine Detailkompetenz eingeräumt wird.
[...]
[1] Meier, Klaus. „Themen und Teams statt Ressorts“. In: Message 1/2002, S. 144
[2] http://www.drehscheibe.og/dokumente/vortrag_klaus_meier.pdf
[3] vgl. Mast, Claudia. ABC des Journalismus- Ein Handbuch. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2004, S.
529
[4] Brand, Peter/ Schulze, Volker. Medienkundliches Handbuch: Die Zeitung. Braunschweig: Westermann
Agentur Petersen, 1982, S. 62
[5] vgl. Pürer, Heinz /Raabe Johannes. Medien in Deutschland. Band 1 Presse. Konstanz: UVK
Verlagsgesellschaft, 2006, S. 246
[6] Von La Roche, Walther. Einführung in den praktischen Journalismus. München: List-Verlag, 1991, S. 42
[7] Pürer, Heinz (Hrsg.). Praktischer Journalismus in Zeitung, Radio und Fernsehen. Konstanz: UVK Medien, 1996, S. 331
- Citar trabajo
- Melanie Skiba (Autor), 2007, Alleinkämpfer oder Teamplayer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136346