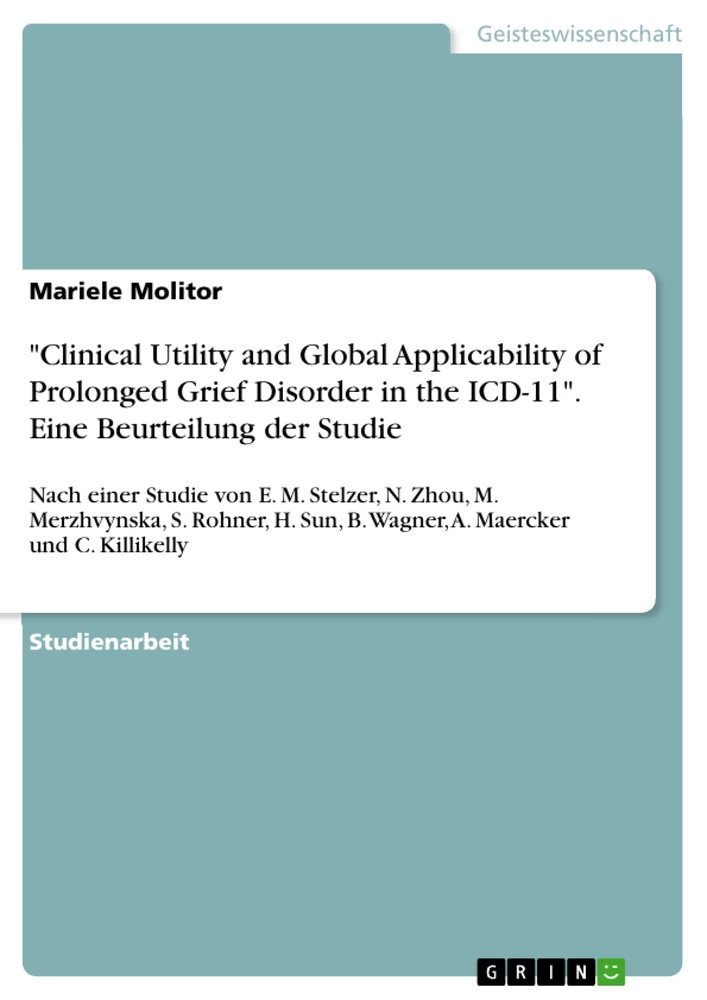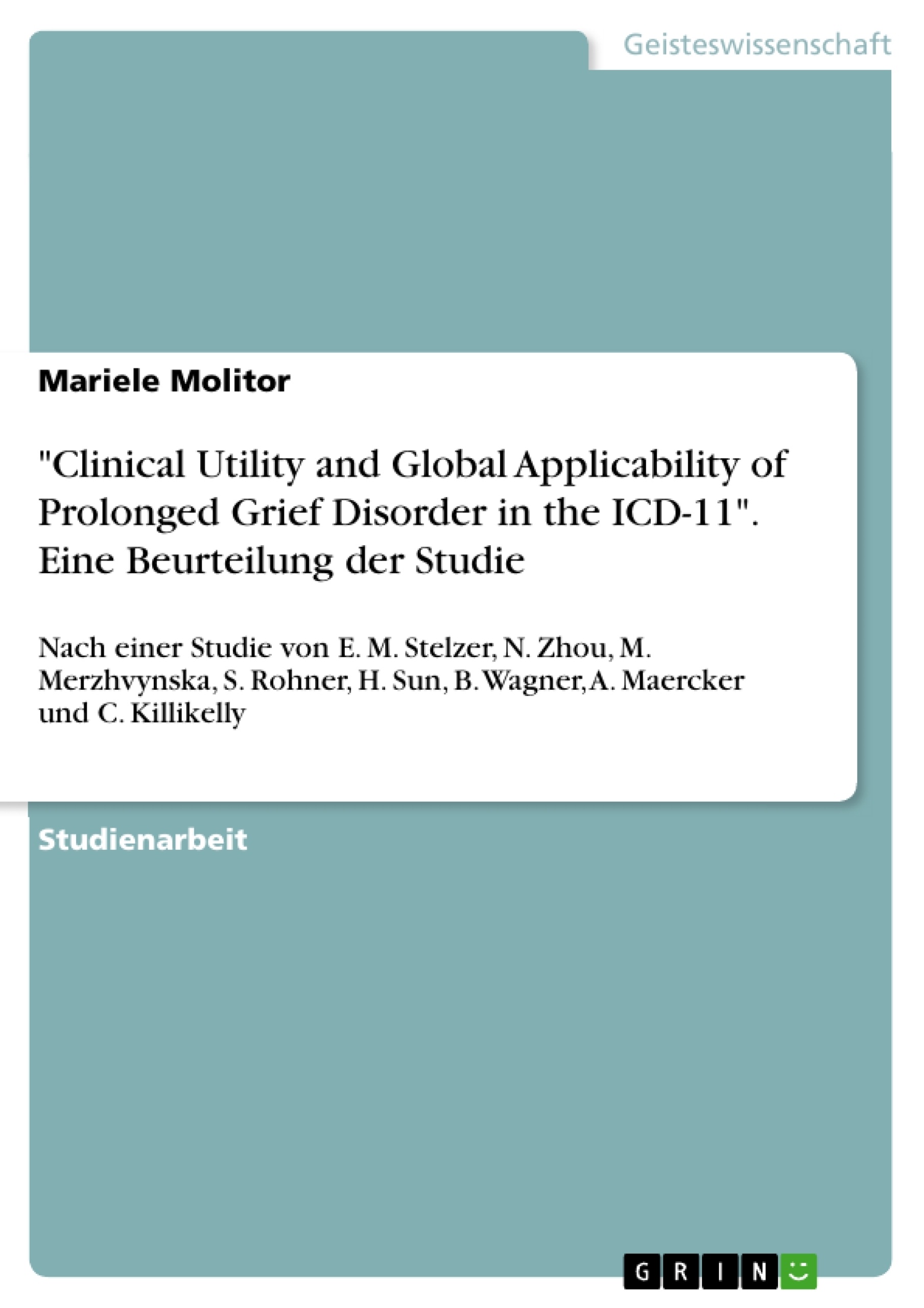In der folgenden Hausarbeit wird die Studie "Clinical Utility and Global Applicability of Prolonged Grief Disorder in the ICD-11 from the Perspective of Chinese and German-Speaking Health Care Professionals" aus dem Jahr 2020 verkürzt dargestellt. Die Studie beschäftigt sich mit dem klinischen Nutzen und der globalen Anwendbarkeit einer anhaltenden Trauerstörung (Prolonged Rief Disorder, kurz PGD), welche erstmalig im ICD-11 erscheinen wird. Durchgeführt wurde die Studie von Eva-Maria Stelzer, Ningning Zhou, Mariia Merzhvynska, Stefan Rohner, Han Sun, Birgit Wagner, Andreas Maercker und Clare Killikelly. Es wurden insgesamt vierundzwanzig Health Care Professionals zu unterschiedlichen Themenbereichen dieser Trauerstörung interviewt. Die Probanden stammen sowohl aus der Schweiz, als auch aus China. Es werden insbesondere die Ergebnisse dieser Interviews thematisiert. Dazu zählen unter anderem die Vor- und Nachteile der PGD-Kriterien, mögliche Hindernisse, sowie Verbesserungsvorschläge für die klinische Umsetzung und die globale Anwendbarkeit. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die kulturellen Unterschiede zwischen den westeuropäischen und den chinesischen Studienteilnehmern, welche im Folgenden ausführlich dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodik
- 3. Ergebnisse
- 3.1 Klinischer Nutzen
- 3.1.1 Diagnostische Richtlinien
- 3.1.2 Benutzerfreundlichkeit und Implementierung
- 3.2 Globale Anwendbarkeit
- 3.2.1 Kommunikation
- 3.1 Klinischer Nutzen
- 4. Kulturelle Unterschiede in spezifischen Merkmalen
- 5. Implikation in die Praxis
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit fasst die Studie „Clinical Utility and Global Applicability of Prolonged Grief Disorder in the ICD-11 from the Perspective of Chinese and German-Speaking Health Care Professionals“ zusammen. Ziel der Studie ist es, den klinischen Nutzen und die globale Anwendbarkeit der im ICD-11 neu eingeführten Prolonged Grief Disorder (PGD) aus der Perspektive von Gesundheitsexperten in China und deutschsprachigen Ländern zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Ergebnisse von Interviews mit Health Care Professionals und beleuchtet kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung und Anwendung der PGD-Kriterien.
- Klinischer Nutzen der PGD-Kriterien im ICD-11
- Globale Anwendbarkeit der PGD-Diagnose
- Kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung von Trauer und PGD
- Herausforderungen bei der Implementierung der PGD in die klinische Praxis
- Verbesserungsvorschläge für die PGD-Kriterien und deren Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert die Bedeutung diagnostischer Klassifizierungssysteme wie der ICD und des DSM in der Psychiatrie und klinischen Psychologie. Sie führt die Prolonged Grief Disorder (PGD) als neue Diagnose im ICD-11 ein, charakterisiert deren Symptome und diagnostische Kriterien (Dauer der Symptome, Überschreitung sozialer Normen). Die Einleitung hebt die Notwendigkeit weiterer Forschung zur Schließung der Lücke zwischen Forschung und klinischer Praxis hervor, insbesondere im Hinblick auf die globale Anwendbarkeit und die Berücksichtigung kultureller Unterschiede. Die Studie von Stelzer et al. (2020) wird als Versuch, diese Lücke zu schließen, vorgestellt, wobei bestehende Forschungslücken im Bereich der interkulturellen Studien und der Angemessenheit der PGD-Kriterien hervorgehoben werden.
2. Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie von Stelzer et al. (2020). Es wird ein qualitatives Design mit semistrukturierten Interviews erläutert, die mit 14 deutschsprachigen und 10 chinesischsprachigen Health Care Professionals geführt wurden. Die Auswahl der Teilnehmer, ihre beruflichen Hintergründe und die Durchführung der Interviews (Aufzeichnung, Transkription, thematische Analyse) werden detailliert dargestellt. Der Prozess der Entwicklung und Validierung des Interviewleitfadens wird ebenso beschrieben wie die ethische Zulassung der Studie durch die Forschungsethikkommission der Universität Zürich. Die Methode der Datenanalyse, die sowohl deduktive als auch induktive Ansätze kombinierte, wird ebenfalls erläutert.
3. Ergebnisse: Die Ergebnisse der Studie werden in zwei übergreifende Abschnitte unterteilt: den klinischen Nutzen und die globale Anwendbarkeit der PGD. Der Abschnitt zu den Ergebnissen beschreibt die Vielzahl an Themen und Unterthemen, die aus den Interviews hervorgingen und deren Zusammenfassung in diese beiden Hauptkategorien. Es wird angedeutet, dass im weiteren Verlauf der Arbeit die jeweiligen Aspekte detailliert beleuchtet werden. Die Strukturierung der Ergebnisse folgt der WHO-ICD-11 Mission.
Schlüsselwörter
ICD-11, Prolonged Grief Disorder (PGD), Trauerstörung, kulturelle Unterschiede, qualitative Forschung, semistrukturierte Interviews, globale Anwendbarkeit, klinischer Nutzen, Health Care Professionals, China, deutschsprachige Länder.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Clinical Utility and Global Applicability of Prolonged Grief Disorder in the ICD-11 from the Perspective of Chinese and German-Speaking Health Care Professionals"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit fasst die Studie von Stelzer et al. (2020) zusammen, welche den klinischen Nutzen und die globale Anwendbarkeit der im ICD-11 neu eingeführten Prolonged Grief Disorder (PGD) aus der Sicht von Gesundheitsexperten in China und deutschsprachigen Ländern untersucht. Die Arbeit analysiert qualitative Interviewdaten und beleuchtet kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung und Anwendung der PGD-Kriterien.
Welche Methodik wurde in der zugrundeliegenden Studie verwendet?
Die Studie von Stelzer et al. (2020) verwendet ein qualitatives Design mit semistrukturierten Interviews. 14 deutschsprachige und 10 chinesischsprachige Health Care Professionals wurden befragt. Die Daten wurden transkribiert und mittels einer thematischen Analyse ausgewertet, die sowohl deduktive als auch induktive Ansätze kombinierte. Der Interviewleitfaden wurde entwickelt und validiert, und die Studie erhielt die ethische Zulassung der Forschungsethikkommission der Universität Zürich.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf den klinischen Nutzen der PGD-Kriterien im ICD-11, die globale Anwendbarkeit der PGD-Diagnose, kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung von Trauer und PGD, Herausforderungen bei der Implementierung der PGD in die klinische Praxis und Verbesserungsvorschläge für die PGD-Kriterien und deren Anwendung.
Wie sind die Ergebnisse der Studie strukturiert?
Die Ergebnisse der Studie sind in zwei Hauptkategorien unterteilt: Klinischer Nutzen und Globale Anwendbarkeit der PGD. Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse folgt der WHO-ICD-11 Mission und berücksichtigt die vielfältigen Themen und Unterthemen, die aus den Interviews hervorgingen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Methodik, Ergebnisse (mit Unterkapiteln zu klinischem Nutzen und globaler Anwendbarkeit), Kulturelle Unterschiede in spezifischen Merkmalen, Implikation in die Praxis und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: ICD-11, Prolonged Grief Disorder (PGD), Trauerstörung, kulturelle Unterschiede, qualitative Forschung, semistrukturierte Interviews, globale Anwendbarkeit, klinischer Nutzen, Health Care Professionals, China, deutschsprachige Länder.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Hausarbeit gezogen? (Hinweis: Diese Frage kann nur allgemein beantwortet werden, da die detaillierten Schlussfolgerungen aus dem Volltext der Hausarbeit entnommen werden müssen.)
Die Hausarbeit zieht Schlussfolgerungen zum klinischen Nutzen und der globalen Anwendbarkeit der PGD im ICD-11, berücksichtigt dabei kulturelle Unterschiede und mögliche Herausforderungen bei der Implementierung in die klinische Praxis. Konkrete Schlussfolgerungen und Verbesserungsvorschläge sind im Fazit der Hausarbeit detailliert aufgeführt.
- Citar trabajo
- Mariele Molitor (Autor), 2021, "Clinical Utility and Global Applicability of Prolonged Grief Disorder in the ICD-11". Eine Beurteilung der Studie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1363706