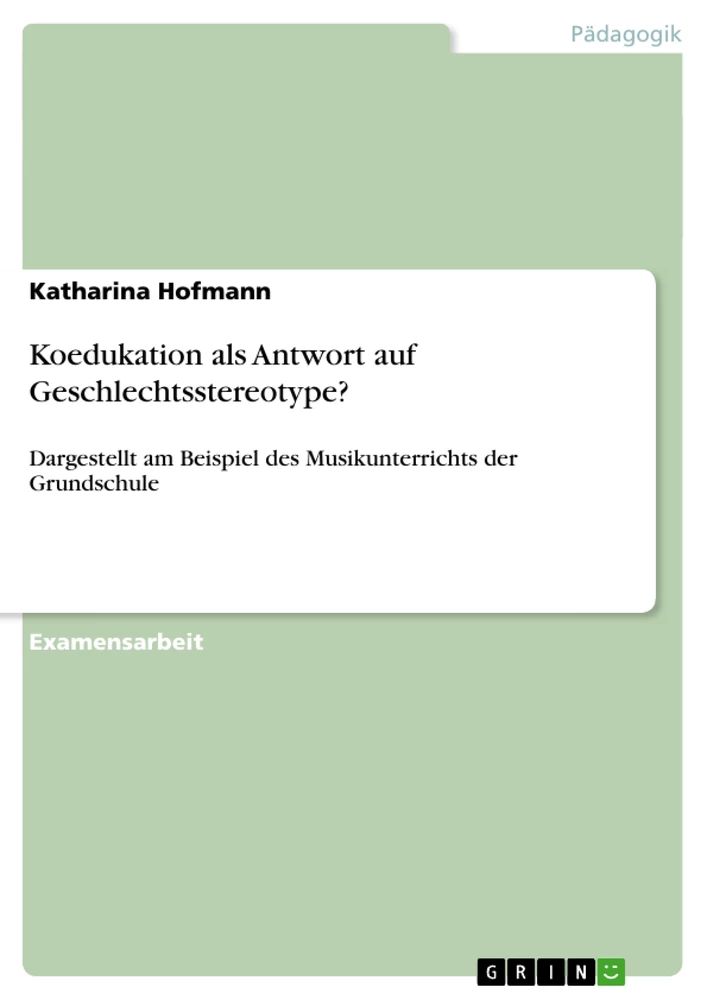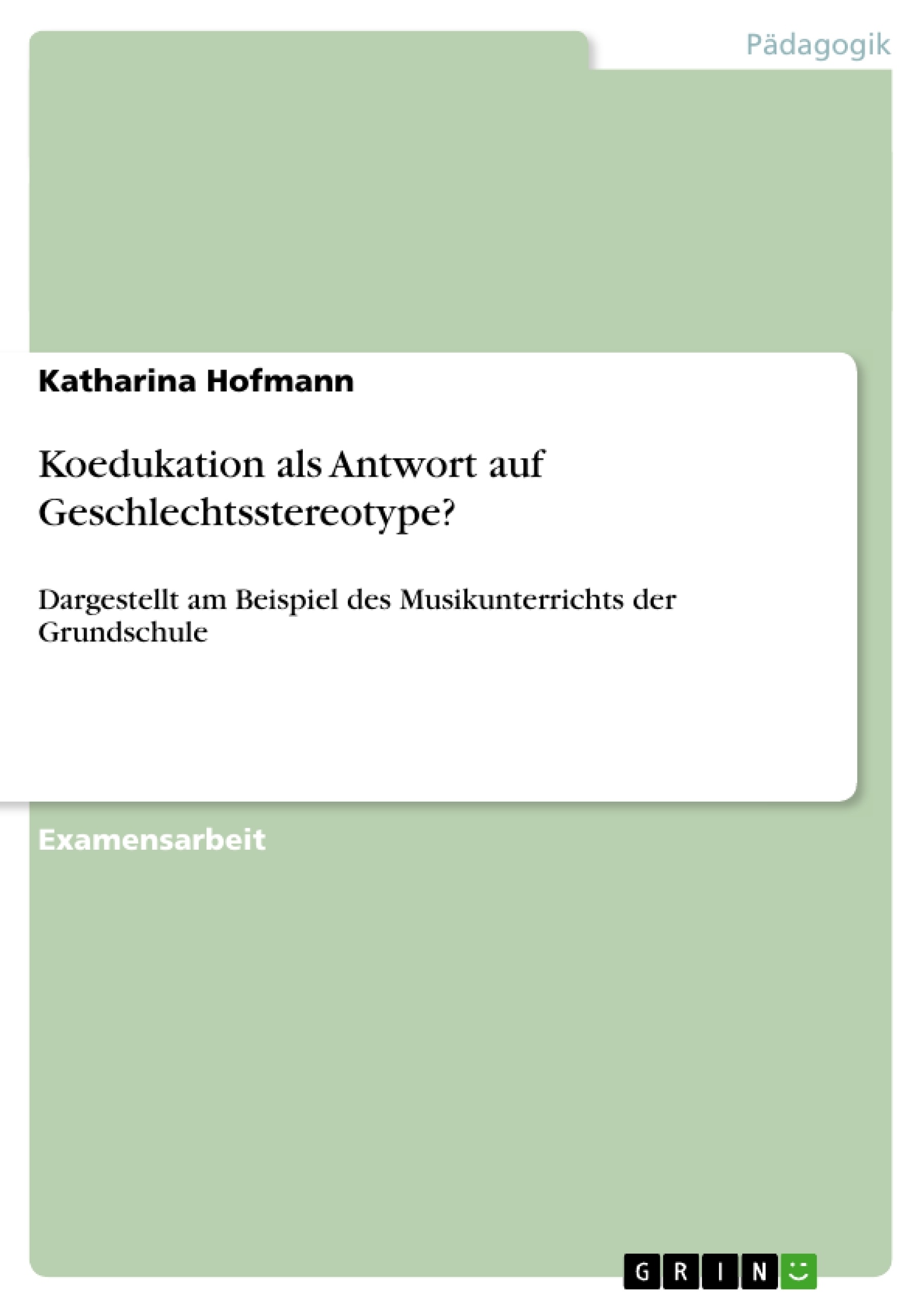„Das Geschlecht ist kein zufälliges Attribut, sondern eines der wichtigsten Elemente in der Entscheidung darüber, ob ein Individuum Zugang zur musikalischen Bildung, zu Musikinstrumenten, Musikinstitutionen, zu Musikberufen und dem gesamten kulturellen Spektrum erhält.“
Der Einfluss von Geschlecht auf den Musikunterricht ist ein Phänomen, welches noch nicht häufig untersucht wurde. Koedukationsforschung wird zwar intensiv betrieben, für den musikalischen Bereich gibt es jedoch wenige Hinweise. Die Beobachtungen während meiner Praktika machten mir die Wichtigkeit dieser Fragstellung bewusst. Immer wieder erlebte ich Jungen, die aus dem Rahmen fielen und augenscheinlich keine Freude am Unterrichtsgeschehen hatten. Geschlechtsunterschiede fielen mir vor allem im Musikunterricht auf. Die Mädchen sangen laut und schön, bei den Jungen freute sich die Lehrerin schon über ein paar richtige Töne. Beim Tanzen alberten die männlichen Schüler herum, während die Schülerinnen voller Eifer mitmachten.
Jungen zeigen Disziplinprobleme, während Mädchen mit Freude mitsingen. Diese wiederum haben seltener die Chance, an Rock-/ Popinstrumenten aktiv zu werden. Tanzen ist halt „Frauensache“. Muss ich mich als zukünftige Lehrerin damit zufrieden geben? Der Sächsische Lehrplan fordert: „Die konsequente Hinwendung zu vielfältiger Musizierpraxis ermöglicht es Jungen und Mädchen gleichermaßen, Musik als aktiv zu gestaltendes Element ihres Lebens zu erkennen und einzubeziehen.“ Diese Forderung motiviert mich zu meiner Arbeit. Wo ist die gleichberechtigte Förderung der Geschlechter und ist Koedukation eine Hilfe, um dieses Ziel zu erreichen? Ich hoffe, einige dieser Fragen mit dem Schreiben meiner Arbeit beantworten zu können.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Einleitung
3. Koedukation in Deutschland
3.1 Begriffsklärung
3.2 Historischer Überblick
3.3 Aktueller Diskussionsstand
4. Geschlechtsstereotype
4.1 Begriffsklärung
4.2 Geschlechtsstereotype im musikalischen Bereich
4.2.1 Neurobiologische Hintergründe
4.2.1.1 Geschlechtsspezifische Entwicklung von Körper und Gehirn
4.2.1.2 Physiologische und Psychologische Unterschiede von Musikern und Nicht- Musikern
4.2.1.3 Geschlechtsspezifische Umbrüche im kreativen Potenzial während der Pubertät
4.2.2 Instrumentenwahl
4.2.2.1 Beispiel Klavier
4.2.2.2 Beispiel Rockinstrumente
4.2.3 Tanzen
4.2.4 Singen
4.2.4.1 Mutation
4.2.4.2 Stimmbildnerische Maßnahmen während der Mutation
4.2.5 Die Rolle der Frau im musikalischen Geschehen
4.2.5.1 Historischer Überblick
4.2.5.2 Aktuelle Situation
5. Geschlechtsstereotype in Musikbüchern
5.1 Einführung zur Problematik
5.2 Untersuchung der einzelnen Musikbücher
5.3 Auswertung
6. Eigene Befragung
6.1 Begründung
6.2 Erstellung des Fragebogens
6.3 Durchführung der Befragung
6.4 Auswertung
7. Koedukation als Antwort auf Geschlechtsstereotype?
8. Konsequenzen für die Praxis
9. Fazit
Literaturverzeichnis
Anlagenverzeichnis
Anlagen
1. Vorwort
„Das Geschlecht ist kein zufälliges Attribut, sondern eines der wichtigsten Elemente in der Entscheidung darüber, ob ein Individuum Zugang zur musikalischen Bildung, zu Musikinstrumenten, Musikinstitutionen, zu Musikberufen und dem gesamten kulturellen Spektrum erhält.“[1]
Der Einfluss von Geschlecht auf den Musikunterricht ist ein Phänomen, welches noch nicht häufig untersucht wurde. Koedukationsforschung wird zwar intensiv betrieben, für den musikalischen Bereich gibt es jedoch wenige Hinweise. Die Beobachtungen während meiner Praktika machten mir die Wichtigkeit dieser Fragstellung bewusst. Immer wieder erlebte ich Jungen, die aus dem Rahmen fielen und augenscheinlich keine Freude am Unterrichtsgeschehen hatten. Geschlechtsunterschiede fielen mir vor allem im Musikunterricht auf. Die Mädchen sangen laut und schön, bei den Jungen freute sich die Lehrerin schon über ein paar richtige Töne. Beim Tanzen alberten die männlichen Schüler herum, während die Schülerinnen voller Eifer mitmachten.
Jungen zeigen Disziplinprobleme, während Mädchen mit Freude mitsingen. Diese wiederum haben seltener die Chance, an Rock-/ Popinstrumenten aktiv zu werden. Tanzen ist halt „Frauensache“. Muss ich mich als zukünftige Lehrerin damit zufrieden geben? Der Sächsische Lehrplan fordert: „Die konsequente Hinwendung zu vielfältiger Musizierpraxis ermöglicht es Jungen und Mädchen gleichermaßen, Musik als aktiv zu gestaltendes Element ihres Lebens zu erkennen und einzubeziehen.“[2] Diese Forderung motiviert mich zu meiner Arbeit. Wo ist die gleichberechtigte Förderung der Geschlechter und ist Koedukation eine Hilfe, um dieses Ziel zu erreichen? Ich hoffe, einige dieser Fragen mit dem Schreiben meiner Arbeit beantworten zu können.
2. Einleitung
Nachdem ich im Vorwort die Motivation für meine Arbeit deutlich gemacht habe, möchte ich nun näher auf meine Gliederung eingehen.
Zu Beginn möchte ich einen Einblick zur Koedukation in Deutschland geben und dabei auf die Geschichte und den aktuellen Diskussionsstand eingehen. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in Kapitel vier. Hier gebe ich allgemeine Hinweise zu Geschlechtsstereotypen und spezifiziere diese dann auf den musikalischen Bereich. Dabei gehe ich vor allem auf Singen, Tanzen und die Instrumentenwahl ein. Das Unterkapitel „Die Rolle der Frau im musikalischen Geschehen“ stellt einen kleinen Exkurs dar, der mir aber für das Verständnis der Arbeit wichtig erscheint.
Zwei eigene Untersuchungen führen den theoretischen Teil fort. Zum einen analysiere ich Musikbücher nach möglicherweise dargestellten Geschlechtsstereotypen. Die Ergebnisse sind in Kapitel fünf beschrieben. Zum anderen möchte ich eine Befragung mit Grundschulkindern durchführen. Ziel davon ist es, gängige Erwartungen mithilfe konkreter Werte untermauern zu können. Das Kapitel sechs stellt somit auch einen wichtigen Teil der gesamten Arbeit dar. Wie mit den gefundenen Ergebnissen umzugehen ist, klären die letzten beiden Kapitel. Ob Koedukation eine mögliche Antwort auf Geschlechtsstereotype ist und wie konkrete Hinweise für die Unterrichtspraxis aussehen können, wird hier beschrieben. Das Fazit versucht, die Erkenntnisse zu bündeln und gibt einen Ausblick.
Anzumerken ist, dass auf die weibliche Bezeichnung von Substantiven (z.B. Lehrerin) in dieser Arbeit, so weit es nicht ausdrücklich notwendig ist, verzichtet wird. Weiterhin werden alle Namen aus Datenschutzgründen geändert.
3. Koedukation in Deutschland
3.1 Begriffsklärung
Der Begriff Koedukation stammt aus dem lateinisch-englischen und meint die „gemeinsame Erziehung von Mädchen und Jungen in Schulen und Internaten“.[3]
3.2 Historischer Überblick
Bereits im 18. Jahrhundert gab es erste Konzeptionen für die Mädchenerziehung. In diesen war aber vor allem festgehalten, dass „Mädchen keine formale Bildung“ brauchten, sondern für die häuslichen Dienste vorbereitet werden sollten.[4] Der Staat war nur für die Sicherung staatsbürgerlicher Aufgaben verantwortlich und diese waren ausschließlich auf Männer zugeschnitten.[5] Somit gab es eine Trennung von Knaben- und Mädchenschulen, da die staatliche Verpflichtung für Frauen nicht vorhanden war.
Die 1717 eingeführte Schulpflicht galt sowohl für Mädchen als auch für Jungen. Die Elementarschulen waren häufig koedukativ, da sie im Regelfall von Kindern niederer Stände besucht wurden und die generelle Frage der Ausstattung und Einrichtung im Vordergrund stand.[6] Allerdings stand dabei die Bildung der Jungen im Mittelpunkt, Mädchen wurden häufig nur mitbeschult. Die höhere Schulbildung war Frauen jedoch noch vorenthalten. Nach vielen Jahren voller Diskussionen und Protesten entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ersten höheren Mädchenschulen.
Während der Weimarer Republik wurden Koedukationsschulen zugelassen, es war aber noch nicht allgemeingültiges Prinzip.[7] In der Zeit des Nationalsozialismus ging die Koedukation wieder vollständig zurück. Mädchen wurden in getrennten Schulen für ihre Aufgabe in der Hauswirtschaft vorbereitet.[8]
In der sowjetischen Besatzungszone wurde die Koedukation ab 1945 eingeführt und bis zur Auflösung der DDR kaum hinterfragt. In der späteren Bundesrepublik dauerte es bis in die 70er Jahre, bis im Bereich der höheren Schule koedukativ unterrichtet wurde.[9]
3.3 Aktueller Diskussionsstand
Die Koedukation wurde in den 60er Jahren eingeführt, um auch Mädchen Zutritt zu höherer Schulbildung zu ermöglichen. Sie sollten den gleichen Ausbildungsinhalten begegnen, die auch die Männer erlernen. Durch gemeinsamen Schulbesuch sollten Ungleichheiten vermieden werden. Zwar gab es Menschen, die von „grundlegenden Wesensverschiedenheiten der Geschlechter“ ausgingen, diese plädierten aber dennoch für die Koedukation, weil sie sich damit einen „Ausgleich, ein Sich-Gegenseitiges-Ergänzen“ erhofften.[10] Heute allerdings zeigt es sich, dass es nicht allein ausreicht, beide Geschlechter gemeinsam zu unterrichten. Denn dies ändert nichts am „heimlichen Lehrplan der Geschlechtersozialisation“ und an der Tatsache, dass Mädchen im Schulalltag diskriminiert werden und ihr Selbstbewusstsein schlechter zur Entfaltung bringen können als Jungen.[11] Der Fokus richtet sich in der Diskussion nun aber auch zusätzlich auf die Jungen. Diese werden bei der Einschulung häufiger zurückgestellt (60%) und bleiben öfter sitzen als Mädchen, sie werden häufiger in Sonderschulen abgeschoben, scheitern eher in der Sekundarstufe, der vorzeitige Abgang vom Gymnasium ist bei ihnen häufiger als bei Mädchen und fast doppelt so viele Jungen wie Mädchen erhalten gar keinen Schulabschluss.[12] Weiterhin erwerben heute „Mädchen die höheren Bildungsabschlüsse: sie überwiegen in den Realschulen, Gymnasien und beim Abitur“.[13] Damit deutet sich an, dass das aktuelle deutsche Schulsystem nicht in der gleichen Weise der spezifischen Situation von Jungen gerecht wird. Es ermöglicht ihnen nicht, in dem gleichen Maße wie den Mädchen, einen erfolgreichen und qualifizierten Schulabschluss zu erreichen.[14] Preuss-Lausitz formuliert das folgendermaßen: „Das schulbenachteiligte Kind aus den 60er Jahren, nämlich das ,katholische Arbeitermädchen vom Lande’, ist seit den 90er Jahren ersetzt worden durch den ,Arbeiterjungen aus der Großstadt’.“[15]
Faulstich-Wieland führt in Folge der Probleme den Begriff der Reflexiven Koedukation ein.[16] Schüler sollen nicht nur gemeinsam unterrichtet, sondern auch zum Nachdenken und gemeinsamen Besprechen geschlechterspezifischer Themen angeregt werden. Dies muss in verschiedenen Bereichen geschehen. So sollte eine didaktisch-methodische Vielfalt erprobt und Frontalunterricht zugunsten individualisierender Methoden abgebaut werden.[17] Weiterhin muss auch die curriculare Gestaltung danach untersucht werden, ob sie Fragen des Geschlechterverhältnisses thematisiert und ob Interessen beider Geschlechter berücksichtigt sind.[18] Schon im Curriculum muss mehr „Expressivität, mehr physische Verausgabung von Energie, mehr Bewegung“ für die Schule festgelegt werden, damit auch Jungen ihrem Drang nachkommen können.[19] Die Umgestaltung von institutionellen Rahmenbedingungen ist ein weiterer wichtiger Punkt. So fehlen in der Primarstufe männliche Lehrer. Ein partnerschaftlicher Umgang von Kolleginnen und Kollegen, der sich nicht an Geschlechtsstereotypen orientiert, kann für die Kinder ein Vorbild sein.[20] Die Lehrkräfte haben eine große Bedeutung. Sie transportieren bewusst oder unbewusst ihre Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und müssen immer wieder bereit sein, diese zu hinterfragen und sich zu beobachten.
Auch in Schulbüchern werden immer noch überwiegend männliche Personen repräsentiert, Frauen finden sich oft nur in traditioneller Weise als Hausfrauen und Mütter oder in berufstätiger Weise in untergeordneten Positionen.[21] Jungen wiederum erhalten im Unterricht mehr Zuwendung von Lehrerinnen und Lehrern, Mädchen hingegen müssen sich stärker darum bemühen.[22] Durch solche Faktoren ist eine selbstbewusste Identitätsbildung von Mädchen erschwert. Eine zeitweilige fächerspezifische Trennung beider Geschlechter ist eine Möglichkeit, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. Diese sollte themenspezifisch stattfinden und große Sorgfalt auf eine gemeinsame Reflexion der in beiden Gruppen gewonnenen Erkenntnisse verwenden.[23] Sexualkundeunterricht, Gespräche über Geschlechterrollen oder geschlechtsspezifisches Verhalten können in einer monoedukativen Gruppe Sensibilität bei den Beteiligten und gestärktes Selbstbewusstsein bei den Schülerinnen wecken.[24]
Aber auch Jungen profitieren von einer Trennung in einem so genannten Mädchenfach (z.B. Deutsch). Unterrichtsstörungen nehmen merklich ab.[25] Die gemachten Erfahrungen können dann in der koedukativen Klasse reflektiert werden und führen so zu einem besseren Verständnis der Geschlechter untereinander. Somit ist Koedukation als Zielperspektive geschlechterbewusster Pädagogik zu sehen, die zu einer Einübung „respektvoller Achtung von Differenz auf der Basis der Anerkennung gleicher Rechte“ führen soll.[26]
4. Geschlechtsstereotype
4.1 Begriffsklärung
Um in meiner Arbeit mit dem Begriff Geschlechtsstereotyp weiterarbeiten zu können, möchte ich diesen in dem folgenden Kapitel näher erläutern.
Stereotyp kommt aus dem Griechischen, wobei „stereos“ starr, hart, fest und „typos“ feste Norm und charakteristisches Gepräge meint.[27] Somit sind Stereotype „verbreitete und allgemeine Annahmen über die relevanten Eigenschaften einer Personengruppe“.[28] Katz und Braly definieren ein Stereotyp als „einen starren Eindruck, der nur in einem geringen Ausmaß mit der Realität übereinstimmt, sondern vor allem dadurch zustande kommt, dass wir zuerst urteilen und dann erst hinschauen“.[29] Stereotype sind nicht nur mit kognitiven, sondern auch mit emotionalen und motivationalen Aspekten verbunden. Dabei reduzieren sie die Komplexität der Wirklichkeit, liefern Orientierungen, dienen der Legimitierung und beeinflussen alltägliche Denk- und Deutungsmuster.[30]
Da das biologische Geschlecht eine bedeutsame und in jeder Kultur vorfindliche Kategorie ist, ist sie mit zahlreichen stereotypen Vorstellungen verbunden.[31] In diesem Zusammenhang definiert Dietzen folgendermaßen: „Geschlechtsstereotype sind wichtige handlungsregulierende Deutungsschemata. Sie beruhen auf Wahrnehmungsmustern, die Individuen dazu verwenden, ihre sozialen Erfahrungen zu organisieren. Sie reduzieren die hohe Zahl möglicher Verhaltenserwartungen und ordnen sie bedeutungsvollen Mustern zu.“.[32]
Somit schreiben sie Personen, aufgrund ihrer erkennbaren Geschlechtszugehörigkeit, bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen zu.[33]
Trotz der grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten zeigen die Geschlechtsstereotype eine überraschende Beständigkeit: So zeigte eine Untersuchung von Wollschläger, dass die Eigenschaften hysterisch, an Hausarbeit interessiert, ängstlich, häuslich und emotional als typisch weibliche Eigenschaften, die Eigenschaften technisch interessiert, kräftig, risikofreudig, karrierebewusst, naturwissenschaftlich orientiert jedoch als typisch männlich galten.[34] Diese Klischees sind schon sehr alt, wurden vor allem im 19. Jahrhundert verbreitet und dienten zur Legitimierung der Geschlechterordnung.[35]
Verschiedene Studien zeigen, dass es tatsächlich schon bei Jungen und Mädchen im Grundschulalter große Geschlechterdifferenzen gibt. Die Sozialisation von Jungen gewährt ihnen mehr Spiel auf öffentlichen Freiflächen, der „Radius der Bewegungsfreiheit“ ist bei Jungen deutlich größer.[36] Mädchen hingegen sind stärker an die Wohnung gebunden.[37] Dies führt zu Kompetenzunterschieden. Sie entwickeln Fähigkeiten in räumlicher Orientierung in geringerem Maße als Jungen, während diese in der Entwicklung ihrer sprachlichen Fähigkeiten benachteiligt sind.[38]
In einem Projekt sollten acht- bis zehnjährige Kinder Fabriken von innen zeichnen. Das Thema wurde noch nicht im Unterricht behandelt, es wurde also nur das Vorwissen untersucht. Auf den Bildern der Jungen entstanden sehr komplizierte, oft in mehreren Etagen angeordnete, Fabriken, in denen technisch schon recht ausgereifte Maschinen ihre Funktionen erfüllten. Menschen hatten nur eine nebengeordnete Rolle. Die Mädchenbilder hingegen sahen sehr viel bunter, lebendiger und anschaulicher aus. Die Arbeiterinnen und Arbeiter waren groß und deutlich gezeichnet. Auch die Produkte der „eigenen Firma“ unterschieden sich. Jungen wählten eher Getränke-, Grundstoff-, Fahrzeug- und Gerätefabriken, während Mädchen dem privaten Konsum nähere Produkte wählten.[39]
Die Bilder zeigen, dass Jungen mehr im technisch-naturwissenschaftlichen Denken stecken. Diese Interessenunterschiede können allerdings durch das Verhalten von Lehrkräften noch verstärkt werden. Mädchen hingegen zeigen bessere Schulleistungen im Lesen und der Rechtschreibung.[40]
Folgende Tabelle zeigt sehr deutlich Unterschiede im Sozialleben von Mädchen und Jungen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Thies, S. 38)
Nicht zuletzt zeigen sich in den Spielwelten und den Interessen beider Geschlechter deutliche Unterschiede.[41]
4.2 Geschlechtsstereotype im musikalischen Bereich
4.2.1 Neurobiologische Hintergründe
Der Einfluss von Gehirnfunktionen auf unser Verhalten ist immens. Für komplexe Aufgaben wie Lernen, Denken, Fühlen oder auch das Komponieren einer Sinfonie ist die Arbeit des Gehirns notwendig.[42] Dieses ist einem langen Entwicklungs- und Lernprozess ausgesetzt, in dem sich dessen Struktur immer wieder verändert. Besonders dauerhaft und stark sind diese Veränderungen in den ersten Lebensjahren, aber auch im Erwachsenenalter verliert es diese Fähigkeit nicht.[43] Somit ist unverkennbar, dass das Gehirn auch in der Entwicklung von musikalischem Potenzial eine große Rolle spielt. Für meine Fragestellung ist es deswegen interessant herauszufinden, wie mögliche neurobiologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern ihren Einfluss auf die Entwicklung von Musikalität nehmen.
4.2.1.1 Geschlechtsspezifische Entwicklung von Körper und Gehirn
Mit den Gonaden (Keimdrüsen) beginnt die geschlechtsspezifische Entwicklung des Menschen. Diese sind bipotenziell, das heißt in weibliche oder männliche Richtung entwickelbar.[44] Ein genetischer Faktor, der auf dem Y-Chromosom angesiedelt ist, sorgt dafür, dass sich die Gonaden in männliche Richtung entwickeln, das heißt, dass sich Testes (Hoden) bilden. Die Entwicklung in weibliche Richtung (Ausbildung von Ovarien) muss dafür aktiv unterbunden werden. Von Geschlechtshormonen, die in den fötalen Testes und durch die Mutter gebildet werden, werden die weiteren Entwicklungsschritte bestimmt.[45] Auch die äußeren Genitalien, die sich etwa in der achten Schwangerschaftswoche entwickeln, sind bipotenziell angelegt. Sollen männliche Genitalien entstehen, dann muss eine bestimmte Menge des Geschlechtshormons Testosteron vorhanden sein und es muss sich außerdem, durch ein bestimmtes Enzym, in ein anderes Hormon überführen lassen.[46]
Auch das Gehirn ist in weibliche und männliche Richtung entwickelbar. Die Menge und Wirkungskraft von Geschlechtshormonen, vor allem des Testosterons, und die Neurotransmitter bestimmen, ob und in welchem Ausmaß sich die geschlechtsspezifischen Aspekte eines Menschen entwickeln.[47]
4.2.1.2 Physiologische und Psychologische Unterschiede von Musikern und Nicht- Musikern
Um Aussagen über die Entwicklung des kreativen musikalischen Potenzials aus der neurobiologischen Perspektive machen zu können, muss man sie im Zusammenhang mit der Entwicklung des gesamten musikalisch begabten Menschen sehen. Befunde dokumentieren, wie sich Musiker von Nicht-Musikern in physiologischen und psychologischen Parametern unterscheiden.[48]
- Musiker scheinen eine etwas andere Hirnorganisation für sprachliches und nicht-sprachliches Material zu haben als Nicht-Musiker
- Ein Musiker ist eher linkshändig als ein Nicht-Musiker
- Musiker sind stärker als Nicht-Musiker empfindlich gegenüber atopischen Erkrankungen wie Asthma, Allergien, usw.
- Musiker zeigen ein höheres Androgynie-Hormonlevel als Nicht-Musiker (physiologische Androgynie)
- Auch psychologisch sind Musiker androgyn (männliche und weibliche Charakteristika sind bei ihnen eher ausgewogen)
- Musiker reagieren auf Musik oft, als wäre sie ein Stressor, das heißt das autonome Nervensystem wird angekurbelt, der Herzschlag erhöht sich, die Stresshormonspiegel steigen an
- Der vordere Teil des Corpus callosum ist bei Musikern vergrößert[49]
4.2.1.3 Geschlechtsspezifische Umbrüche im kreativen Potenzial während der Pubertät
Die in der Pubertät ansteigenden Geschlechtshormonspiegel tragen dazu bei, dass sich die körperliche Gestalt verändert, lassen Fähigkeiten zur Fortpflanzung reifen und führen zu Veränderungen der Arbeitsweise des Gehirns. In dieser Entwicklungsphase erfährt die Spezialisierung des Gehirns für spezifische Aufgaben eine Modifikation.[50] Diese gilt auch für musikalische Leistungen. Die Werte des Testosteronspiegels sind bei Komponisten im Vergleich mit Instrumentalistinnen und Nicht-Musikern sehr niedrig, bei Komponistinnen hingegen sehr hoch. Dieser Hormonstatus muss für die Kreativität Bedeutung haben.[51] Die Pubertät ist deshalb eine kritische Phase für musikalisch Hochbegabte, weil bei manchem Musiker in dieser Zeit Hormonmengen produziert werden, die einen „optimalen“ Testosteronspiegel für Komponisten übersteigen. Bei Mädchen können in der Pubertät, durch die vermehrte Ausschüttung von Östradiol und Progesteron, hormonelle Bedingungen entstehen, die besonders ungünstig für das Kompositionstalent sind und zum Verschwinden der kreativen Komponente der Musikalität beitragen. Am Ende der Pubertät, wenn die hormonelle Reifung abgeschlossen ist, könnten wieder physiologisch günstige Voraussetzungen für die musikalische Kreativität herrschen. Demnach müssten Frauen im Durchschnitt später als Männer mit dem Komponieren anfangen.[52]
Sollten sich diese Untersuchungen bestätigen, wäre es leichter zu verstehen, warum es so wenige Komponistinnen gibt. Am Ende der Adoleszenz ist der Lebensweg vieler Frauen bereits geplant und die Einflüsse einer Sozialisation werden wirksam, die den Beruf als Komponistin eher exotisch erscheinen lassen. Musikpädagogen sollten deshalb vor allem an Musikhochschulen Mädchen und Frauen ermutigen, ihre musikalische Begabung voll zu entfalten.[53]
4.2.2 Instrumentenwahl
Auch wenn die Instrumentenausbildung selten in der Schule geschieht, hat diese einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder auch in jenem Bereich. Denn gerade Schüler aus musikalisch wenig geprägten Familien lernen in der Grundschule verschiedene Instrumente kennen. Der Lehrer sollte sich deshalb auch in diesem Thema mit Geschlechtsstereotypen auseinandersetzen, um diesen entgegen wirken zu können.
Der Sächsische Lehrplan lässt dem Lehrer im Bereich Musizieren mit Instrumenten viel Freiheit. So ist ein fachliches Ziel „das Erwerben und das Anwenden von Fähigkeiten im Spiel von Körperinstrumenten, vielfältigen Rhythmusinstrumenten, Stabspielen und weiteren Instrumenten“.[54] Damit zeigt sich, dass die Schüler vorwiegend an Rhythmusinstrumenten und Orffschem Instrumentarium[55] aktiv sein sollen. Dennoch besitzt der Lehrer die Möglichkeit, beliebige andere Instrumente zum Musizieren zu verwenden. Im Lernbereich 4: „Musik wahrnehmen, verstehen und deuten“ wird sogar verlangt, dass „vielfältige Instrumente“ vorgestellt werden.[56]
Die folgende Grafik zeigt deutlich Geschlechtsunterschiede bei der Instrumentenwahl.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Hoffmann 2002, S. 15)
Sie stellt dar, wie sich im Wintersemester 1992/1993 an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg Studentinnen und Studenten in den Instrumentalklassen verteilten. Deutlich wird, dass keine Frau die Fächer Schlagzeug, Posaune und Tuba studierte, auch bei Trompete, Fagott und Kontrabass waren Frauen unterrepräsentiert. Hingegen konzentrierten sie sich bei Harfe, Flöte, Blockflöte und Klavier.
Immer noch spiegelt sich das traditionelle Ideal weiblichen Musizierens wieder, das um 1800 herrschte. Den Frauen wurde „das Clavier, die Laute, die Zitter, die Harfe“ zugewiesen.[57] Dies hatte seine Ursache im „Widerspruch zwischen Spielbewegungen und Frauenkleidung, im Widerspruch zwischen Instrumentalklang und weiblichem Geschlechtscharakter und der Ungehörigkeit bestimmter Spielhaltungen“.[58] Auch wenn diese Argumente heute keine Rolle mehr spielen sollten, haben sie sich in einer Weise in den Köpfen festgesetzt, dass sie auch noch heute Frauen verleiten, ein „typisches“ Instrument zu erlernen. Abeles und Porter ordneten von ihnen untersuchte Instrumente „von männlich zu weiblich an: Schlagzeug – Posaune – Trompete – Saxophon – Violoncello – Klarinette – Violine – Flöte“.[59] Mona Vogl fand weiterhin heraus, dass Frauen eher zu klassischen, Männer eher zu modernen Instrumenten tendieren.[60]
Mädchen treffen ihre Instrumentenwahl meist in einem Alter, „in dem sie von unbewusst wahrgenommen Vorbildern und von den Meinungen Erwachsener abhängig sind“.[61] Dabei wirken verschiedene Faktoren mit: Ratschläge von Instrumentallehrkräften, Wünsche von Eltern und Verwandten, sowie das Erscheinungsbild von Musikerinnen in den Medien und in der Öffentlichkeit.[62] Dass diese tatsächlich eine bestimmte Erwartungshaltung haben, zeigte Lucy Green in einer Untersuchung. Lehrer gaben an, dass Mädchen besonders häufig einen bestimmten „Typ“ von Instrument spielen, beschrieben als traditionell oder orchestral, ins Besondere Flöte oder Geige.[63] Ein Lehrer gab sogar an, dass unter 50 Flötisten an seiner Schule nicht einer männlich war. Als einen möglichen Grund sieht Green die größere Vorliebe der Mädchen für klassische Musik. Auf die Frage „Which group prefers to engage in classical music(s)?“ antwortete ein Lehrer: “Girls. I think the boys tend to prefer loud, electronically produced sounds, with that constant electronic drum beat in it!”.[64]
Dies fand auch Katharina Herwig heraus. Selbst wenn Jungen und Mädchen gleiche Instrumente beschreiben, legen die Jungen dabei einen größeren Fokus auf Technik, während bei den Mädchen der Musiker als Person im Vordergrund steht.[65] Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass Jungen im Allgemeinen eine stärkere Affinität zu Technik und Computern haben, „dass sie sich frühzeitig spielerisch damit beschäftigen und auf diese Weise häufiger ein stabiles Interesse an technischen Zusammenhängen entwickeln“.[66] Diese fehlende Erfahrung bei Mädchen und somit auch mangelndes Selbstvertrauen führen dazu, dass Mädchen durchschnittlich weniger motiviert sind, „wenn es um elektronisch verstärkte Instrumente, um Aufnahmetechnik und computerunterstützte Musikproduktion geht“ und sich stattdessen lieber akustischen Instrumenten zuwenden.[67] Dies wirkt sich auch auf die Wahl von Musikstilen und –richtungen aus. Das gilt für Rockmusik ebenso, wie für Sparten der Neuen Musik, in denen mit Elektronik gearbeitet wird.
4.2.2.1 Beispiel Klavier
Katharina Herwig führte eine interessante Untersuchung zur Frau am Klavier durch. Sie wollte damit herausfinden, aus welcher Motivation heraus Jungen und Mädchen das Klavier als ihr Instrument wählen und inwiefern die Traditionen des 19. Jahrhunderts noch unbewusst Einfluss auf die Entscheidung nehmen.
Zunächst ist festzustellen, dass es an der untersuchten Musikschule fast doppelt so viele Klavierspielerinnen wie Klavierspieler gibt. Die Mädchen sind bei der Wahl des Instrumentes aktiver als die Jungen, fast die Hälfte von ihnen hat das Klavier selbst vorgeschlagen, bei den Jungen hingegen waren es weniger als ein Viertel.[68] Fast alle Klavierspielerinnen und drei Viertel der Klavierspieler gehen gern zum Unterricht. Bei den Jungen steht eher der spielerische Umgang, bei den Mädchen die ernsthafte Beschäftigung im Vordergrund.[69] Um herauszufinden, ob die Schüler Männer und Frauen am Klavier unterschiedlich bewerten, legte K. Herwig folgende zwei Bilder vor.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1 (Herwig 1996, S. 166) Bild 2 (Herwig 1996, S. 167)
Diese zeigen eine Frau und einen Mann am Klavier, wobei man nicht erkennt in welcher Situation und Umgebung beide spielen. Erstes Bild zeigt die Pianistin Monique de la Bruchollerie, zweites Johannes Brahms.[70] Bei den Antworten der Kinder zu diesen Bildern, sind deutliche Tendenzen zu erkennen. Es wurden dabei 28 Musikschüler, 22 Mädchen und 6 Jungen, im Alter von 6 bis 15 Jahren befragt.[71] 23 dieser Kinder gaben an, dass die Pianistin zu Hause spielt, nur 5 konnten sie sich im Konzert vorstellen. 15 hielten sie für eine Berufsmusikerin, 12 meinten, dass sie zum Spaß spielt, 1 Schüler konnte diese Frage nicht beantworten. 15 ordneten ihr eher große, schwierige Stücke zu, 12 eher kleine, leichtere. 1 Schüler konnte dies nicht beurteilen. Bei dem Brahms-Bild kam es zu einer völlig anderen Einschätzung. Ihn schätzten 19 Kinder eindeutig als Pianisten ein, der im Konzert spielt, nur 5 sahen ihn zu Hause am Flügel. Als Berufsmusiker ordneten ihn 21 Schüler ein, 6 sahen in ihm einen Hobbyspieler. 22 Schüler gaben an, dass er große, schwierige Stücke spielt, nur 5 ordneten ihm kleine, leichtere zu.[72]
Diese Antworten zeigen sehr deutlich, dass Instrumentalspiel immer noch von traditionellen Rollenfixierungen geprägt ist. Geht es um Professionalität, um öffentliches Auftreten im großen Rahmen, sind es Männer, die in den Vorstellungen der Kinder vorherrschen. Bei privatem Spiel bestimmen Frauen das Bild.[73]
4.2.2.2 Beispiel Rockinstrumente
Auch im Bereich der Rockinstrumente lässt sich ein ähnliches Bild erkennen. „Weil ich ein Mädchen bin, habe ich Blockflöte und Klavier gelernt – weil ich Junge bin, spiele ich E-Gitarre und Schlagzeug.“[74] In diesen Sätzen lassen sich zugespitzt die Ergebnisse der Shell-Studie von 1985 zur Musizierpraxis der Jugendlichen zusammenfassen. Auch wenn dies schon ca. 20 Jahre zurückliegt, hat sich das Bild nicht grundlegend verändert. Nach wie vor sind es Jungen, die vorwiegend an Instrumenten des Jazz-, Rock-, Popbereichs agieren. Als Ursache dafür sieht Knolle bestimmte Stereotype, die sich in den Köpfen der Menschen durch die Medien festgesetzt haben. So ist von der Männlichkeit der E-Gitarre die Rede und dies nicht mehr nur als Zuschreibung, sondern als „quasi naturhafte Eigenschaft“.[75] Jungen wählen sich auf der Suche nach der Männlichkeit natürlich besonders die Instrumente, die diese Männlichkeit ihrer Meinung nach ausdrücken. Rockinstrumente eignen sich als Ausdrucksmittel für Aggressivität, Dominanz und Köperpower und diese sehen sie als konstitutive Merkmale ihrer männlichen Identität.[76] Dies wird in den Medien immer wieder verstärkt.
In keiner anderen Sparte wie der Rock- und Popmusik werden „geschlechtstypische Körperinszenierungen so plakativ eingesetzt“.[77] In HipHop-Videos beispielsweise stellen sich muskulöse Männer mit nackten Oberkörpern, die oft tätowiert sind, als stark und dominant dar.[78] Auch in der Rockmusik dominiert eine „stereotype Darstellung männlicher Sexualität, bei der mit ausgeprägter Phallussymbolik Überlegenheit suggeriert wird“.[79] Und Frauen treten meist nur als Sängerinnen, die ihre körperlichen Reize einsetzen, in Erscheinung. Dieses sexualisierte Image von Rock und Pop hat die aktive musikalische Beteiligung von Frauen innerhalb dieses musikkulturellen Feldes über lange Zeit verhindert.[80] Musikerinnen, die in diesen Bereichen agieren, werden maskulinisiert oder ihnen werden bestenfalls androgyne Eigenschaften zugeschrieben. Diejenige, die sich dennoch als Rockmusikerin behauptet, muss sich vorrangig mit Bemerkungen zu ihrem Geschlecht auseinandersetzen und ist permanentem Druck im Vergleich mit ihren männlichen Kollegen ausgesetzt.[81]
All diese Fakten haben, wenn auch unbewusst, Einfluss auf die Instrumentenwahl von Kindern. Der Musikunterricht der Grundschule kann hier einen wichtigen Einfluss nehmen.
4.2.3 Tanzen
Tanzen nimmt einen wichtigen Bereich im Musikunterricht der Grundschule ein. Der Sächsische Lehrplan für Musik gibt für jede Klassenstufe das Bewegen zu Musik vor. Im Lernbereich 3: „Musik umsetzen, verbinden und in Beziehung bringen“, der mit jeweils 13 Unterrichtsstunden angesetzt ist, finden sich folgende Formulierungen: Musizieren mit dem Körper, Musik in körperlicher Bewegung umsetzen; sich tänzerisch bewegen. Hierbei soll es somit um das freie Bewegen und um das Einstudieren vorgefertigter Tanzformen wie Menuett, Polka, Popchoreographien usw. gehen. In der Klassenstufe vier gibt es weiterhin im Wahlpflichtbereich sechs die Möglichkeit, ein Tanzvideo einzustudieren.
Diese Lehrplanbetrachtung zeigt, dass ca. ¼ des Musikunterrichtes mit Bewegung gefüllt sein sollte. Ohne dies belegen zu können, glaube ich, dass dies an den meisten Schulen nicht der Fall ist.
Der Begriff „Tanzen“ selbst taucht im Lehrplan nur recht selten auf. Es wird hier als Musizieren mit dem Körper umschrieben. Dies könnte seine Ursache darin haben, dass „Tanzen“ keine feste Definition hat. „Dance can be many things to many people.“[82] Ein Aspekt von Tanz ist, dass praktische Ziele dabei in den Hintergrund treten. Er „entsteht aus der Lust an der Bewegung zu Musik und der Darstellung eigener Befindlichkeiten durch persönlich bedeutsame Bewegungen“.[83] Ein weiteres Merkmal von Tanz ist die Auseinandersetzung des Tanzenden mit der Musik.[84] Aspekte, die das Tanzen charakterisieren, sind also zusammenfassend: innere Beteiligung, das Ausdrucks- und Darstellungsstreben, die intensive Auseinandersetzung mit der Musik und der Spaß am Tanzen.[85]
Auch für die kognitive Leistung ist Tanzen wichtig, denn es vermittelt musikalische Grundkompetenzen. Am Ende der Grundschulzeit sollten davon folgende erreicht sein: musikalische Formen, Phrasen und Strukturen, Rhythmen und Taktarten, Parameter und den Ausdruck der Musik wahrnehmen und durch eine intensive Auseinandersetzung mit der Musik in eine differenzierte Form der Bewegungsgestaltung umsetzen können, wobei Musik und Bewegung als gleichberechtigte Kunstformen nebeneinander stehen und als solche betrachtet und behandelt werden.[86]
Werden beim Tanzen Geschlechtsstereotype erlebbar? „Echte Kerle tanzen nicht!“ Dieser Satz drückt aus, was viele Männer und Frauen auch heute noch denken.[87] Oder wie Renate Müller es beschreibt: „Wenn ich ohne gemeinsame tänzerische Vorerfahrung ankündige: ,Wir tanzen jetzt!’, flieht die männliche Hälfte der Klasse.“[88] C. Vogel befragte 122 Jungen und 98 Mädchen zur Frage „Tanzt du gerne?“. Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Vogl, S. 173)
Assoziationen zum „Mythos der männlichen Stärke und der weiblichen Schwäche“ verdichten sich, aus denen geschlechtstypische Regeln und Normen für den Umgang mit Körper, Bewegung und Sport resultieren.[89] Jungen und Männern wird ein „instrumentell-kompetitiver“ Umgang mit dem Körper zugeschrieben, von Frauen wird dagegen ein „expressiv-kreatives“, vor allem aber auch ein sensibles Verhältnis zu ihrem Körper erwartet.[90] Die instrumentelle Orientierung des Mannes, sein Durchsetzungsvermögen und seine Stärke, drücken sich angeblich in zweckbetonten, raumgreifenden und kraftbetonten Bewegungen aus. Der weibliche Körper soll dagegen Attraktivität ausstrahlen und den gängigen Schönheitsidealen entsprechen.[91]
Dies erlebte auch Ulrich Bangert. Als Mann ist es schwer, sich unvorbelastet dem Thema Tanzen in der Schule zu nähern. Das empfand er schon im Studium so, als er als einer von zwei Männern inmitten von 25 Frauen als Exot galt. Sie konnten sich der besonderen Aufmerksamkeit und Zuwendung der weiblichen Dozentin sicher sein. „Sie wollte uns bestimmt ermutigen und verstärken, aber manchmal wünschte ich mir, dass einfach nicht so viele Frauen so genau zugeschaut hätten.“[92] Dennoch ist er einer der wenigen, der mit seinen Schülern tanzt. Dabei ist es ihm wichtig, eigene Choreografien zu aktuellen Pophits zu entwerfen. Weiterhin bevorzugt er Formationstänze, da sie psychologischen Schutz bieten, weil die Schüler „viele andere um sich rum […] haben“.[93] Als Lehrer macht er grundsätzlich vor und mit. Denn viele Schülerinnen und Schüler schätzen es, wenn ein Mann mit seinen Sportklassen gemeinsam tanzt. Besonders heranwachsende junge Männer brauchen Vorbilder, um sich dem Tanzen nähern zu können.[94]
Auch das Lehrerverhalten spielt eine große Rolle. Dabei ist es wichtig, „Verständnis für das Gefühl von Unsicherheit, Ermutigung für das Ausprobieren, Akzeptanz von Schwächen, Gelassenheit bei vermeintlichen Unterrichtsverweigerungen auszudrücken“.[95] Aber auch ein klares, eindeutiges Einfordern von Aktivität, von Versuchen den Tanz mitzumachen, gehört zum erfolgreichen Vorgehen. In koedukativen Klassen machte Bangert die besten Erfahrungen mit einer festen Choreografie. Bereits innerhalb der ersten Doppelstunde erleben die Schüler dabei, was es bedeutet, in einer Formation mitzutanzen. Damit gelingt es schnell, „die Haltung zu erschüttern, dass Tanzen für Jungen doch eher nichts ist“.[96] Von monoeduaktivem Unterricht rät er ab, da dies zu einer Verengung von Themen und Erfahrungen führen kann. So könnte es passieren, dass männliche Lehrer das Tanzen in reinen Jungengruppen noch eher unter den Tisch fallen lassen.[97] „Das wäre schade: Wollen wir die so genannten weichen, emotionalen und expressiven Seiten in uns Männern noch weiter verkümmern lassen?“[98]
[...]
[1] Bowers, S. 22 f.
[2] Sächsischer Lehrplan Musik, S. 3
[3] Faulstich-Wieland 1991, S. 1
[4] Faulstich-Wieland 1991, S. 10
[5] vgl. ebd.
[6] vgl. ebd., S. 11
[7] vgl. ebd., S. 27
[8] vgl. ebd., S. 30
[9] vgl. ebd., S. 31
[10] Faulstich-Wieland 2000, S. 10
[11] vgl. Böhmann; Horstkemper, S. 50
[12] vgl. Preuss-Lausitz, S. 224
[13] Fleßner; Flaake, S. 138
[14] vgl. ebd., S. 139
[15] Preuss-Lausitz, S. 224
[16] vgl. Faulstich-Wieland 1991, S. 165
[17] vgl. Horstkemper, S. 59
[18] vgl. ebd.
[19] Preuss-Lausitz, S. 231
[20] vgl. Horstkemper, S. 59
[21] vgl. Faulstich-Wieland 2000, S. 10
[22] vgl. ebd.
[23] vgl. Böhmann; Horstkemper, S. 51
[24] vgl. Faulstich-Wieland 2000, S.11
[25] vgl. Böhmann; Horstkemper, S. 50
[26] Horstkemper, S. 58
[27] http://www.psychology48.com/deu/d/stereotype/stereotype.htmhttp://www.psychology48.com/deu/d/stereotype/stereotype.htm
[28] Alfermann, S. 9
[29] http://www.psychology48.com/deu/d/stereotype/stereotype.htm
[30] vgl. Alfermann, S. 9
[31] vgl. Alfermann, S. 12
[32] Dietzen, S. 76
[33] http://www.genderkompetenz.info/gendermainstreaming/grundlagen/stereotype/ 15.12.2008
[34] vgl. Biskup, S. 6
[35] vgl. ebd.
[36] Kaiser, S. 4
[37] vgl. ebd.
[38] vgl. ebd.
[39] vgl. ebd., S. 4f.
[40] vgl. ebd., S. 5f.
[41] vgl. Kaiser, S. 9
[42] vgl. Hassler, S. 25
[43] vgl. ebd., S. 26
[44] vgl. ebd.
[45] vgl. ebd.
[46] vgl. ebd.
[47] vgl. ebd.
[48] vgl. ebd., S. 27
[49] vgl. ebd.
[50] vgl. ebd., S.28
[51] vgl. ebd.
[52] vgl. ebd., S. 29
[53] vgl. ebd.
[54] Sächsischer Lehrplan Musik, S. 2
[55] Von Carl Orff zusammengestellte Instrumente, die es Schülern durch recht einfache Benutzungsweise ermöglichen, diese schnell spielen zu können. Dazu gehören Glockenspiele, Metallophone, Xylophone, Klanghölzer, Pauken, Trommeln, Schellen, Becken, Triangeln und verschiedene Rasseln.
[56] ebd., S. 17
[57] Hoffmann 1991, S. 28
[58] Hoffmann 1991, S. 28f
[59] Herwig, S. 222
[60] vgl. Vogl., S. 116
[61] Hoffmann 2002, S. 15
[62] vgl. ebd.
[63] vgl. Green, S. 153
[64] Green, S. 154
[65] Herwig, S. 231
[66] Hoffmann 2002, S. 16
[67] ebd.
[68] vgl. Herwig 1996, S. 148
[69] vgl. ebd., S. 152
[70] vgl. ebd., S. 155
[71] vgl. ebd., S. 156
[72] vgl. ebd., S. 156 f.
[73] vgl. ebd., S. 164
[74] Knolle, S. 45
[75] Knolle, S. 47
[76] vgl. ebd., S. 48
[77] Herold, S. 19
[78] vgl. ebd.
[79] ebd.
[80] vgl. Bloss, S. 39
[81] vgl. ebd.
[82] Karoß, S. 136
[83] Vogel 2004, S.14
[84] vgl. ebd.
[85] vgl. ebd., S. 15
[86] vgl. Vogel 2003, S. 20
[87] Herold, S. 18
[88] Müller 1991, S. 46
[89] vgl. Biskup, S. 6
[90] ebd.
[91] vgl. ebd.
[92] Bangert, S. 5
[93] ebd.
[94] vgl. ebd.
[95] ebd.
[96] ebd.
[97] vgl. ebd.
[98] ebd.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeit zur Koedukation im Musikunterricht?
Die Arbeit untersucht, ob die gemeinsame Erziehung von Jungen und Mädchen (Koedukation) im Musikunterricht dazu beitragen kann, Geschlechtsstereotype abzubauen oder ob sie diese eher verfestigt.
Wie wird Koedukation in der Arbeit definiert?
Koedukation bezeichnet die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung von Mädchen und Jungen in Schulen und Internaten, mit dem Ziel der Gleichberechtigung.
Was ist "Reflexive Koedukation"?
Dies ist ein von Faulstich-Wieland geprägter Begriff. Er besagt, dass Schüler nicht nur gemeinsam unterrichtet werden, sondern auch aktiv über geschlechtsspezifische Themen und den "heimlichen Lehrplan" der Sozialisation nachdenken sollen.
Welche Rolle spielen Geschlechtsstereotype bei der Instrumentenwahl?
Die Arbeit zeigt auf, dass Instrumente oft geschlechtsspezifisch besetzt sind, etwa Rockinstrumente für Jungen oder das Singen und Tanzen als vermeintliche "Mädchensachen".
Wie hat sich die Koedukation historisch in Deutschland entwickelt?
Von einer strikten Trennung im 18. und 19. Jahrhundert über erste Ansätze in der Weimarer Republik bis hin zur flächendeckenden Einführung in den 1970er Jahren (Westdeutschland) bzw. ab 1945 (DDR).
Welche Probleme werden für Jungen im aktuellen Schulsystem genannt?
Jungen werden häufiger zurückgestellt, bleiben öfter sitzen und erzielen seltener höhere Bildungsabschlüsse als Mädchen, was auf eine Benachteiligung durch das aktuelle System hindeuten könnte.
- Citation du texte
- Katharina Hofmann (Auteur), 2009, Koedukation als Antwort auf Geschlechtsstereotype?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136489