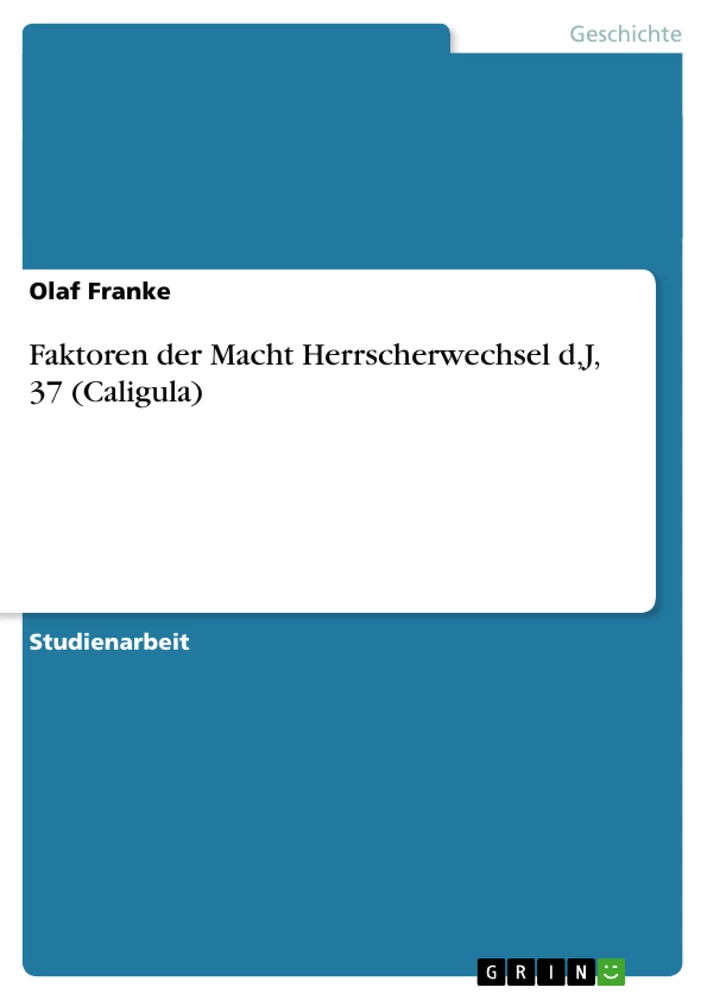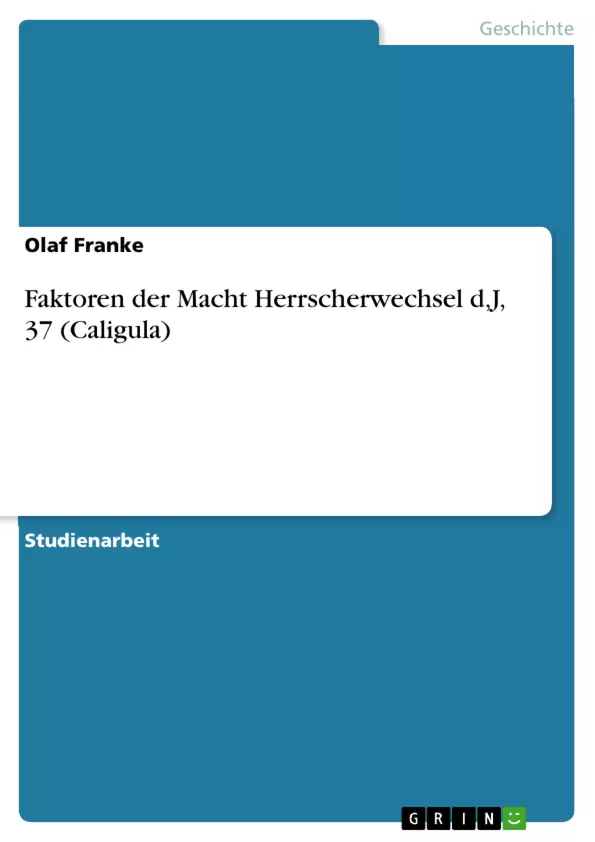Am 16. März 37 stirbt Tiberius unter ungeklärten Umständen. Die in Misenum anwesenden
Prätorianer rufen Caligula zum Imperator aus. Die Bevölkerung Campaniens leistet Caligula
den Treueeid1. Dieser teilt dem Senat seine Ausrufung zum Princeps mit und bittet den Senat
um Bestätigung dieses Aktes 2. Parallel zum Verfahren nach dem Tod des Augustus lässt
der neue Princeps nach Dio 59,3,1 -2 das Testament des Tiberius durch Macro an den Senat
überbringen und dort verlesen.3 Caligula und Gemellus, leiblicher Enkel des Tiberius, erben
zu gleichen Teilen, doch auf Betreiben Caligulas annulliert der Senat das Testament.4
Schließlich werden am 29.3. auf einer Senatssitzung alle „Kompetenzen und Ehrenrechte,
die Augustus und Tiberius innegehabt hatten“5, auf Caligula übertragen.
Der Herrschaftsantritt des fünfundzwanzigjährigen Caligula scheint somit ohne Komplikationen
vonstatten gegangen zu sein. Nach dem mühevollen Weg, den Augustus hatte zurücklegen
müssen, um nach und nach einzelne Vollmachten auf seiner Person zu vereinigen und
nach der von langer Hand vorbereiteten Nachfolgeregelungen für Tiberius erscheint der
Herrscherwechsel des Jahres 37 eher wie ein Spaziergang. Anders als seine beiden Vorgänger
Augustus und Tiberius, denen die einzelnen Regierungsvollmachten nach und nach
übertragen wurden, erhält Caligula alle Vollmachten en bloc und an einem Tag.
Um so erstaunlicher wird dies angesichts der Tatsache, dass Senat und Volk von Rom die
unumschränkte Herrschaft einem völlig unerfahrenen jungen Mann übertrugen, dessen Position
auch dadurch uneindeutig war, dass er von seinem Vorgänger weder als dessen Nachfolger
designiert6 und darüber hinaus auch nur zur Hälfte als dessen Erbe eingesetzt worden
war, was seine politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht begünstigte.7 Caligula
war zudem gänzlich Privatmann und ohne jede öffentliche Verdienste oder Befugnisse.8 [...]
1 siehe dazu weiter unten zum Treueid von Aritium
2 Christ hält dies zu Recht für „staatsrechtlich nicht unerheblich.“ Christ, S. 209
3 Tiberius vererbt größere Legate an Soldaten, römische Bürger, Vestalische Jungfrauen, sowie magistri vico-rum. Suet, Tib.76
4 Suet Cal 14; Dio 59, 3,1-2
5 Christ, S.210; Cassius Dio 59.3.1-2
6 Wie es Augustus mit seinen Favoriten und letztendlich mit Tiberius selbst durch Adoption vollzogen hatte.
7 Barrett S. xix
8 Timpe S.62f, Flaig 220,
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Herrschaftsantritt des Caligula
- Die fehlende Designation
- Die unklare Nachfolge
- Die Kandidaten
- Gemellus
- Claudius
- Caligula
- Die fehlende Adoption
- Das Testament
- Die Übertragung der Vollmachten
- Die imperatorische Akklamation und die Rolle des Militärs
- Die Legalisierung des Herrscherwechsels und die Rolle des Senats
- Die Plebs urbana und die Komitien
- Die sogenannte Lex de imperio
- Der Kaiser als Privatpatron und der Gefolgschaftseid von Aritium
- Die Widmung
- Der Wortlaut
- Die Bedeutung
- Exkurs: Die Rolle Caligulas
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Herrschaftsantritt des römischen Kaisers Caligula im Jahr 37 n. Chr. und beleuchtet die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen dieses historischen Ereignisses. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie Caligula, ein politisch unerfahrener junger Mann, ohne klare Designation und mit nur teilweiser Erbschaft, die Macht übernehmen konnte.
- Die Rolle des Militärs und des Senats bei der Machtergreifung
- Die Bedeutung des Testaments des Tiberius und dessen Einfluss auf Caligulas Position
- Die rechtliche Grundlage des Herrschaftsantritts Caligulas und die Rolle der Lex de Imperio
- Die Akzeptanz Caligulas durch die Bevölkerung und die Bedeutung der auctoritas
- Die Modellfunktion des Herrschaftsantritts Caligulas für die Institutionalisierung des römischen Prinzipats
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische Situation des Todes von Tiberius und den Aufstieg Caligulas zum Imperator dar. Sie führt in die Forschungsfrage ein und skizziert die wichtigsten Themenbereiche der Arbeit. Das Kapitel "Der Herrschaftsantritt des Caligula" behandelt die komplizierte Nachfolgefrage, die fehlende Designation und die ungeklärte Erbschaft. Dabei werden die Rollen des Senats, des Militärs und der Bevölkerung beleuchtet. Der Gefolgschaftseid von Aritium und die Lex de Imperio werden als wichtige Quellen für das Verständnis des Herrschaftsantritts Caligulas analysiert. Der Exkurs „Die Rolle Caligulas“ beleuchtet die Persönlichkeit und die politische Position Caligulas im Kontext der römischen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Herrschaftsantritt, Caligula, Tiberius, Prinzipat, Senat, Militär, Bevölkerung, Lex de Imperio, Gefolgschaftseid, Machtübertragung, auctoritas, Modellfunktion, Institutionalisierung. Die Arbeit befasst sich mit den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Herrschaftsantritts Caligulas und analysiert die Rolle der verschiedenen Akteure und Institutionen.
Häufig gestellte Fragen
Wie verlief der Herrschaftsantritt von Caligula?
Nach dem Tod von Tiberius im Jahr 37 n. Chr. wurde Caligula von den Prätorianern ausgerufen und erhielt vom Senat alle Vollmachten en bloc an einem einzigen Tag.
Warum war Caligulas Machtübernahme rechtlich problematisch?
Caligula war politisch unerfahren, besaß keine öffentliche Ämter und war im Testament des Tiberius nur zur Hälfte als Erbe eingesetzt (neben Gemellus), zudem fehlte eine formale Adoption.
Welche Rolle spielte das Militär beim Machtwechsel?
Die Prätorianer unter Macro spielten eine entscheidende Rolle durch die imperatorische Akklamation, die den Senat faktisch unter Druck setzte.
Was ist der Gefolgschaftseid von Aritium?
Es ist ein Treueeid der Bevölkerung, der die persönliche Bindung zwischen dem neuen Kaiser und seinen Untertanen (Kaiser als Privatpatron) dokumentiert.
Was bedeutet "Lex de imperio" im Zusammenhang mit Caligula?
Es bezeichnet die gesetzliche Übertragung der Herrschaftsbefugnisse durch den Senat und das Volk, was zur Institutionalisierung des Prinzipats beitrug.
- Quote paper
- Olaf Franke (Author), 1999, Faktoren der Macht Herrscherwechsel d,J, 37 (Caligula), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13650