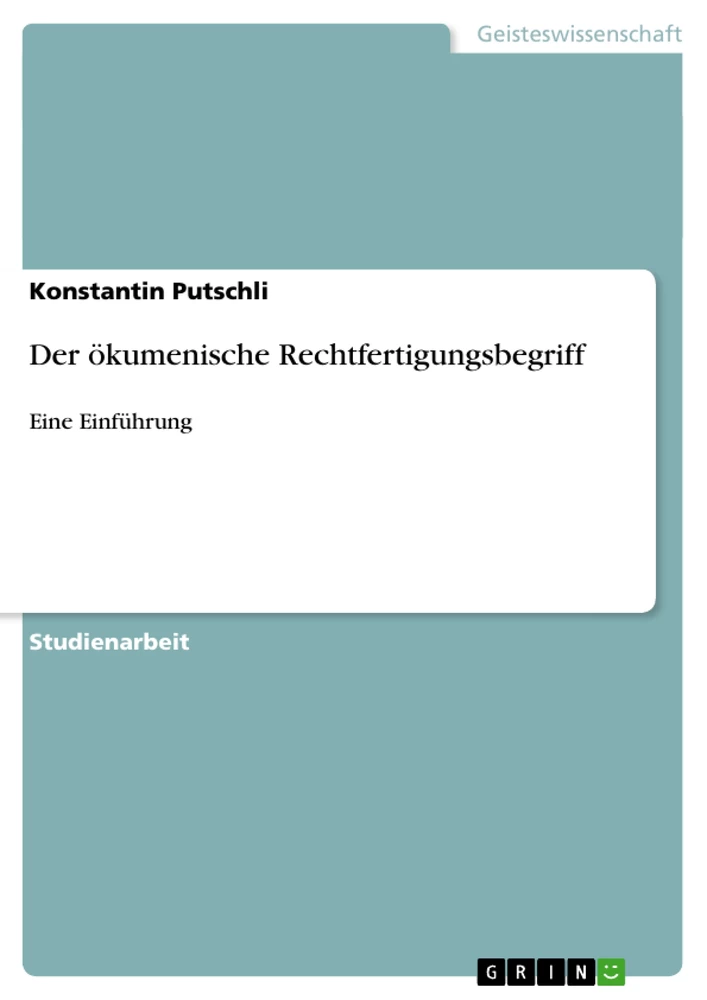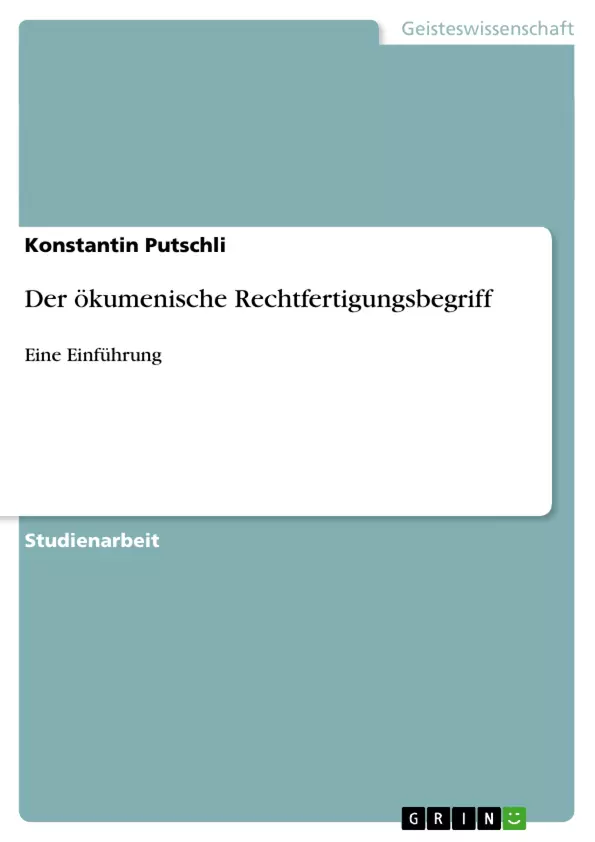„ [Am 31.10.1999 in] Augsburg - die Versöhnung von Katholiken- und Lutheraner in einer Grundsatzfrage des Glaubens wurde symbolträchtig inszeniert. Am Reformationstag, an dem die evangelischen Kirchen an den Beginn der Kirchenspaltung vor fast 500 Jahren erinnern, unterzeichneten hohe Vertreter des Vatikans und des lutherischen Weltbundes in Augsburg die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Mehr als 30 Jahre arbeiteten Theologen an diesem Dokument.“ Dieser Zeitungsartikel wirft natürlich viele Fragen auf. Warum hat das solange gedauert? worin liegt eigentlich die auf beiden Seiten bestehende Kritik an dem je unterschiedlichen Verständnis der Rechtfertigungslehre. Vorliegende Arbeit versucht einen ersten Zugang zum Rechtfertigungsbegriff zu geben, mit Rücksicht auf konfessionsspezifische Denkansätze. Um einen besseren Eindruck in die Thematik zu gewinnen, beschäftigen wir uns zunächst mit der geschichtlichen Entfaltung der Rechtfertigungslehre über Paulus bis Luther und der katholischen Antwort auf die Reformation im Konzil von Trient. Der Hauptschwerpunkt dieser Arbeit, nämlich die Rechtfertigungslehre als ökomenisch geprägten theologischen Grundbegriff zu erfassen, soll dann im Abschnitt 2.1 ‚Rechtfertigung als theologischer Grundbegriff’ unter dem Hintergrund des am 31.10.1999 unterzeichneten Dokuments der „Gemeinsame Erklärung der Rechtfertigungslehre“ bearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
1 DIE GESCHICHTLICHE ENTFALTUNG DES RECHTFERTIGUNGSBEGRIFFS
1.1 PAULUS
1.2 DIE REFORMATIONSZEIT
1.3 DAS KONZIL VON TRIENT (1545-1563)
2 DIE „GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR RECHTFERTIGUNGSLEHRE“
2.1 RECHTFERTIGUNG ALS THEOLOGISCHER GRUNDBEGRIFF
SCHLUSS
3 QUELLENVERZEICHNIS
3.1 INTERNET-LINKS
3.2 LITERATUR
EINLEITUNG
„ [Am 31.10.1999 in] Augsburg - die Versöhnung von Katholiken- und Lutheraner in einer Grundsatzfrage des Glaubens wurde symbolträchtig inszeniert. Am Reformationstag, an dem die evangelischen Kirchen an den Beginn der Kirchenspaltung vor fast 500 Jahren erinnern, unterzeichneten hohe Vertreter des Vatikans und des lutherischen Weltbundes in Augsburg die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Mehr als 30 Jahre arbeiteten Theologen an diesem Dokument.“[1]
Dieser Zeitungsartikel wirft natürlich viele Fragen auf. Warum hat das solange gedauert? worin liegt eigentlich die auf beiden Seiten bestehende Kritik an dem je unterschiedlichen Verständnis der Rechtfertigungslehre.
Vorliegende Arbeit versucht einen ersten Zugang zum Rechtfertigungsbegriff zu geben, mit Rücksicht auf konfessionsspezifische Denkansätze. Um einen besseren Eindruck in die Thematik zu gewinnen, beschäftigen wir uns zunächst mit der geschichtlichen Entfaltung der Rechtfertigungslehre über Paulus bis Luther und der katholischen Antwort auf die Reformation im Konzil von Trient.
Der Hauptschwerpunkt dieser Arbeit, nämlich die Rechtfertigungslehre als ökomenisch geprägten theologischen Grundbegriff zu erfassen, soll dann im Abschnitt 2.1 ‚Rechtfertigung als theologischer Grundbegriff’ unter dem Hintergrund des am 31.10.1999 unterzeichneten Dokuments der „ Gemeinsame Erklärung der Rechtfertigungslehre“ bearbeitet werden.
Aufgrund der Fülle der Literatur, der Kritik und der Gewichtigkeit des Themas erhebt diese Arbeit, in keinem Abschnitt Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll aber den Blickwinkel weiten und den Leser offen für die Denkansätze beider Konfessionen machen.
1 DIE GESCHICHTLICHE ENTFALTUNG DES RECHTFERTIGUNGSBEGRIFFS
1.1 PAULUS
Der Begriff Rechtfertigung hat seinen biblischen Ursprung im Römerbrief und im Galaterbrief des Neuen Testaments. Zunächst betrachten wir den Römer Brief, auch im Hinblick auf seine historischen Rahmenbedingungen. Paulus entwickelte die Rechtfertigungslehre mit der besonderen Absicht, der Gemeinde in Rom und den Heidenchristen vor einem falschen Verständnis von Gesetzestreue zu bewaren[2]. Einen Großteil der ersten Christen bildeten zunächst die Juden, welche sehr gesetzestreu lebten. Für die Juden hat die Tora ( hebr. = Weisung, Gesetz ) mit dem Dekalog, als Geschenk Gottes einen hohen Stellenwert. Gemeinhin galt es nach dem Gesetz zu leben um dadurch vor Gott als gerecht zu gelten. Paulus wendet sich entschieden dagegen und stellt fest, das alle Menschen vor Gott schuldig sind. Die Begründung finden wir in seinem Brief an die Römer, indem er schreibt: „... weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm [Gott] gerecht sein kann.“ (Röm 3,20). Das Gesetz wurde von den Juden als Erlösungsweg von der Sünde fehl interpretiert. Paulus weißt dieses Denken zurück, indem er das Gesetz als etwas ansieht, das man als Überführung von der Sünde benutzen kann. Paulus mochte das Hauptaugenmerk auf den Glauben an Jesus Christus und der durch ihn gewirkten Heilstat gesetzt wissen.
Ein weiteres Beispiel dafür ist, die Auseinandersetzung mit der Gemeinde in Galazien, zu lesen im Galaterbrief. Die Gemeinde in Galazien, welche noch fest mit den jüdischen Bräuchen verbundenen war, wollte zunächst den hinzuströmenden Heiden, ein jüdisches Leben aufzwingen. Sie forderten zum Beispiel die Beschneidung und die Nachahmung der jüdischen Speisevorschriften seitens der Heiden. Dies begründeten die Judaisten mit der These, dass die Einhaltung des Gesetzes als Grundvoraussetzung für die Teilhabe am Heil Christi gilt. Paulus verurteilt dieses gesetzesorientierte Denken, indem er es als Knechtschaft dem Gesetz gegenüber bezeichnet. Dieser Knechtschaft stellt Paulus die Freiheit durch den Glauben an Jesus gegenüber.
Bis ins Mittelalter wurde die Rechtfertigungslehre durch die Gnadenlehre des Kirchenvaters Augustinus (354-430) geprägt. Thomas v. Aquin (1225-1274) beeinflusst von Augustinus führte diese Lehre fort. Für ihn galt die Rechtfertigung als Gnadengeschenk Gottes, welche der Mensch nicht auf irgendwelche Art verdienen konnte. Er proklamierte das die Gnade Gottes dem Menschen durch die Sakramente zuteil wird.[3] Mit Hilfe der gratia infusa (lat. = eingegossene Gnade) kann man jetzt Verdienste vor Gott erwerben, welche dem Wirken des Heiligen Geistes in uns selber Ausdruck verleihen. Im späten Mittelalter wird dies durch Duns Scotus (1266-1308) und Wilhelm von Ockham (ca. 1285-1349) sogar zur notwendigen aber nicht hinreichenden Bedingung.[4]
Zur Zeit der Scholastik wurde die Notwendigkeit von guten Werken für die Gnadenerwerbung, von der Kirche immer stärker in den Mittelpunkt gestellt. Ein Symbol dafür war der ausgeprägte Ablasshandel, bei welchen man sich gegen Geldspenden frei von Bestrafung der Sünden kaufen konnte. Diese Auswüchse waren wesentliche Gründe für den schnellen und breiten Erfolg der Reformation, welche ein andere Sichtweise proklamierte.
1.2 DIE REFORMATIONSZEIT
Martin Luther (1483-1546) erkannte bei der Untersuchung des Römerbriefs[5], dass das Rechtfertigungsgeschehen allein des Glaubens und der Gnade Gottes (sola gratia) bedarf.[6] Die Rechtfertigungslehre wurde zum zentralen Bekenntnis der Reformatoren. An dieser Stelle soll kurz, über deren damalige Sichtweise berichtet werden. Der Mensch bleibt ein sündiges Wesen, aber durch Gottes Sohn der für unsere Sünden starb, wird er gnädigerweise gerecht gesprochen. Der gerechtfertigte Mensch ist „simul iustus et peccator“[7] (lat. = zugleich gerecht und Sünder). Zunächst bedeutet das, das der Christ durch die Taufe ganz gerecht wird, weil Gott ihn diese Gerechtigkeit zuspricht. Diese Gerechtigkeit entwickelt sich während des Christenlebens aus den Vertrauen auf Gott, aber sie wird durch die Begierde des Menschen gehemmt. Für Luther ist diese Begierde Sünde an sich.[8]
Der Mensch wird vor dem Gericht Gottes, im juristischem Sinn gesehen für gerecht erklärt. Luther meinte damit nicht, dass die Gerechtigkeit Gottes dem Menschen weder von innen, noch als Geschenk von außen zuteil wird. Sie hängt einzig von Gottes gnädiger Gesinnung ab.[9] Gott wird als Richter gesehen, welcher über den Menschen sein Urteil verhängt. Das Augsburger Bekenntnis (1530) und die Konkordienformel (1555) schrieben dieses forensische (lat.=juristisch-gerichtlich)[10] Verständnis der Rechtfertigungslehre für die Lutheraner gültig fest.
[...]
[1] Loheide, zitiert nach: epd-Dokumentation 52a/99, 15.
[2] Vgl. Vorgrimler, 527.
[3] Vgl. Pesch, Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, 332ff.
[4] Vgl. Ebd.
[5] Speziell Röm 3,28: „ So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. “ In: LUTHER Bibel. Revidierte Fassung. Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 1984, 1101.
[6] Vgl. Pesch, Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, 334ff.
[7] Zitiert nach: Härle 389; bei SANDERS, Paulus. Eine Einführung, (engl. 1991) 1995, 65.; bei Luther WA 56, 269f. 343.347.
[8] Vgl. Härle 390.
[9] Vgl. Vorgrimler, 528.
[10] Hanselmann, 72.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“?
Ein historisches Dokument, das am 31.10.1999 in Augsburg unterzeichnet wurde, um den jahrhundertelangen Streit zwischen Katholiken und Lutheranern über die Frage der Errettung des Menschen beizulegen.
Was bedeutet „Rechtfertigung“ im theologischen Sinne?
Es beschreibt den Vorgang, wie ein Mensch vor Gott als gerecht gilt. Paulus lehrte im Neuen Testament, dass dies allein durch den Glauben und nicht durch Gesetzeswerke geschieht.
Was war Martin Luthers zentrale Erkenntnis zur Rechtfertigung?
Luther erkannte, dass der Mensch „simul iustus et peccator“ (zugleich gerecht und Sünder) ist und die Gerechtigkeit allein durch Gottes Gnade (sola gratia) zugesprochen bekommt.
Wie reagierte die katholische Kirche im Konzil von Trient?
Das Konzil von Trient (1545-1563) formulierte die katholische Antwort auf die Reformation und betonte die Notwendigkeit der Mitwirkung des Menschen durch Sakramente und gute Werke.
Warum ist das Dokument von 1999 so bedeutend?
Es zeigt einen ökumenischen Konsens auf, der nach über 30-jähriger Arbeit von Theologen erreicht wurde und die gegenseitigen Verurteilungen der Reformationszeit in dieser Kernfrage aufhebt.
- Citation du texte
- Konstantin Putschli (Auteur), 2007, Der ökumenische Rechtfertigungsbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136522