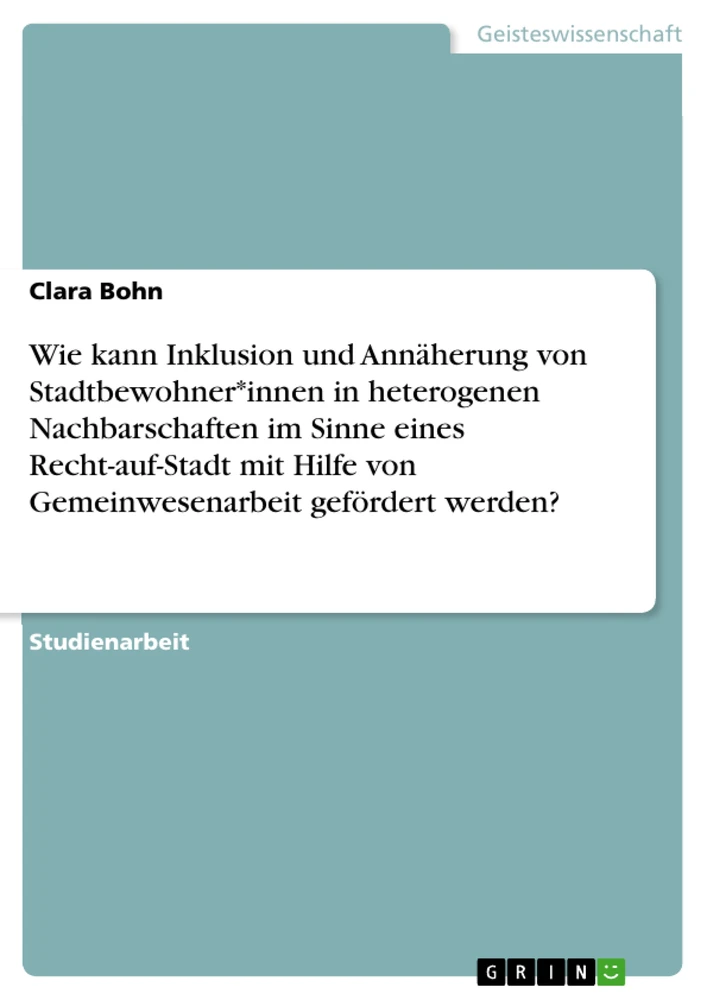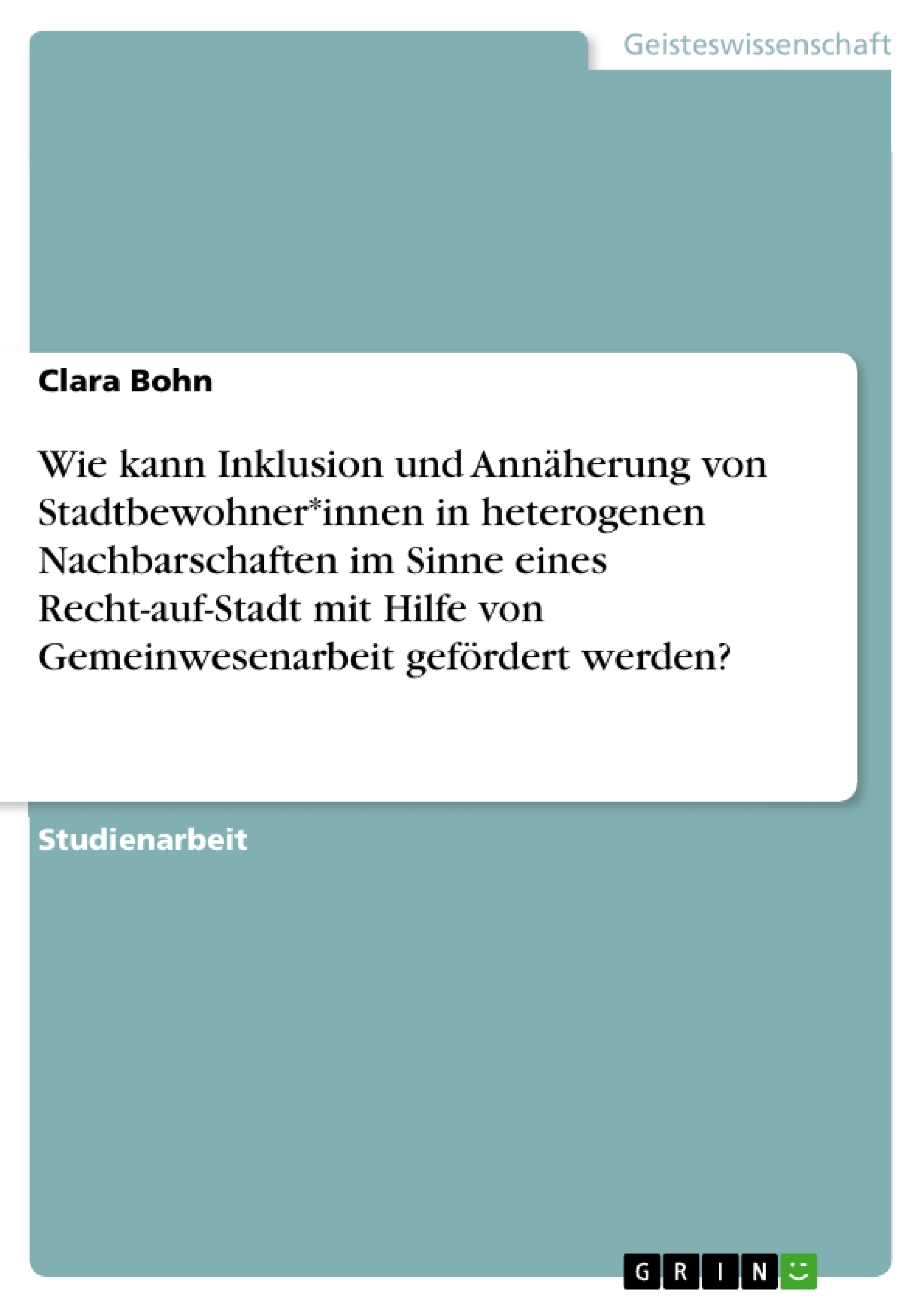In der folgenden Arbeit werden die wichtigsten Inhalte der Recht-auf-Stadt-Bewegung zusammengefasst. Es folgt eine kurze Information über die aktuelle politische Lage. Des Weiteren werden Überlegungen angestellt, wie inklusive Nachbarschaften im Sinne eines Recht auf Stadt aussehen könnten. Anschließend wird eine Brücke zum Thema Gemeinwesenarbeit geschlagen und geprüft, inwiefern Selbige eine Rolle im Mikrokosmos Nachbarschaft spielt, insbesondere in heterogenen Nachbarschaften. Im Punkt Zukunftsblick wird nach konkreten Maßnahmen gesucht, die zu ergreifen sind, um ein langfristiges, nachhaltiges, lebendiges Miteinander zu generieren. Ein Fazit rahmt die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Henri Lefebvres Recht auf Stadt
- Ursprung
- Adressat*innen
- Aktuelle Situation
- Inklusive Nachbarschaften im Sinne eines Recht auf Stadt
- Rolle der Gemeinwesenarbeit in heterogenen Nachbarschaften
- Zukunftsblick
- Beziehungsaufbau
- Partizipation und Kommunikation
- Begegnungsmöglichkeiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Förderung von Inklusion und Annäherung von Stadtbewohner*innen in heterogenen Nachbarschaften im Sinne eines Recht-auf-Stadt mit Hilfe der Gemeinwesenarbeit zu untersuchen. Dabei soll die aktuelle Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine und deren Zukunft in Deutschland berücksichtigt werden.
- Recht auf Stadt im Kontext der aktuellen Situation
- Inklusive Nachbarschaften im Sinne eines Recht auf Stadt
- Rolle der Gemeinwesenarbeit in heterogenen Nachbarschaften
- Langfristige Maßnahmen zur Förderung von Inklusion und Annäherung
- Zukunftsblick auf ein nachhaltiges Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den aktuellen Bedarf für eine Abhandlung über die Integration von Geflüchteten in Deutschland dar und legt den Fokus auf die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept des Recht auf Stadt, das von Henri Lefebvre geprägt wurde. Es beleuchtet den Ursprung des Begriffs, die Adressat*innen der Bewegung und die kritische Sicht auf den urbanen Raum.
- Kapitel 3 liefert einen Überblick über die aktuelle Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine und deren Integration in Deutschland. Es werden Herausforderungen und die Notwendigkeit für langfristige Integrationsmaßnahmen aufgezeigt.
- Kapitel 4 untersucht, wie inklusive Nachbarschaften im Sinne eines Recht auf Stadt aussehen könnten. Es beleuchtet die Bedeutung von Teilhabe, Begegnung und einem gemeinsamen Gestaltungsprozess des urbanen Raums.
- Im fünften Kapitel wird die Rolle der Gemeinwesenarbeit in heterogenen Nachbarschaften betrachtet. Es wird aufgezeigt, wie Gemeinwesenarbeit dazu beitragen kann, Inklusion und Annäherung zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselwörter Inklusion, Recht auf Stadt, Gemeinwesenarbeit, Heterogene Nachbarschaften, Integration, Flüchtlinge, Ukraine, und Partizipation.
- Citar trabajo
- Clara Bohn (Autor), 2022, Wie kann Inklusion und Annäherung von Stadtbewohner*innen in heterogenen Nachbarschaften im Sinne eines Recht-auf-Stadt mit Hilfe von Gemeinwesenarbeit gefördert werden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1366009