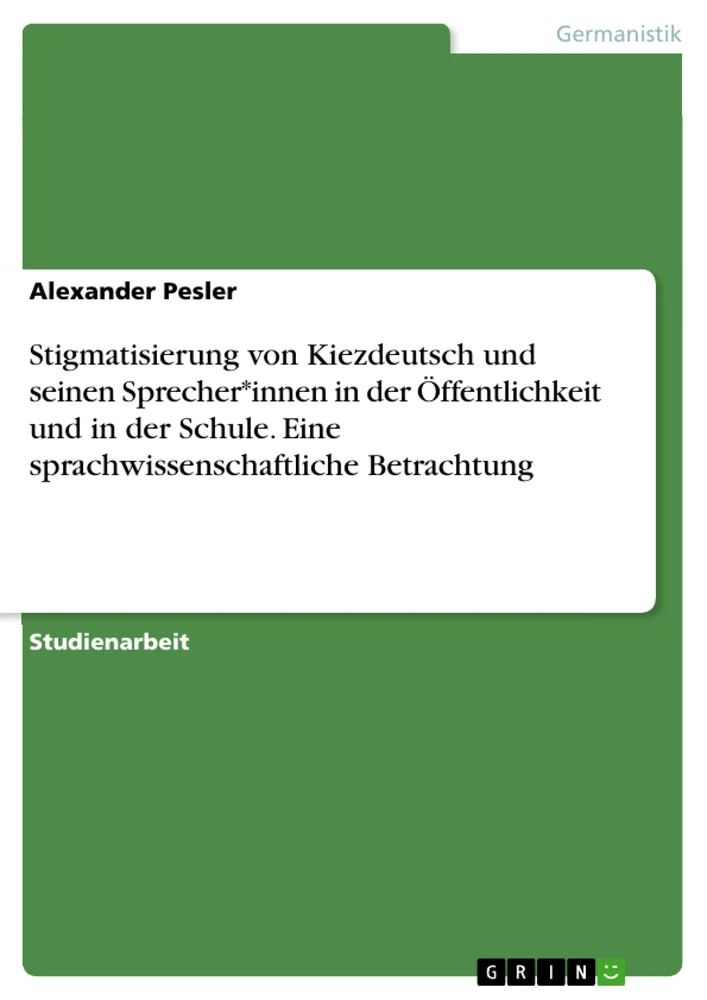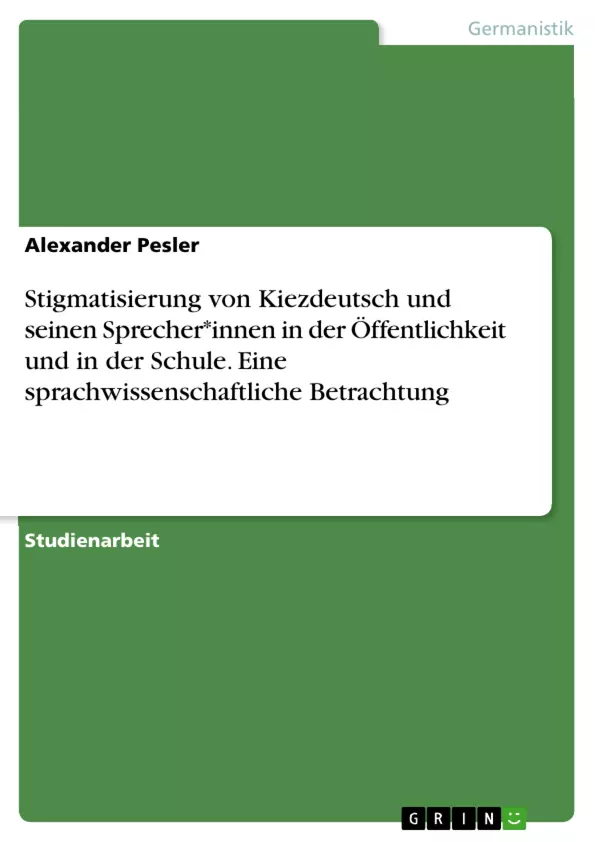Ziel dieser Arbeit ist es, Kiezdeutsch als eine linguistische Varietät des Deutschen einzuordnen, dadurch einen Beitrag zu leisten, ein differenziertes Verständnis für Kiezdeutsch zu entwickeln und Vorurteile, insbesondere gegenüber seinen Sprecher*innen, abzubauen.
Nachdem in einer theoretischen Einbettung Kiezdeutsch zunächst im Kontext der deutschen Sprache und der öffentlichen Wahrnehmung verortet werden soll, widmet sich der Hauptteil der vorliegenden Arbeit der Betrachtung des Kiezdeutschen als linguistische Varietät sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch im Schulunterricht. Abschließend werden die Ergebnisse in einem Fazit resümiert und die gezogenen Erkenntnisse noch einmal verdeutlicht.
Das Forschungsinteresse beruht dementsprechend nicht nur auf der Aktualität der Thematik, sondern v.a. auf der Korrektur der oftmals unverhältnismäßig negativen Kritik, welche nicht nur einen falschen Eindruck von Kiezdeutsch, sondern auch von seinen Sprecher*innen vermittelt.
Die vorliegende Arbeit folgt dabei stets der vom Verfasser aufgestellten Hypothese, dass Kiezdeutsch als eine linguistische Varietät des Deutschen verstanden werden muss, die sich mit der häufig als höherwertig empfundenen Standardsprache auf einer gemeinsamen Ebene bewegt. Der Forschungsstand zu Kiezdeutsch ist auf Grundlage der im Jahre 2012 erschienenen Monographie von Heike Wiese, an welcher sich die Ausführungen der vorliegenden Arbeit u.a. orientieren, deutlich gewachsen - auch wenn neuere Forschungsbeiträge aus der jüngeren Vergangenheit eher selten sind. Dennoch betont die nach wie vor negative Wahrnehmung von Kiezdeutsch die Relevanz einer reflektierten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Öffentliche Wahrnehmung und sprachwissenschaftliche Sicht.
- 2.1 Sprachliche Ideologien und ihre Auswirkungen
- 2.2 Kiezdeutsch als Jugend- und Kontaktsprache.
- 3. Kiezdeutsch als linguistische Varietät
- 3.1 Merkmale von Kiezdeutsch und seine situationsbezogene Verwendung
- 3.2 Kiezdeutsch in der Schule
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, Kiezdeutsch als eine linguistische Varietät des Deutschen einzuordnen, dadurch einen Beitrag zu leisten, ein differenziertes Verständnis für Kiezdeutsch zu entwickeln und Vorurteile, insbesondere gegenüber seinen Sprecher*innen, abzubauen.
- Kiezdeutsch im Kontext der deutschen Sprache und der öffentlichen Wahrnehmung
- Kiezdeutsch als linguistische Varietät in der öffentlichen Diskussion
- Kiezdeutsch im Schulunterricht
- Kiezdeutsch als sprachliche Entwicklung und seine Bedeutung für die deutsche Sprache
- Die Rolle von sprachlichen Ideologien bei der Stigmatisierung von Kiezdeutsch und seinen Sprecher*innen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die kontroverse öffentliche Diskussion um Kiezdeutsch und die oftmals negative Kritik, welche die betroffenen Sprecher*innen stigmatisiert.
Kapitel 2 setzt sich mit der öffentlichen Wahrnehmung von Kiezdeutsch und der dazu divergierenden sprachwissenschaftlichen Sicht auseinander. Es werden sprachliche Ideologien als wesentlicher Faktor für die Stigmatisierung von Kiezdeutsch und seinen Sprecher*innen identifiziert.
Kapitel 3 untersucht Kiezdeutsch als linguistische Varietät, analysiert seine Merkmale und seine situationsbezogene Verwendung. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Rolle von Kiezdeutsch im Schulunterricht.
Schlüsselwörter
Kiezdeutsch, Sprachliche Ideologien, Sprachliche Varietät, Jugendsprache, Kontaktsprache, Stigmatisierung, Standardsprache, Bildung, Öffentliche Wahrnehmung, Linguistik, Schule.
- Citation du texte
- Alexander Pesler (Auteur), 2023, Stigmatisierung von Kiezdeutsch und seinen Sprecher*innen in der Öffentlichkeit und in der Schule. Eine sprachwissenschaftliche Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1366213