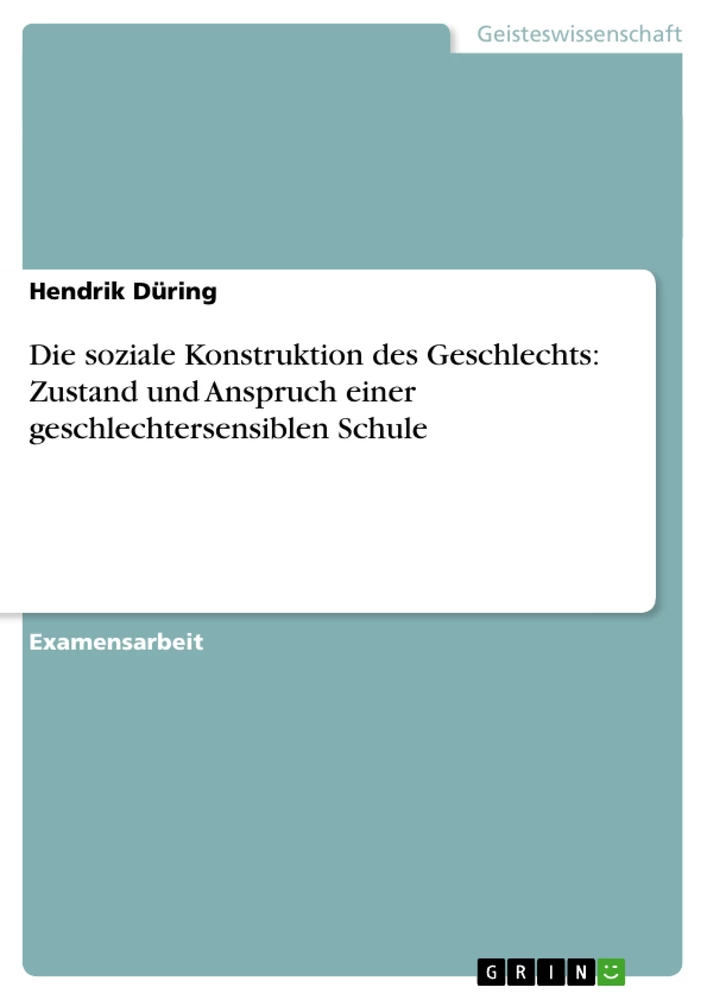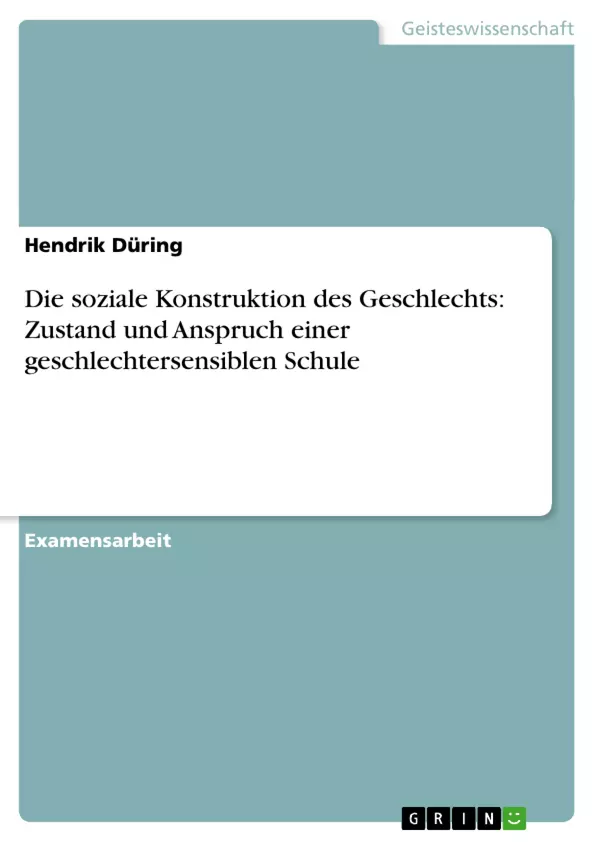„Jungen wollen mit Sachen spielen, Mädchen zwischenmenschliche Beziehungen pflegen. Jungen wollen andere lenken, dominieren und nach oben kommen, Mädchen beschäftigen sich mehr mit moralischen Fragen, Beziehungen und Menschen. Frauen stellen immer noch eine Minderheit im Geschäftsleben und der Politik dar, jedoch nicht weil sie unterdrückt werden – sie interessieren sich schlicht und ergreifend weniger für diese Gebiete.“
So befunden im internationalen Bestseller von ALLAN und BARBARA PEASE „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken können“. Differenzen der Geschlechter werden dieser Sichtweise folgend naturalisiert und unter dem Diktum ‚ Unsere Biologie hat sich nicht grundlegend geändert sozial deterministisch verbucht. Schlagwörter wie ‚Gleiche Spezies - andere Welten'sind dabei exemplarisch einem medialen Diskurs um die Geschlechterdifferenz zu entnehmen, der hartnäckig auf typische, dem jeweiligen Geschlecht eigene Merkmale verweist. Ob in Buchform oder TV-
Showformaten, ‚ doing gender’ scheint seinen Reiz nicht verloren und damit Konjunktur zu haben. Im Ergebnis stärkt eine solche Auseinandersetzung gängige, stark typisierende Geschlechterrollen und lässt erforderliche Ausgewogenheit vermissen. Trotz der Tradition der Geschlechterforschung, aus dem kritischen Feminismus der 1960er und 1970er Jahre hervorgegangen, ist die Beschäftigung mit Fragen der Entstehung gesellschaftlicher Unterschiede auf Basis des Geschlechts aktuell. Die biologische Rückführung des Geschlechterunterschiedes ist auch nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung noch gängige Praxis.
Der biologistischen Sichtweise wird in dieser Arbeit eine konstruktivistische Auffassung entgegengehalten, die aufzeigt, dass Geschlecht samt seiner Brisanz im sozialen Miteinander erzeugt wird. Geschlecht als Identitätsmerkmal ist kein gesellschaftliches a priori. Es ist keine gegebene Ausgangsgröße sondern eine Kategorie. Restriktionen und Privilegien erfährt die Geschlechterklassifikation in gesellschaftlicher Produktion, überall dort wo Geschlecht als differenzierendes Merkmal verwandt wird. Diese Konstruktion gilt es in Kapitel eins zu verdeutlichen, in seiner Poltisierung historisch zu begründen. Den theoretischen Erwägungen erfolgt in Kapitel zwei eine kusorische Betrachtung der empirischen Schulforschung. Im Schlusskapitel der Argumentation sind Wege zur geschlechtssensiblen Schule aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Das Geschlecht als soziales Konstrukt
1.1 Das Geschlecht und sein biologischer Körper
1.2 Die gesellschaftliche Produktion des Geschlechterunterschieds
1.2.1 Das Geschlecht als biologisch gestützte Strukturkategorie der Gesellschaft
1.2.2 Die interaktive Produktion des Geschlechts
1.3 Das Geschlecht als sozialisationstheoretisch relevante Klassifikation?
1.4 Schlussbemerkung
2. Das Geschlecht als Zuschreibungskategorie im
Schulsystem
2.1 Die Verteilung der Geschlechter im Schulsystem
2.2 Die Konstruktion des Geschlechts in Schulbüchern
2.3 Die Schulleistungen und Interessen der Geschlechter
2.4 Die Erzeugung geschlechtertypischen Wissens in schulischen Interaktionsprozessen
2.5 Schlussbemerkung
3. Das Programm einer geschlechtersensiblen Schule
3.1 Konzeption geschlechtersensibler Richtlinien
3.2 Konkretisierung pädagogischer Praxis in der geschlechtersenssiblen Schule
3.3 Schlussbemerkung
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
„Jungen wollen mit Sachen spielen, Mädchen zwischenmenschliche Beziehungen pflegen. Jungen wollen andere lenken, dominieren und nach oben kommen, Mädchen beschäftigen sich mehr mit moralischen Fragen, Beziehungen und Menschen. Frauen stellen immer noch eine Minderheit im Geschäftsleben und der Politik dar, jedoch nicht weil sie unterdrückt werden – sie interessieren sich schlicht und ergreifend weniger für diese Gebiete.“1
So befunden im internationalen Bestseller von ALLAN und BARBARA PEASE „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken können“. Differenzen der Geschlechter werden dieser Sichtweise folgend naturalisiert und unter dem Diktum ‚ Unsere Biologie hat sich nicht grundlegend geändert ’2 sozial deterministisch verbucht. Schlagwörter wie ‚ Gleiche Spezies - andere Welten ’3 sind dabei exemplarisch einem medialen Diskurs um die Geschlechterdifferenz zu entnehmen, der hartnäckig auf typische, dem jeweiligen Geschlecht eigene Merkmale verweist. Ob in Buchform oder TV-Showformaten, ‚ doing gender ’ scheint seinen Reiz nicht verloren und damit Konjunktur zu haben. Im Ergebnis stärkt eine solche Auseinandersetzung gängige, stark typisierende Geschlechterrollen und lässt erforderliche Ausgewogenheit vermissen.
Im Lichte der Fernsehkameras und im Schein populärwissenschaftlicher Veröffentlichungen sind Alltagserfahrungen versucht, sich zu objektivieren und als gesichertes Wissen zu gelten. Biologistische Annahmen eines organischen Geschlechterunterschiedes, der auch im Sozialen die Sphären männlich und weiblich realisiert, erfreuen sich dabei immer noch breiter Zustimmung. Die scheinbar natürlichen Antworten auf komplexe, mit dem Geschlecht zusammenhängende Fragen, sind indes unkritisch gegenüber ihrem sozialen Entstehungsprozess. Sie zielen mehr danach bestehende Zustände zu verteidigen, denn mit überkommenen Klischees zu brechen. Von entscheidender Bedeutung ist ihr „richtiger“, sich wohlwollend an gängige Geschlechterpraktiken anschmiegender Klang, nicht der Wahrheitsgehalt.
Trotz der Tradition der Geschlechterforschung, aus dem kritischen Feminismus der 1960er und 1970er Jahre hervorgegangen, ist die Beschäftigung mit Fragen der Entstehung gesellschaftlicher Unterschiede auf Basis des Geschlechts aktuell. Die biologische Rückführung des Geschlechterunterschiedes ist auch nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung noch gängige Praxis. Der Konflikt um patriarchalische Gesellschaftsstrukturen mag an Schärfe eingebüßt haben, gleichwohl ist ein neuer Biologismus auf dem Vormarsch, demgemäß Geschlecht als Strukturkategorie zu problematisieren ist.
Der biologistischen Sichtweise wird in dieser Arbeit eine konstruktivistische Auffassung entgegengehalten, die aufzeigt, dass Geschlecht samt seiner Brisanz im sozialen Miteinander erzeugt wird. Geschlecht als Identitätsmerkmal ist kein gesellschaftliches a priori. Es ist keine gegebene Ausgangsgröße sondern eine Kategorie, deren Inhalt sich in Europa im Verlauf der Moderne entscheidend verändert hat. Restriktionen und Privilegien erfährt die Geschlechterklassifikation in gesellschaftlicher Produktion, überall dort wo Geschlecht als differenzierendes Merkmal verwandt wird.
Diese Konstruktion gilt es in Kapitel eins zu verdeutlichen. Der Körper ist ein geschlechtlicher Körper, dessen organischer Aufbau trotz großer Gemeinsamkeiten in einer zweigeschlechtlichen Matrix grundsätzlich von einander getrennt wird. Die Unausweichlichkeit dieser folgenreichen Unterscheidung in männlich und weiblich ist hinsichtlich ihrer organisch-stofflichen Grundlage zu überprüfen, d.h. zu klären, inwiefern unterschiedlichen Geschlechtscharakteren biologische Tatsachen entsprechen. Den Produktionsprozess des Geschlechts als soziologisches Phänomen zu betrachten, zwingt dazu Gesellschaft und ihre Akteure in den Blick zu nehmen. Dabei verläuft die Argumentation auf zwei Ebenen. Einerseits ist das Geschlecht als gesellschaftliche Makrostruktur in seiner veränderten Bedeutung darzustellen, seine Produktionsressourcen in der sozialen Welt aufzuzeigen. Dieser Prozess vollzieht sich auf der Schwelle von Früher Neuzeit und Moderne, im 18. Jh./ 19. Jh., und transformiert das existente „Ein-Geschlechter-Modell“ zu einem „Zwei-Geschlechter-Modell“, welches von der Biologie als Wissenschaftsdisziplin argumentativ getragen wird.
Andererseits sind diese Veränderungen auf sozialstruktureller Ebene nicht getrennt von interaktiven Prozessen zwischen den einzelnen Subjekten der Gesellschaft zu betrachten. Es wird zu thematisieren sein, in welcher Weise die Mikroebene des sozialen Handelns vom vorherrschenden Geschlechterdiskurs sanktioniert wird, oder aber auch Möglichkeiten bietet diesen zu wandeln. Die Anschlussfähigkeit klarer Aussagen auf Grund des sozialen Phänomens der Vergeschlechtlichung steht dabei generell auf dem Prüfstand. Besondere Aufmerksamkeit wird der Identitätsbildung unter Voraussetzung eines Geschlechts als sozialer Zuschreibung gewidmet, die letztlich in das Selbstbild des Subjekts Eingang findet.
Diesen theoretischen Erwägungen folgt im zweiten Kapitel eine kursorische Betrachtung der empirischen Schulforschung, welche Aufschluss über die Befüllung der sozialen Kategorie Geschlecht im Schulsystem geben soll. Dabei werden verschiedene Dimensionen in den Blick genommen, die für die Identitätsbildung im Zusammenhang mit dem Geschlecht bedeutsam sind. Letztliches Erkenntnisziel ist es, zu ergründen, welcher Art von Lehrplan, teilweise heimlich, teilweise offen, der Umgang mit dem Geschlecht in der Schule folgt.
Im Schlusskapitel der Argumentation ist der Anspruch gegenüber dem zuvor erarbeiteten Zustand einer geschlechtssensiblen Schule auf Basis der theoretischen Erkenntnisse aufzuzeigen. Dabei sind die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen des Schulsystems konstruktiv zu kritisieren, demgemäß Anregungen für die unterrichtliche Praxis zu geben und zu entfalten, was der normierenden Selbstverständlichkeit des Geschlechts entgegenzuhalten ist.
1. Das Geschlecht als soziales Konstrukt
Dem Begriff Geschlecht fehlt es in seinem deutschen Sprachgebrauch an der nötigen Eindeutigkeit, gesellschaftliche und organisch-stoffliche Anteile der Persönlichkeitsentwicklung zu trennen. Auf sprachlicher Ebene verdeutlicht die aus der angloamerikanischen Forschung hervorgegangene Differenzierung in „sex“ und „gender“ das angezeigte Denkschema besser. Der Körper ist dabei als organisches Material – biologische Kategorie das „sex“, während die soziokulturell erschaffene Geschlechteridentität oder -rolle im „gender“ ausgedrückt wird.4 Letztere ist nicht fleischlich fixiert, sondern in ihrer sozialen Befüllung frei. Die anfängliche Eintracht in der Frauenbewegung, mit diesem analytischen Instrument die Geschlechterhierarchie als anerzogen abzulichten, währte jedoch nicht lange. Im Umkehrschluss den Körper auszublenden und bestehende Ungleichheiten im „gender“ einzuebnen, für egalitäre Ausgangsbedingungen im „battle of sexes“ zu sorgen, vermochte dem Anspruch komplexer Unterdrückungsstrukturen und womöglicher Andersartigkeit nicht gerecht zu werden.5 JUDITH BUTLER kommentiert das ideengeschichtliche Dilemma dieses Begriffspaares treffend:
„Wenn wir jedoch den kulturell bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht denken, wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Die Begriffe Mann und männlich (Hervorhebung im Original) können dann ebenso einfach einen männlichen und weiblichen Körper bezeichnen wie umgekehrt die Kategorien Frau und weiblich (H.i.O.).“6
Die Frage nach dem eindeutig bestimmbaren Element der jeweiligen Geschlechtsidentität bleibt in der „sex“ und „gender“ Unterscheidung unbeantwortet. Sie regelt lediglich den Anschluss des Sozialen an den organischen Körper. Eine mögliche Konsequenz, so BUTLER, wäre die Direktive, eine auf sprachlicher Ebene Differenz erzeugenden Begrifflichkeit „Geschlecht“ in seiner Unvermeidbarkeit zu hinterfragen. Vielleicht ist die anatomische Inkonsistenz der geschlechtlichen Unterscheidung in Mann und Frau ebenso kulturelle Konstruktion, die Bestimmung des „sexed body“ immer schon Teil des „doing gender“ gewesen, „[...] so daß die Unterscheidung zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität letztlich gar keine Unterscheidung ist.“7
Die Lesart des allgemeinen Begriffs Geschlecht als Teil des sozialen Konstruktionsprozesses widerspricht der herkömmlichen Auffassung, „gender“ als Zuschreibung über gesellschaftlich erwünschte Rollenerwartungen an das anatomische „sex“ anzudocken. BUTLER plädiert dafür, dass „[...] dieser Begriff auch jenen Produktionsapparat bezeichnen [muss] , durch den die Geschlechter (sexes) selbst gestiftet werden. Demnach gehört die Geschlechtsidentität (gender) nicht zur Kultur wie das Geschlecht (sex) zur Natur.“8 Diesen Widerspruch, in Aktion eines diskursiven, gesellschaftlichen Konstruktionsapparat eine Art vorgesellschaftliche Vorstellung von Geschlecht herzustellen, gilt es zu überwinden. Dazu ist zwingend eine Reformulierung der Geschlechtsidentität vorzunehmen.9 Es genügt nicht, ‚ gender ’ als Geschlechtsidentität eines, wie auch immer ausgeformten Körpers zu betrachten. Die Grenzen zwischen beiden Kategorien müssen flexibel sein – ein offenes vordiskursives Verständnis von geschlechtlicher Neutralität erschlossen werden, dessen Ressourcen es zulassen, die Trennung in a priori männlich und weiblich aufzulösen. Solche Überlegungen haben in den 1990er Jahren zur Formulierung der Queer Theorie geführt, einer Kulturtheorie vom „offenen“ Menschen dessen geschlechtliche Fixierung aus einem sozialen Konglomerat von Zwei-Geschlechterordnung und Heterosexualität bestimmt ist.10 Eine Geschlechtsidentiät gilt demnach nicht als feste Größe, ist vielmehr fluid, in ständiger Veränderung.11 Gleich welche Gender-Theorie man favorisiert, empfiehlt es sich „gender“ im Kontext dieser Arbeit folgendermaßen aufzufassen:
„Gender (H.i.O.) ist eine menschliche Erfindung wie Sprache, Verwandtschaftsbeziehungen, Religion und Technologie; wie diese regelt gender (H.i.O.) das menschliche Sozialleben nach kulturell bedingten Mustern. [...] Die vergeschlechtlichte Mikrostruktur und die vergeschlechtlichte Makrostruktur reproduzieren und verstärken einander wechselseitig.“12
Das Kapitel wird diesen theoretischen Fingerzeig, der in Richtung Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht weist, biologisch zu hinterfragen, soziologisch zu prüfen und sozialisationstheoretisch zu bewerten haben. Es stellt sich zu Beginn die Frage, inwiefern Indizien dafür sprechen, aus somatischen Unterschieden einen spezifischen Geschlechtscharakter ableiten zu können. Ihr folgt der kulturhistorische Werdegang des Geschlechts zur biologischen Ausschlusskategorie und die Einschätzung, welchen Wert es aus heutiger Sicht für das Subjekt spielt oder notgedrungen für seine Sozialisation zu spielen hat.
1.1 Das Geschlecht und sein biologischer Körper
Der Sexus, das körperliche Geschlecht, beruht auf morphologischen und genetischen Unterschieden, die pointiert formuliert in der Gebährfähigkeit der Frau und der Befruchtung durch den Mann liegen. Zieht man lexikalische Hilfe zu Rate, wird Geschlecht konkretisiert in „unterschiedliche Ausprägung der Gameten [...], [wobei] die Mikrogameten oder Spermien als männlich, die Makrogameten oder Eizellen als weiblich bezeichnet [...]“ werden.13 Wendet man sich der biologischen Geschlechtsentwicklung zu, verläuft diese auf verschiedenen Ebenen: genetisch, hormonell und neuronal.14 Der Blick richtet sich dabei unter die Oberfläche der anschaulichen Unterschiede in der Körperform. Diese sind besonders in der Anatomie der Geschlechtsorgane auffällig, die, trotzdem die meiste Zeit im Alltag unsichtbar gemacht, grundsätzlich für die biologische Unterscheidung verantwortlich sind.
Der kleine Unterschied liegt im Chromosomensatz, der bei Frau aus zwei X-Chromosom besteht, während Mann jeweils ein X und Y-Chromosom besitzt.15 Die unterschiedliche Physiognomie des menschlichen Körpers wird vom sogenannten SRY-Gen kodiert, welches auf dem Y-Chromosomen sitzt und sich nach heutigem Forschungsstand alleinig für die Festlegung des genetischen Geschlechts verantwortlich zeigt. Zu Beginn der Genese ist die Gewebestruktur des Embryos geschlechtsneutral und trennt sich erst ab der siebten Schwangerschaftswoche auf.16 Dabei ist die Grundstruktur des Organismus weiblich angelegt, die Ausprägung der Hoden erfolgt in der achten Schwangerschaftswoche durch spezielle hormonelle Prozesse. Sie werden aus indifferenten Keimdrüsen gebildet, welche ohne Eingreifen des Testosterons die weiblichen Eierstöcke realisieren würden. Somit verfügt der Embryo neben dem chromosomatischen Geschlecht auch über ein hormonelles.
Ab der zwölften Schwangerschaftswoche sind die Eierstöcke ebenfalls entwickelt, wodurch ein unterschiedlicher Hormonhaushalt der Geschlechter zu beobachten ist.17 Die Abgabe der Sexualhormone ist jedoch kein qualitatives Merkmal, um einen Geschlechtscharakter anzunehmen, es bedeutet ebenso wenig, dass beim männlichen Fötus ausschließlich Testosteron, beim weiblichen nur Östrogen ausgeschüttet wird, lediglich dass der jeweilige quantitative Anteil im Hormongemisch signifikant ist. Untersuchungen zeigen, dass der Hormonhaushalt Einfluss auf die Gehirnentwicklung besitzt, also unterschiedliche neuronale Strukturen befördert.18
Die dabei abgelichteten Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind geringfügig, weisen beispielsweise für feminine Körper eine stärkere Vernetzung der Gehirnhälften aus als bei maskulinen, was zu Spekulationen über eine neurobiologische Grundlage der psychologischen Geschlechtsidentität zu reizen scheint. Zu konstatieren ist, dass bei Tierversuchen die Umstrukturierung im Gehirn durch externe Zuführung von Hormonen gezeigt werden konnte. Bisherige Beobachtungen am Menschen dahin gehend, in welcher Weise sich der Hormonhaushalt für psychologische Eigenschaften verantwortlich zeigt, sind jedoch uneinheitlich.19 Ergebnissen, die einen starken Zusammenhang aufzeigen, stehen widersprüchliche gegenüber. JENS ASENDORPF schließt deshalb: „Es gibt keine einfachen linearen Zusammenhänge zwischen frühem hormonellen Geschlecht und späterem geschlechtstypischen Verhalten.“20
Bei der Suche nach Differenzierungsmerkmalen scheint die Matrix männlich/weiblich in der Biologie nicht zwangsläufig Ausdruck immanent einmütiger Abläufe und Ausprägungen der einzelnen Geschlechter zu sein. Die anfängliche Eindeutigkeit der Geschlechter in den Chromosomen ist bereits auf hormoneller Ebene verschwommen, indem kein typisch männlicher oder weiblicher Hormonspiegel auszumachen ist.21 Physiologisch setzt sich dies fort, indem statistische Unterschiede wie z.B. in der Körpergröße lediglich Mittelwertunterschiede sind, d.h. die Varianz innerhalb der Gruppe der Männer von der der Frauen differiert ohne dabei eine klare Geschlechtergrenze zu generieren.22 Es besteht eine Tendenz, dass Männer größer als Frauen sind, die dennoch im Einzelfall zu falsifizieren ist und keine generelle Gültigkeit besitzt, weil es sich höchstens um einen Erwartungswert handelt. Die Ursache dieser, im Alltag oftmals als Besonderheit etikettierten, dabei biologisch keinesfalls als unwahrscheinlich geltenden Phänomene, liegt in den Genen.
Die Gene liegen im menschlichen Körper als Genom vor, das die Gesamtheit aller Gene eines einzelnen Individuums umfasst und in jeder Körperzelle vorhanden ist.23 Die genetische Einzigartigkeit des Individuums, abgesehen von eineiigen Zwillingen, deren Genom sich vollständig gleicht, kommt über die unterschiedlichen Realisierungsmöglichkeiten, den Allelen des Gens zustande. Dabei ist die funktionale Struktur des Genoms, sofern keine Gendefekte vorliegen, gleich, d.h. der Grundbauplan unseres Körpers gemeinsame Schnittmenge aller Genome.24 Auf dieser Basis entsteht ein hoher Grad an Übereinstimmung der einzelnen Gene, die jedoch in individuell verschiedenen Variationsmöglichkeiten vorliegen. Im Genpol des Individuums, der paritätisch von Mutter und Vater stammt, befindet sich sozusagen ein Vorrat unterschiedlicher Allele – von Genvarianten, die beispielsweise für eine braune, blaue oder grüne Augenfarbe sorgen. Damit verliert sich die Annahme einer uneingeschränkten Planmäßigkeit der ontogenetischen Entwicklung. Vielmehr handelt es sich um einen Ablaufplan, in dem Zufälligkeiten strukturell verankert sind, dennoch Methode haben und sich semi-systematisiert ereignen. Daneben ist die Wirkungsreichweite der Gene begrenzt.
„Gene wirken dabei nicht direkt (H. i. O.) auf die Persönlichkeit eines Subjekts ein, sondern produzieren ausschließlich in der sie umgebenen Zelle Proteine, die wiederum – z.B. in Form von Hormonen – Einfluss auf den Stoffwechsel benachbarter oder weiter entfernter Zellen bzw. Gewebe ausüben können.“25
Die körperliche Genese ist demnach Ausdruck eines komplexen Stoffwechselprozesses, der in zahllose lokale Einzelschritte zerlegbar ist. Er ist ontogenetisch nicht fixiert, eher gerahmt, indem bestimmte Grundelemente in festen Entwicklungsperioden ausgebildet werden.26 Das Genom ist kein Selbstläufer, es birgt immanent Raum für externe Einflüsse, so dass die organische Zellentwicklung eher von einem komplexen Wechselverhältnis zwischen Umwelt und Anlage bestimmt ist.
„Adäquater ist der Vergleich des Genoms mit einem Text, aus dem im Verlauf des Lebens zunehmend Teile abgelesen werden. Der Text begrenzt das, was abgelesen werden kann, legt aber keineswegs von vornherein vollständig fest, was überhaupt oder gar zu einem bestimmten Zeitpunkt abgelesen wird. Was zu einem bestimmten Zeitpunkt abgelesen wird, hängt davon ab, was vorher (H.i.O.) gelesen wurde und welche Wirkung dies hatte, einschließlich Rückkopplungseffekte auf das Leseverhalten.“27
So gesehen wird der Umwelt ein nicht unbeträchtliches gestalterisches Potenzial zugesprochen, welches die Vorstellung einer ausschließlich genetisch gesteuerten Reifung zur Illusion macht. Gleichwohl ist das vorhandene Genmaterial die Grundgesamtheit des vorhandenen Potenzials, welches nicht von außen künstlich erhöht werden kann. Die Entwicklungsgenetik spricht deshalb von einem dynamisch-interaktionistischen Konzept der Entwicklung, bei der sich die Anteile im Zusammenwirken von Umwelt und Anlage nicht eindeutig abgrenzen lassen.28 Der Ausprägung des Merkmals Geschlecht als Disposition zu sich selbst findet demnach Anreize im Äußeren der sozialen Umgebung.
1.2 Die gesellschaftliche Produktion des Geschlechterunterschieds
1.2.1 Das Geschlecht als biologisch gestützte Strukturkategorie der
Gesellschaft
Historisch gesehen ist der Diskurs um Geschlecht und Geschlechterdifferenz nicht starr, sondern changiert im Verlauf der einzelnen Epochen. Dabei zeigt sich, dass das, was die Geschlechter gemeinhin bedeuten, genauso inkonsistent ist wie die Gültigkeit eines bestimmten Körperverständnisses. Nach BARBARA DUDEN ist der Körper epochenspezifisch und in seiner aktuellen Form ungefähr zweihundert Jahre alt.29 Damit ist keine organische Metamorphose, sondern eine kulturhistorische Verschiebung zum Körper gemeint, die nicht allein dem wissenschaftlichen Fortschritt geschuldet, sondern auch sozial konstruiert ist. In welcher Weise und welche Absicht verfolgend, ist nun zu schildern.
Die gewandelte Wertigkeit des Körpers zeigt sich nach THOMAS LAQUEUR in der Ausdifferenzierung der Körper, die im Verlauf der Moderne von einem Ein-Geschlechter-Modell in ein Zwei-Geschlechter-Modell überführt wurden.30 Die Beweisführung beginnt dabei in der frühneuzeitlichen Anatomie vom 16. bis zum 18. Jh. Die Systematik zur Bezeichnung männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane waren in dieser Zeit noch einheitlich.31 So wurde die Klitoris nach ihrer Entdeckung dem Penis gleichgesetzt, versah analog zur Kernfunktion des männlichen Geschlechts das Urinieren.32 Die Schamlippen wurden der männlichen Vorhaut gleich, als Schutz der innenliegenden Organe interpretiert. Die Vorstellungskraft der Zeitgenossen reichte bisweilen soweit, sich einen erektionsfähigen, weiblichen Penis auszumalen. Die Eierstöcke verstanden sich ebenso wenig als eigenständiges weibliches Körperorgan, sondern lediglich als Gegenstück der Hoden. Begrifflich wurden sie nicht weiter von den Hoden differenziert, man subsumierte unter dem Begriff Testikel die Geschlechtsdrüsen33 beider Geschlechter, dabei steuerten die weiblichen äquivalent zu den männlichen den Ausstoß des Ejakulats.
Aussagekräftig ist in diesem Kontext weniger die Fehlerhaftigkeit der geschilderten Annahmen bezüglich des weiblichen Körpers, vielmehr deren Einschätzung als funktionale Entsprechungen männlicher Organe. Zeitgenossen der Frühen Neuzeit machten sich nach einem anderen theoretischen Verständnis ein Bild vom Körper. Sie benutzten keine sprachlich anatomische Trennung der Geschlechter, sondern ordneten die Phänomene nach der vorherrschenden sozialen Wertigkeit der Körper. Die Denkstruktur, die das Geschlechterverhältnis zu Gunsten des Mannes hierarchisiert, wird in der Anatomie adaptiert.
In der Analyse der frühneuzeitlichen Literatur findet LAQUEUR weitere Hinweise zur Repräsentation des einen Geschlechts in der Welt zweier. Frappierend ist, dass es in der zeitgenössischen „[...] Vorstellungswelt kein ‚reales’ (H.i.O.) biologisches Geschlecht gibt, das grundsätzlich auf reduktionistische Weise zwei soziale Geschlechter begründet und unterscheidet.“34 So war die Gefahr bzw. Chance des Übertritts der Geschlechtergrenzen zu beobachten. In Form des Abstiegs drohte dabei dem Mann durch zu starken Frauenbezug die biologische Degeneration. Die Frau stieg auf, indem sich ihr biologisches Geschlecht spontan, durch einen ausgetriebenen Penis, veränderte.35
Natürlich handelte es sich dabei nicht um real zu beobachtende Begebenheiten, sondern um ein sprachliches Spiel mit der Geschlechtlichkeit, das die Durchlässigkeit zum Körper versinnbildlichte. Leser wie auch die Verfasser solcher Texte verstanden es, derartige Ereignisse praktisch gesehen als Mythos zu entlarven, seine soziale Funktion jedoch anzuerkennen. Der zeitgenössische Anspielungsapparat erkannte die Fixierung des sozialen Arrangements in einer ständischen, eher statischen Welt, in der soziale Mobilität nur begrenzt möglich war. Wurde der sozialen Ordnung widersprochen, glätteten körperliche Anpassungsprozesse gesellschaftliche Irritationen. Zur Beurteilung wann welches Handeln als geschlechtsadäquat oder eben nicht zu gelten hatte, waren jedoch andere soziale Normen gültig als heute.
Soziale Rechtmäßigkeit vollzog sich im Feudalsystem auf grundlegender Ungleichbehandlung der Gesellschaftsmitglieder.36 Dieses Ordnungsprinzip prägte auch das Verhältnis der Geschlechter. Frauen waren im modernen Sinne nicht politisch gleichberechtigt, wenn auch nicht gänzlich benachteiligt. Autonomie und Eigenständigkeit der Frauen bemaß sich grundsätzlich an der Standeszugehörigkeit und dem personalen Stand.37 Standübergreifend galt Weiblichkeit als Herrschaft in der Haushaltung, d.h. umfasste die umfangreichen reproduktiven Tätigkeiten, die in einer Zeit des Mangels und vieler prekärer Lebensverhältnisse ein bedeutsames Aktionsfeld darstellte. Das „Weiberregiment“ im Haus „herrschte“ über Mägde, Knechte und die eigenen Kinder. Die Sphäre des Mannes war dagegen außerhäuslich, im öffentlichen, beruflichen Handeln, das als moderne Lohnarbeit mehr und mehr zur Haupteinkommensquelle der Familie wurde.38 Die Herrschaft des Mannes über die Frau leitete sich grundsätzlich aus der christlichen Anthropologie39 ab. Im Schöpfungswerk ist Eva zweitrangig und Versucherin beim Sündenfall. Die Frau wird dem Mann zur Gefährtin gegeben, zusätzlich mit dem Stigma geringere Verstandeskraft und tückischer Listigkeit belegt, was den Strang männlicher Herrschaft begründete und als die rechte Ordnung implementierte.40
Eine derartig fixierte gesellschaftliche Sozialstruktur, die soziale Ehre als geschlechts- und vor allem standesgemäßes Handeln interpretierte, sanktionierte Unregelmäßigkeiten hart und normierte den Umgang mit dem Körper. Das soziale Geschlecht war dabei so unveränderlich, dass Männer und Frauen bei „Zuwiderhandlung“ gegenüber ihrem sozialen Wesen eine neue Natur bekamen – in einen ihren Eigenschaften nahe stehenden Körper gesteckt wurden oder „freiwillig“ schlüpften. Der Körper diente somit als Projektionsfläche, welche das soziale Erscheinungsbild widerspiegelte; den Mann in einer zweigeschlechtlichen Matrix zum Maß einer Frau macht, die sich in ihrer Unvollkommenheit ihm anzunähern versucht.41 Als Kategorie ist der anatomische Körper entgegen der Geschlechtsidentität offen.
Die Verkehrung dieser Praxis, die den Körper zum Tatbestand werden lässt, der das Soziale prognostizierbar macht, vollzog sich im Strudel der gesellschaftspolitischen Wandlungsprozesse nach der französischen Revolution. UTE FREVERT zeigt anhand der Begriffe Geschlecht, Weib/Frau und Mann, die semantische Verschiebung in der sogenannten Sattelzeit42 zwischen 1750 und 1850.43 Das Muster, unter den Geschlechtern mehr oder weniger die Ansammlung verschiedenster sozialer Rollen, beispielsweise als Lehens mann oder Hauß mann zu verstehen, veränderte sich im 19. Jh. nachhaltig. Die Begrifflichkeiten wurden naturalisiert, besonders die Frau zum fragwürdigeren Geschlecht.
Das gemeinschaftliche Votum der untersuchten Lexikonartikel aus dem 19. Jh. zeigte, dass besonders Frauen „[...] Geschlechtseigenthümlichkeiten [...]“ unterstellt wurden, die bis dato ungekannte psychologische und physiologische Unterschiede offenbarten.44 Damit ging die Schere auf und schied Frau und Mann biologisch voneinander, spendete auf einer neuen normativen Grundlage Stabilität für die Geschlechterhierarchisierung. Es kommt zu einer paradigmatischen Wende, die in der anatomischen Konstruktion der Frau Ursachen einer politischen Ungleichbehandlung sieht. Mit anderen Worten: „Die Physiologie ihrer Körper [der Frauen, Anm. d. Autors] paßt sich [...] den Erfordernissen der Kultur an“; das Gewicht der universalistischen Forderungen nach Freiheit und Gleichheit, in der Französischen Revolution formuliert, stürzte das Patriarchat nicht.45 Den zuvor synchron gedachten Körpern von Mann und Frau erwächst nun die Legitimation, anstelle der brüchig gewordenen sozialen und politischen Ordnungen, alte Machtverhältnisse in die neue Zeit hinüber zu retten. In der Bemühung, die sichtbaren Risse im Konstrukt männlicher Dominanz zu kitten, fungierte die Biologie als Steigbügelhalter einer patriarchalischen Sozialstruktur.
„Weil die Autorität des sozialen Geschlechts in sich zusammengefallen ist, ist das biologische in der Tat ubiquitär.“46 Das in jener Zeit erworbene biologische Wissen kann nicht isoliert von seiner ideologischen Verwendung betrachtet werden. Schon in früheren Epochen war Frau sozial geächtet, in der Moderne dann qua Natur, wogegen jede Opposition zwecklos war. Dem eigenen Körper ist kein Entkommen mehr möglich. Das Wissen vom Unterschied wird in der Biologie wissenschaftlich objektiviert. Die gewichtigere Erkenntnis ist dabei nicht, zu ergründen, wo der Unterschied der Geschlechter anatomisch liegt, sondern die, dass überhaupt organisch nach ihm gesucht wurde und wird.
1.2.2 Die interaktive Produktion des Geschlechts
In der Interaktion bringt sich jeder Akteur als Körper ein, erkennt, interpretiert andere über deren Körperlichkeit, was einen körperlosen Zustand des Subjekts soziologisch unhaltbar macht.47 In seiner Körperlichkeit ist es nicht nur Rezipient äußerer Einflüsse, sondern besitzt eigene Ressourcen zur Gestaltung der sozialen Wirklichkeit. Es ist nicht nur Kopf, Sitz der Vernunft, ebenso auch agierender Leib. Dabei ist die klassische Trennung in Körper und Geist, der sogenannte cartesianische Dualismus zugunsten eines integrativen, ganzheitlichen Modells aufzulösen.48
„Produzent von Gesellschaft (H.i.O.) ist der menschliche Körper dergestalt, dass soziales Zusammenleben und soziale Ordnung entscheidend von der Körperlichkeit sozial handelnder Individuen beeinflusst sind: Insofern soziale Wirklichkeit aus sozialem Handeln resultiert und soziales Handeln immer körperliches Handeln ist, tragen körperliche Handlungen zur Konstruktion sozialer Wirklichkeit bei.“49
Der Körper ist ein Objekt – ein Material, das für jedermann sichtbar ist. Da Körper und Geschlecht in der zeitlich-räumlichen Kontinuität ihrer Darstellung zusammenfallen, wird er schließlich als Geschlechtskörper, d.h. entweder männlich oder weiblich aktiv wahrgenommen.50 Es verbinden sich objektive Bedeutung als materieller Körper und Zeichenhaftigkeit. Einerseits drückt der Körper die plastische Präsenz des Subjekts im Raum aus, zeigt andererseits aber auch bestimmte und damit individuell konstitutive Merkmale einer Person an.
„Der Körper ist ein Ding und zugleich ein Zeichen; da die Zeichenhaftigkeit unmittelbar mit seiner Konstitution als Ding zusammenfällt, erhält die Zeichenhaftigkeit die gleiche Objektivität, die dem Körper als Ding zukommt.“51
Zwei unterschiedliche diskursive Ebenen, Körper und Geschlecht, schieben sich in der Wahrnehmung des Körpers übereinander und bewirken die Objektivierung des körperlichen, anhand der Zeichenhaftigkeit ablesbaren Geschlechts in der Interaktion. Für STEFAN HIRSCHAUER läuft diese Bildförmigkeit des objektivierten Geschlechtskörpers als „[...] nicht-hinterfragter Hintergrund von Wahrnehmungsprozessen und Begründungsfiguren [...]“ in allen Interaktionen mit und produziert die Faktizität der Geschlechterdifferenz.52
Schlüsselmoment der Interaktion ist in Anlehnung an GOFFMAN die körperliche Darstellung, die weit stärker als sprachliche Symbolisierungen die Normativität der Geschlechterordnung ausdrückt. In seiner wissenssoziologischen Analyse beschreibt HIRSCHAUER den Akteur als „Geschlechtsdarsteller“, der in seinen Inszenierungspraktiken perfektioniert, zielsicher geschlechtsadäquate Darstellungsmodi wählt, kurz gesagt körperlich routiniert ist. Diese Routine verlangt dem Akteur keine mentale Aufmerksamkeit ab, sondern ermöglicht ihm eine geradezu „natürliche“ unbewusste Inszenierung. Der Körper ist dabei ein praktischer Wissensbestand. Seine Nutzung ist subtil, dennoch lässt sie die Darstellung des Handelnden als Geschlechtskörper in aller Selbstverständlichkeit gelingen.
[...]
1Allan u. Barbara Pease, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken – Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen, München 2000, S.383.
2 Vgl. ebd., S. 383.
3 Vgl. ebd., S. 14.
4Vgl. Kay Deaux, Sex and gender, in: Annual Review of Psychology, Jg. 36, Heft 1 1985, S. 51f.
5Vgl. Carol Hagemann-White, Wir werden nicht zweigeschlechtlich geboren..., in: Hagemann-White, Carol/ Rerrich, Maria S. (Hrsg.), FrauenMännerBilder – Männer und Männlichkeit in der feministischen Diskussion, Bielefeld 1988, S. 225f.
6 Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a.M. 1991, S. 23.
7 Butler 1991, S. 24.
8 Ebd., S. 24.
9 Ebd., S. 24.
10 Vgl. Sabine Hark, Lebensforschung und Queer Theorie: Theoretische Konzepte, Entwicklungen, Entwicklungen und Korrespondenzen, in: Becker, Ruth/ Kortendiek, Beate (Hrsg.), Handbuch der Frauen- und Geschlechterforschung – Theorie, Methode, Empirie, Wiesbaden 2004, S. 106f.
11 Vgl. Anita P. Mörth, Handlungsvorschläge für einen nicht-binären Umgang mit Geschlecht,Vortrag im Workshop der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien, Frauenforschung und Frauenförderung der Karl-Franzens-Universität Graz 2006, zit. nach: http://www.uni-graz.at/kffwww/geschlecht_didaktik/moerth.pdf, Stand: 17.04.2008, S. 3.
12 Judith Lorber, Gender-Paradoxien, Opladen 1999, S. 47.
13 Brockhaus Enzyklopädie, Leipzig; Mannheim 2006, Band 10, Eintrag Geschlecht
14 Vgl. Jens B. Asendorpf, Psychologie der Persönlichkeit, Heidelberg 2007, S. 387.
15 Vgl. Asendorpf 2007, S. 386f.
16 Vgl. Klaus-Jürgen Tillmann, Sozialisationstheorie – Eine Einführung in den Zusammenhang von Gesellschaft, Institution und Subjektwerdung, Hamburg 2006, S. 47f.
17 Vgl. Asendorpf 2007, S. 387f.
18 Vgl. z.B. Doreen Kimura, Weibliches und männliches Gehirn, in: Sommer, Volker (Hrsg.), Biologie des Menschen, Berlin 1996, S.104 – 113
19 Vgl. Asendorpf 2007, S. 388f.
20 Ebd., S. 388.
21 Tillmann 2006, S. 49.
22 Ebd., S. 44.
23 Vgl. Jens B. Asendorpf, Entwicklungsgenetik, in: Keller, Heidi (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, Bern; Göttingen; Toronto; Seattle 1998, S. 98f.
24 Asendorpf 1998, S. 98f.
25 Tillmann 2006, S. 45.
26 Im Verlauf des Lebens treten immer wieder Phasen ein, in welchen eine stärkere Intensität der hormonellen Veränderung spürbar ist. Hervorstechend sind dabei Pubertät und die Wechseljahre der Frau.
27 Asendorpf 1998, S. 100.
28 Vgl. Asendorpf 1998, S. 100. Im weiteren Verlauf des Aufsatzes wird versucht die Anteile näher zu quantifizieren, siehe Kapitel 2.1 und 2.2.
29 Vgl. Barbara Duden, Geschichte unter der Haut – Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1987, S. 14f.
30 Vgl. Thomas Laqueur, Auf den Leib geschrieben – Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, Frankfurt; New York 1992, S. 35.
31 Vgl. Laqueur 1992, S. 35.
32 Vgl. ebd., S.116f.
33 Dem begrifflichen System der modernen Medizin entsprechend, sind unter Testikel ausschließlich die männlichen Hoden zu verstehen, die jedoch gemeinsam mit den Eierstöcken als geschlechtliche Keimdrüsen, den Gonaden geführt werden.
34 Laquleur 1992, S.150.
35 Vgl. ebd., S. 147f.
36 Vgl. Heide Wunder, Herrschaft und öffentliches Handeln von Frauen in der Gesellschaft der Frühen Neuzeit, in: Ute Frevert (Hrsg.), Frauen in der Geschichte des Rechts, München 1997, S. 31.
37 Frau war zunächst der väterlichen, dann der ehelichen Gewalt unterstellt, die all ihre Besitz-und Anspruchsrechte vertrat. Neben dieser horizontalen Vermachtung des Geschlechterverhältnisses, galt in der Frühen Neuzeit auch die vertikale der unterschiedlichen Lebensalter. Eine jungfräuliche Magd beispielsweise unterstand der verheirateten Hausmutter, ebenso wie der männliche Knecht. Die Heirat bedeutet für beide Geschlechter die maximale Entfaltung sozialen Einflusses, der nur durch die gemeinsame Paarbeziehung erhalten werden konnte. Ausnahmen auf weiblicher Seite sind Kaufmannswitwen oder Regentinnen, denen ein durchaus autonomes, eigenständiges öffentliches Handeln und Regieren nachzuweisen ist. Vgl. Heide Wunder, Er ist die Sonn', sie ist der Mond – Frauen in der Frühen Neuzeit, München 1992
38 Vgl. Ute Frevert, Mann und Weib, und Weib und Mann – Geschlechter-Differenzen in der Moderne, München 1995, S. 144ff. In Rechnung zu stellen ist, das diese Einschätzung dem hegemonialen bürgerlichen Bild des Geschlechterarrangements folgt, das sozial absteigend in unteren Gesellschaftschichten abzuwandeln ist. In einkommensschwachen wurde vermehrt auch auf unqualifizierte weibliche Lohnarbeit zur Existenzsicherung gesetzt.
39 Die Vorstellung von einem christlichen Menschen speist sich zunächst aus den biblischen Quellen des Alten und Neuen Testaments, wurden aber auch durch die Rezeption der großen Kirchenväter seit der Antike stark geprägt. Durch die Reformation am Beginn des 16. Jh., besonders Luthers Ehelehre, wurde trotz männlicher Herrschaft, das Gleichheitstopos gestärkt. Vgl. Heide Wunder, 1992, S. 71ff
40 Vgl. ebd., S. 32f. Eine Ordnung, die immer wieder umkämpft war. Frauen konnten im so genannten „Kampf um die Hosen“ ihre informelle Macht immer wieder beweisen und erfolgreich, d.h. zur Überdehnung ihrer angestammten Handlungsfeldes nutzten.
41 Vgl. Laqueur 1992, S. 222.
42 Zur Systematik der begrifflichen Bedeutungsverschiebung und dem Phänomen der Sattelzeit vgl. Reinhart Kosellecks Einleitung zu den geschichtlichen Grundbegriffen in: Brunner, Otto/ Conze, Werner/ ders., Geschichtliche Grundbegriffe, Bd.1, Stuttgart 1972
43 Vgl. Frevert 1995, S. 13ff
44 Ebd., S. 43.
45 Laqueur 1992, S. 215.
46 Laqueur 1992, S. 179.
47Vgl. Robert Gugutzer, Soziologie des Körpers, Bielefeld 2004. Gemäß ihrer wissenschaftlichen Logik bemühte sich die traditionelle Soziologie, das Subjekt als vergesellschaftetet, d.h. ausschließlich in seiner sozialen Ausrichtung auf Welt und nicht in seiner eigenen leiblichen Erfahrung abzubilden. Die klassischen Theorien thematisieren den Körper lediglich verdeckt, ein Nachholbedarf, den neue Ansätze zu einer Körpersoziologie aufarbeiten.
48 Vgl. Helmut Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, 3. unv. Aufl, Berlin; New York 1975. Plessner macht auf den Doppelaspekt des Menschen aufmerksam. Dieser drückt sich in einem zentrischen und extzentrischen Umweltbezug aus, ist reduktionisitisch in die Dispositionen Körper-Haben und Leib-Sein aufzulösen, welche das Subjekt synchron in seiner Körperlichkeit und Vernunftbegabtheit erfasst. In ihm ist Körper und Geist miteinander verbunden.
49 Gugutzer 2004, S. 6f.
50 Gesa Lindemann, Die leiblich-affektive Konstruktion des Geschlechts – Für eine Mikrosoziologie des Geschlechts unter der Haut, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 21, Heft 5 1992, S. 337.
51 Ebd., S. 338.
52 Stefan Hierschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 46, Heft 4 1994, S. 672.
Häufig gestellte Fragen zur sozialen Konstruktion des Geschlechts
Was bedeutet „Doing Gender“?
„Doing Gender“ beschreibt die interaktive Produktion von Geschlecht im Alltag, bei der Geschlecht nicht als feststehende Eigenschaft, sondern als Ergebnis sozialen Handelns verstanden wird.
Was ist der Unterschied zwischen „Sex“ und „Gender“?
„Sex“ bezieht sich auf den biologischen Körper, während „Gender“ die soziokulturell erschaffene Geschlechtsidentität oder -rolle bezeichnet.
Wie wird Geschlecht im Schulsystem konstruiert?
Durch Zuschreibungen in Schulbüchern, unterschiedliche Erwartungen an Leistungen und Interessen sowie durch geschlechtertypische Interaktionsprozesse zwischen Lehrkräften und Schülern.
Was ist das Ziel einer „geschlechtersensiblen Schule“?
Ziel ist es, starre Rollenklischees aufzubrechen und eine pädagogische Praxis zu etablieren, die individuelle Potenziale unabhängig vom Geschlecht fördert.
Wie hat sich das Geschlechtermodell historisch gewandelt?
Die Arbeit beschreibt den Übergang von einem „Ein-Geschlechter-Modell“ zu einem binären „Zwei-Geschlechter-Modell“ im 18. und 19. Jahrhundert.
- Citation du texte
- Hendrik Düring (Auteur), 2008, Die soziale Konstruktion des Geschlechts: Zustand und Anspruch einer geschlechtersensiblen Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136644