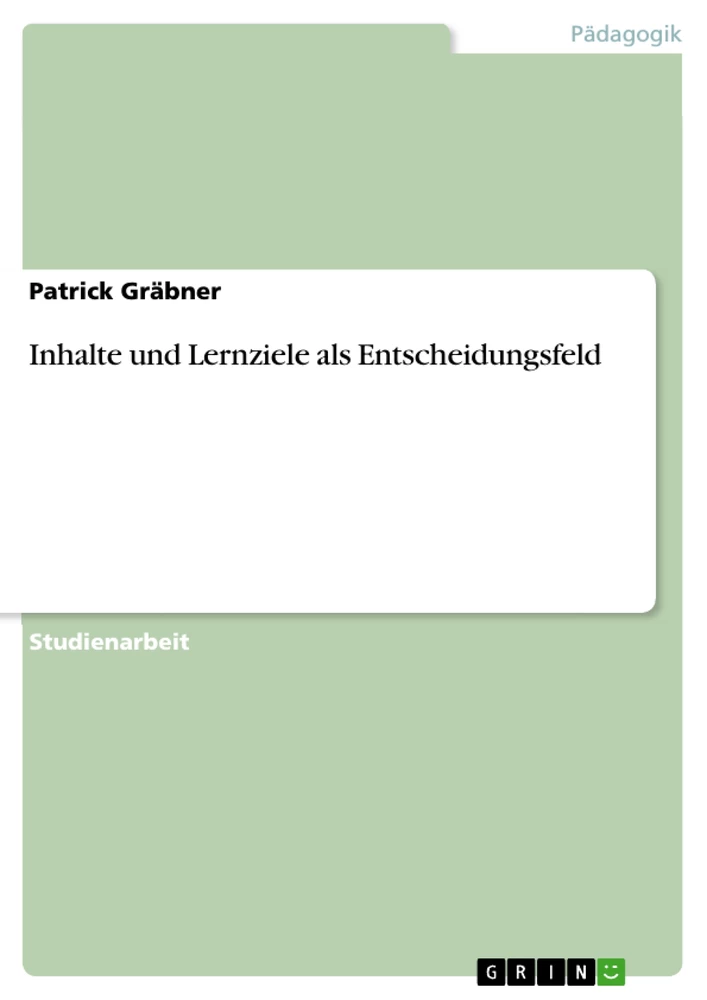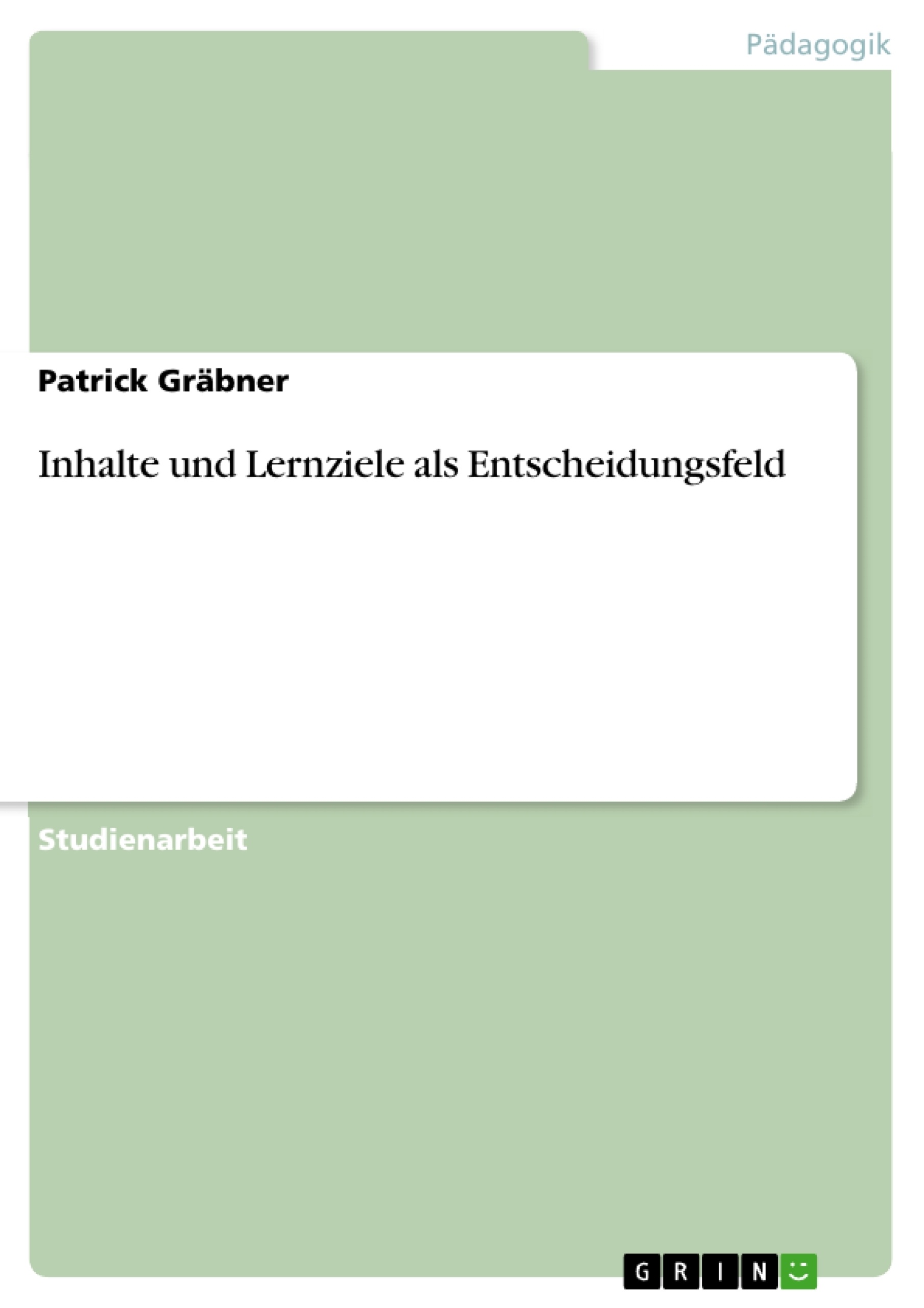Inhalte und Lernziele als Entscheidungsfeld
Die Inhalte und die Lernziele des Unterrichts gehören nach der Lehr-Lerntheoretischen Di-daktik, geprägt von Paul Heimann, Gunter Otto und Wolfgang Schulz, zu zwei der vier wich-tigen Entscheidungsfeldern neben den Medien und den Methoden. Auf diese Entscheidungs-felder und somit auf den Unterrichtsprozess kann der Lehrer Einfluss nehmen und somit den Lernprozess der Schüler und Schülerinnen (SuS) beeinflussen. Das nun folgende Essay be-fasst sich näher mit den Inhalten und Lernzielen und versucht ihre Bedeutung für die unterrichtliche Praxis herauszustellen
Inhalte und Lernziele als Entscheidungsfeld
Die Inhalte und die Lernziele des Unterrichts gehören nach der Lehr-Lerntheoretischen Didaktik, geprägt von Paul Heimann, Gunter Otto und Wolfgang Schulz, zu zwei der vier wichtigen Entscheidungsfeldern neben den Medien und den Methoden. Auf diese Entscheidungsfelder und somit auf den Unterrichtsprozess kann der Lehrer Einfluss nehmen und somit den Lernprozess der Schüler und Schülerinnen (SuS) beeinflussen. Das nun folgende Essay befasst sich näher mit den Inhalten und Lernzielen und versucht ihre Bedeutung für die unterrichtliche Praxis herauszustellen.
Unterrichtsinhalte als Entscheidungsfeld
Die Unterrichtsinhalte wurden im deutschen Bildungssystem bis 2003 primär von den Richtlinien und Lehrplänen vorgegeben, beziehungsweise eingegrenzt, so dass diese als zentrales Element der staatlichen Einflussnahme auf den Unterricht angesehen werden konnte (Input-Steuerung) und einer willkürlichen Themenauswahl entgegen wirkt. Jedoch muss zunächst angemerkt werden, dass eigentlich nicht von den Lehrplänen gesprochen werden kann, da auf Grund der föderalistischen Struktur des deutschen Bildungswesens jedes Bundesland seine eigenen Lehrpläne auf Grundlage der staatlichen Rahmenvorgaben formuliert hat. So bestehen vielfältige Bezeichnungen für die Lehrpläne, wie etwa Bildungspläne, Kurslisten, Rahmenrichtlinien oder auch Stoffpläne (vgl. Müller, Walter 2007: 72).
Neben der eben schon erwähnten Steuerungsfunktion durch den Staat weisen Lehrpläne auch noch weitere Funktionen auf. Sigrid Blömeke u.a. formulierten in ihrer Publikation zehn Funktionen von Lehrplänen, die in der folgenden Aufzählung kurz umrissen werden sollen (vgl. Blömeke, Sigrid u.a. (Hrsg.) 2007: 120 ff.):
1. Legitimationsfunktion: Die unterrichtlichen Inhalte und Vorgehensweisen erhalten durch die Lehrpläne eine rechtliche Basis und dienen der Argumentation, warum bestimmte Inhalte oder warum bestimmte Fächer unterrichtet werden müssen, beziehungsweise sollen.
2. Orientierungsfunktion: Die Lehrperson kann sich mit Hilfe der Lehrpläne orientieren, welche Inhalte gelehrt, beziehungsweise welche Kompetenzen die SuS in der jeweiligen Jahrgangsstufe aufweisen sollen.
3. Innovationsfunktion: Vor allem bei neu erstellten Lehrplänen sollen „schul- und unterrichtsreformerische Prozesse angestrebt werden (ebd.: 121). So orientieren sich die Lehrpläne an den gesellschaftlichen Kontext und die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, wie beispielsweise auch bei der Kompetenzorientierung der neuen Kernlehrpläne zu betrachten ist, was aber im Anschluss noch genauer zu thematisieren ist.
4. Anregungsfunktion: Die Lehrpläne sollen den Lehrer anregen neue Methoden oder Medien einzusetzen. Zudem werden Beispiele für Unterrichtseinheiten gegeben, was ebenfalls als Angebot für die Lehrpersonen zu sehen ist.
5. Entlastungsfunktion: Der Aufwand der Lehrer bei der Unterrichtsvorbereitung wird verringert, da sie sich an den Lehrplänen orientieren können und somit bei der Planung unterstützt werden.
6. Transparenz: Sowohl Lehrer, Eltern als auch Schüler können sich mit Hilfe der Lehrpläne informieren, welche Inhalte in der jeweiligen Jahrgangsstufe unterrichtet und welche Ziele damit erreicht werden sollen.
7. Kontrolle: Die unterrichtliche Praxis wird aber auch für die staatliche Aufsicht durch die Lehrpläne transparenter, so dass sie ihrer Kontrollaufgabe nachkommen können. In den neuen Lehrplänen NRWs wird dies beispielsweise durch die zentralen Abschlussprüfungen erreicht, deren Inhalte durch die Lehrpläne festgelegt sind.
8. Qualitätssicherung: Ziel der Kontrolle des Staates ist folglich eine Qualitätssicherung, das heißt, dass überprüft werden kann, ob in der jeweiligen Klassenstufe die entsprechenden Kompetenzen ausgebildet worden sind.
9. Kontinuität: Die Lehrpläne der einzelnen Jahrgangsstufen bauen aufeinander auf, so dass eine zunehmende Komplexität erreicht wird und der Lernzuwachs bestmöglich gefördert werden kann. Zudem besteht so eine Sicherheit, dass sich bei einem Schulwechsel die neue Klasse auf einem ähnlichen Niveau befindet, wie die alte Klasse.
10. Vergleichbarkeit: Da alle Schulen die gleichen, durch die Lehrpläne festgelegten, Inhalte behandeln, beziehungsweise Kompetenzen ausbilden müssen, können sich beispielsweise durch die zentralen Abschlussprüfungen Aussagen darüber treffen lassen, inwieweit formulierte Ziele erreicht wurden (vgl. hierzu auch Müller, Walter 2007: 92 f.).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind die vier Entscheidungsfelder der Didaktik nach Heimann?
Nach der lehr-lerntheoretischen Didaktik sind die vier Felder: Inhalte, Lernziele, Medien und Methoden.
Welche Funktionen haben Lehrpläne?
Lehrpläne dienen unter anderem der Legitimation, Orientierung, Qualitätssicherung, Vergleichbarkeit und Entlastung der Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung.
Was bedeutet "Input-Steuerung" im Bildungssystem?
Input-Steuerung bedeutet, dass der Staat den Unterricht primär über die Vorgabe von Inhalten und Richtlinien in Lehrplänen kontrolliert.
Warum gibt es in Deutschland unterschiedliche Lehrpläne?
Aufgrund der föderalistischen Struktur ist Bildung Ländersache, weshalb jedes Bundesland eigene Bildungs- oder Rahmenlehrpläne formuliert.
Wie fördern Lehrpläne die Kontinuität des Lernens?
Sie stellen sicher, dass die Inhalte der Jahrgangsstufen aufeinander aufbauen und bei einem Schulwechsel ein vergleichbares Wissensniveau besteht.
- Citation du texte
- Patrick Gräbner (Auteur), 2009, Inhalte und Lernziele als Entscheidungsfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136751