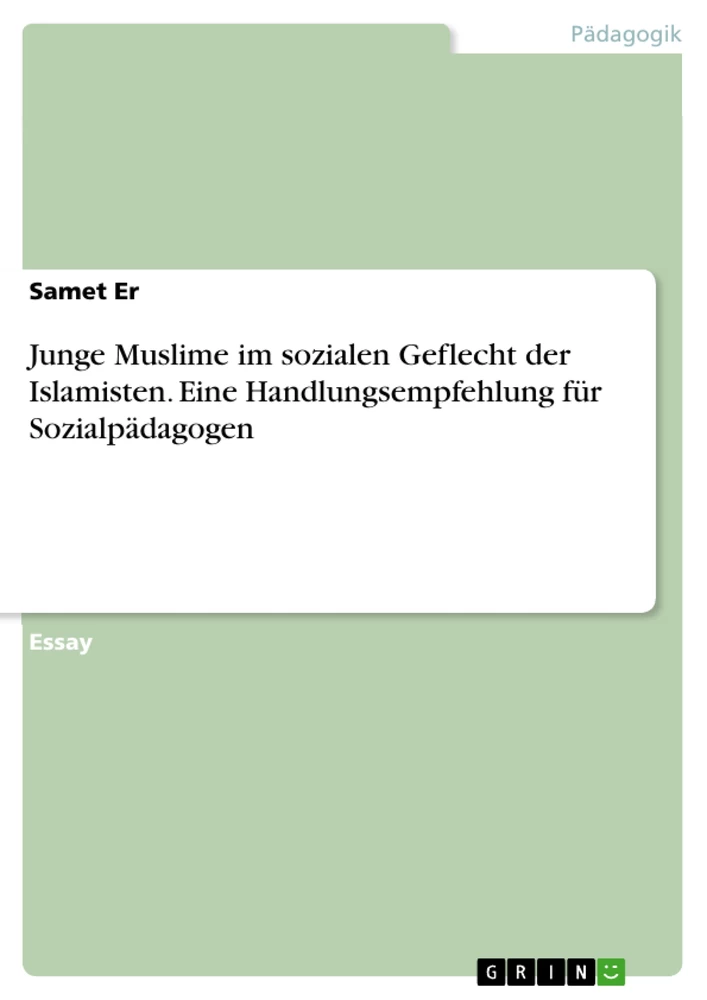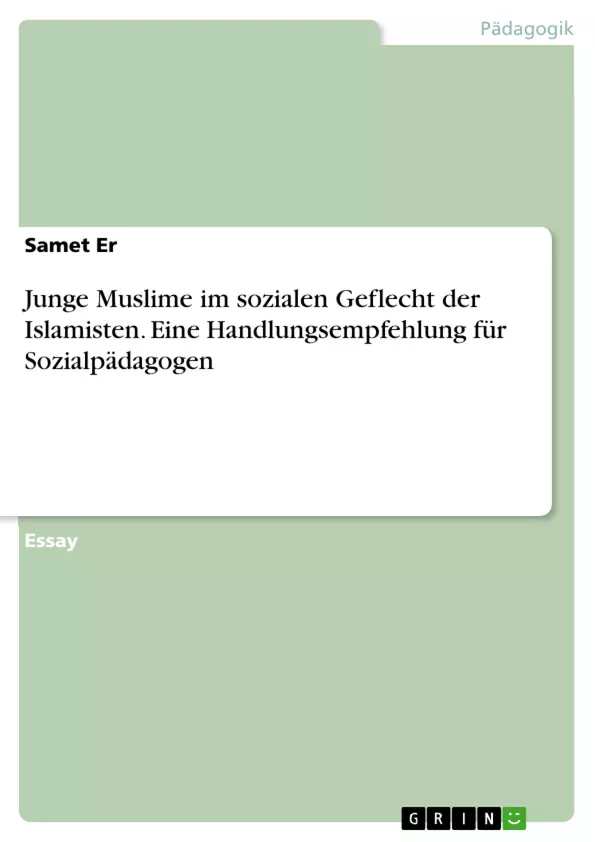Die Feldforschungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zeigen übereinstimmend, dass es sich bei den meisten Anhängern der islamistischen Gruppen (Salafismus, Hizbut Tahrir, Hizbullah) um Jugendliche handelt, die entweder gewalttätig, vertrieben oder ausgeschlossen waren. Sie schließen sich diesen Szenen nicht an, weil sie religiös-attraktiv sind, sondern vielmehr, weil sie eine bessere alternative Lebensform anbieten und hierbei gute soziale Arbeit leisten. Islamistische Szenen nutzen die Schwächen der Jugendlichen und die Lücken der Gesellschaft aus und geben den Jugendlichen das, was ihnen in ihrem üblichen Alltag fehlte – von einer einfachen Wertschätzung bis hin zu einem „Bei uns bist du willkommen“-Gefühl.
Die gesuchte Identität wird in dieser Szene gefunden, in dem die jungen Menschen allen voran wertgeschätzt und zur Selbstwirksamkeit motiviert werden, ihnen Respekt erwiesen wird und große Aufgaben zugewiesen werden. Diese Identität bietet vielen jugendlichen Muslimen somit Zuflucht vor Diskriminierungen und Ausgrenzungen, die sie tagtäglich in den Medien, auf der Arbeit und in der Schule erleben. Je öfter die (gefühlte) Diskriminierung und Ausgrenzung erlebt wird, desto stärker fallen die Sakralisierung der eigenen Ideologie und der Aufbau einer Filterblase aus.
Inhaltsverzeichnis
- Junge Muslime im sozialen Geflecht der Islamisten - eine Handlungsempfehlung für Sozialpädagog(inn)en
- Die Verengung des Blickes und Radikalisierung als Kompensation und Inszenierung
- Der Lebenskoffer
- Was ist dem entgegenzusetzen und vor allem wie?
- Die Lebenssituation der muslimischen Jugendlichen
- Einzelcoaching
- Gruppencoaching
- Netzwerkarbeit
- Fortbildung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Radikalisierung junger Muslime im Kontext islamistischer Gruppen und bietet Handlungsempfehlungen für Sozialpädagog(inn)en, um diesem Phänomen entgegenzuwirken. Ziel ist es, die zugrundeliegenden Mechanismen und Motivationsfaktoren zu verstehen und effektive Interventionen zu entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Jugendlichen eingehen.
- Die Bedeutung von Identität und Zugehörigkeit für junge Muslime
- Diskriminierung und Ausgrenzung als Katalysatoren für Radikalisierung
- Die Rolle der Sozialarbeit in der Prävention und Intervention
- Effektive Methoden der Kommunikation und Beziehungsgestaltung
- Die Bedeutung von Netzwerkarbeit und interdisziplinärer Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Junge Muslime im sozialen Geflecht der Islamisten - eine Handlungsempfehlung für Sozialpädagog(inn)en: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Radikalisierung junger Muslime ein und stellt die Problematik im Kontext islamistischer Gruppen vor. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse aus Feldforschungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zusammengefasst und die Relevanz der Sozialpädagogik für die Intervention und Prävention aufgezeigt.
- Die Verengung des Blickes und Radikalisierung als Kompensation und Inszenierung: Dieser Abschnitt untersucht die psychologischen und sozialen Faktoren, die zur Radikalisierung beitragen. Es wird erläutert, wie Diskriminierungserfahrungen und das Gefühl der Ausgrenzung die Identitätsfindung junger Muslime beeinflussen und sie anfällig für die Ideologie islamistischer Gruppen machen.
- Der Lebenskoffer: Mithilfe eines anschaulichen Metapherns wird der Prozess der Radikalisierung veranschaulicht. Der Lebenskoffer symbolisiert die individuelle Lebensgeschichte und Erfahrungen eines Menschen. Der Umgang mit dem Koffer im Kontext von Diskriminierung und Ausgrenzung steht metaphorisch für die Verengung des Blickes und die Fixierung auf die eigene Gruppe.
- Was ist dem entgegenzusetzen und vor allem wie?: Dieses Kapitel analysiert die Strategien islamistischer Gruppen und erklärt, wie sie junge Menschen für ihre Ideologie gewinnen. Die Rolle der sozialen Medien und die Verbreitung simplifizierter Botschaften werden beleuchtet.
- Die Lebenssituation der muslimischen Jugendlichen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den spezifischen Bedürfnissen und Lebensumständen junger Muslime. Es werden die Herausforderungen und Schwierigkeiten beleuchtet, denen sie in ihrer alltäglichen Lebenswelt gegenüberstehen. Es werden verschiedene Handlungsansätze für die Sozialarbeit vorgestellt, um diese Herausforderungen zu bewältigen und jungen Menschen eine positive Entwicklung zu ermöglichen.
- Einzelcoaching: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung von individueller Betreuung und vertrauensvollen Beziehungen zwischen Sozialpädagog(inn)en und Jugendlichen.
- Gruppencoaching: Es werden die Vorteile von Gruppenarbeit und der Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen auszutauschen, hervorgehoben.
- Netzwerkarbeit: Die Wichtigkeit von interdisziplinärer Zusammenarbeit und der Einbeziehung verschiedener Akteure, wie zum Beispiel Jugend- und Sozialhilfe, Moscheeverbände und Eltern, wird betont.
- Fortbildung: Dieser Abschnitt unterstreicht die Bedeutung der kontinuierlichen Fortbildung von Sozialpädagog(inn)en, um sie für den Umgang mit den komplexen Herausforderungen der Radikalisierung zu sensibilisieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Thematik der Radikalisierung junger Muslime im Kontext islamistischer Gruppen. Sie analysiert die Motivationsfaktoren, die zur Verengung des Blickes und zur Inszenierung einer neuen Identität beitragen. Im Mittelpunkt stehen die Bedeutung von Identität, Zugehörigkeit, Diskriminierung, Ausgrenzung, Sozialarbeit, Prävention, Intervention, Kommunikation, Beziehungsgestaltung und Netzwerkarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum schließen sich junge Muslime islamistischen Gruppen an?
Oft nicht aus rein religiösen Gründen, sondern weil diese Gruppen soziale Anerkennung, Wertschätzung und ein Gefühl der Zugehörigkeit bieten, das im Alltag fehlt.
Welche Rolle spielt Diskriminierung bei der Radikalisierung?
Erlebte Ausgrenzung in Schule, Medien oder Beruf wirkt als Katalysator und treibt Jugendliche in "Filterblasen" und die Sakralisierung eigener Ideologien.
Was ist die Metapher des "Lebenskoffers"?
Sie symbolisiert die individuellen Erfahrungen und die Lebensgeschichte eines Jugendlichen und wie diese durch Radikalisierung "verengt" werden können.
Wie können Sozialpädagogen der Radikalisierung entgegenwirken?
Durch Beziehungsgestaltung, Einzel- und Gruppencoaching sowie eine starke interdisziplinäre Netzwerkarbeit mit Moscheen und Eltern.
Welche Bedeutung hat die Fortbildung für Fachkräfte in diesem Bereich?
Fortbildungen sind essenziell, um Sozialpädagogen für die komplexen Mechanismen der Radikalisierung zu sensibilisieren und Handlungssicherheit zu geben.
- Citation du texte
- Samet Er (Auteur), 2020, Junge Muslime im sozialen Geflecht der Islamisten. Eine Handlungsempfehlung für Sozialpädagogen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1367780