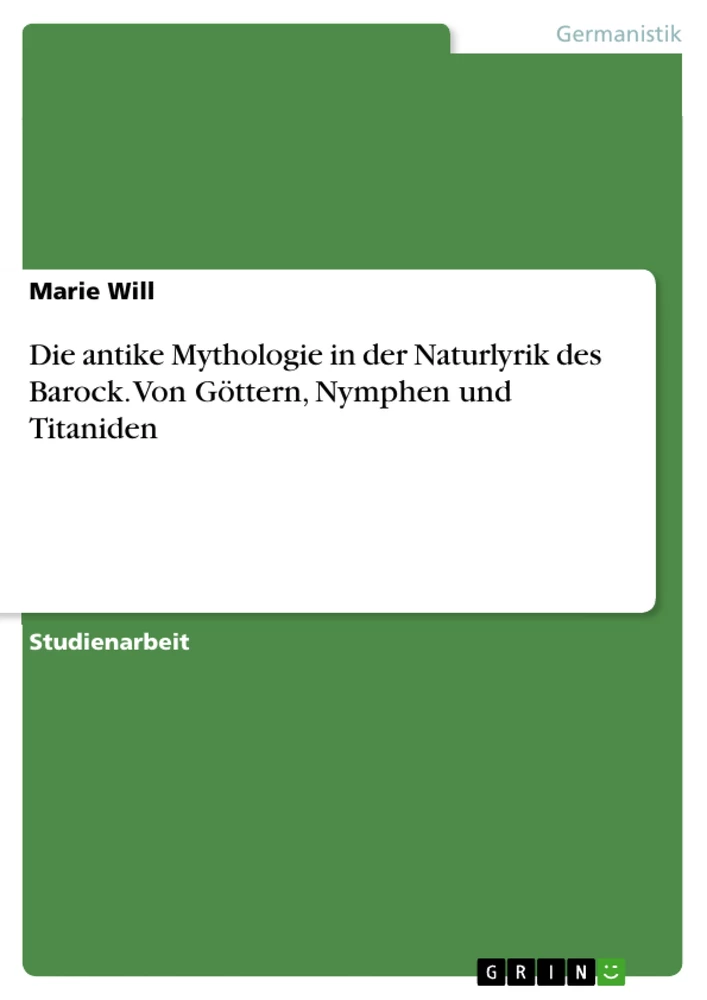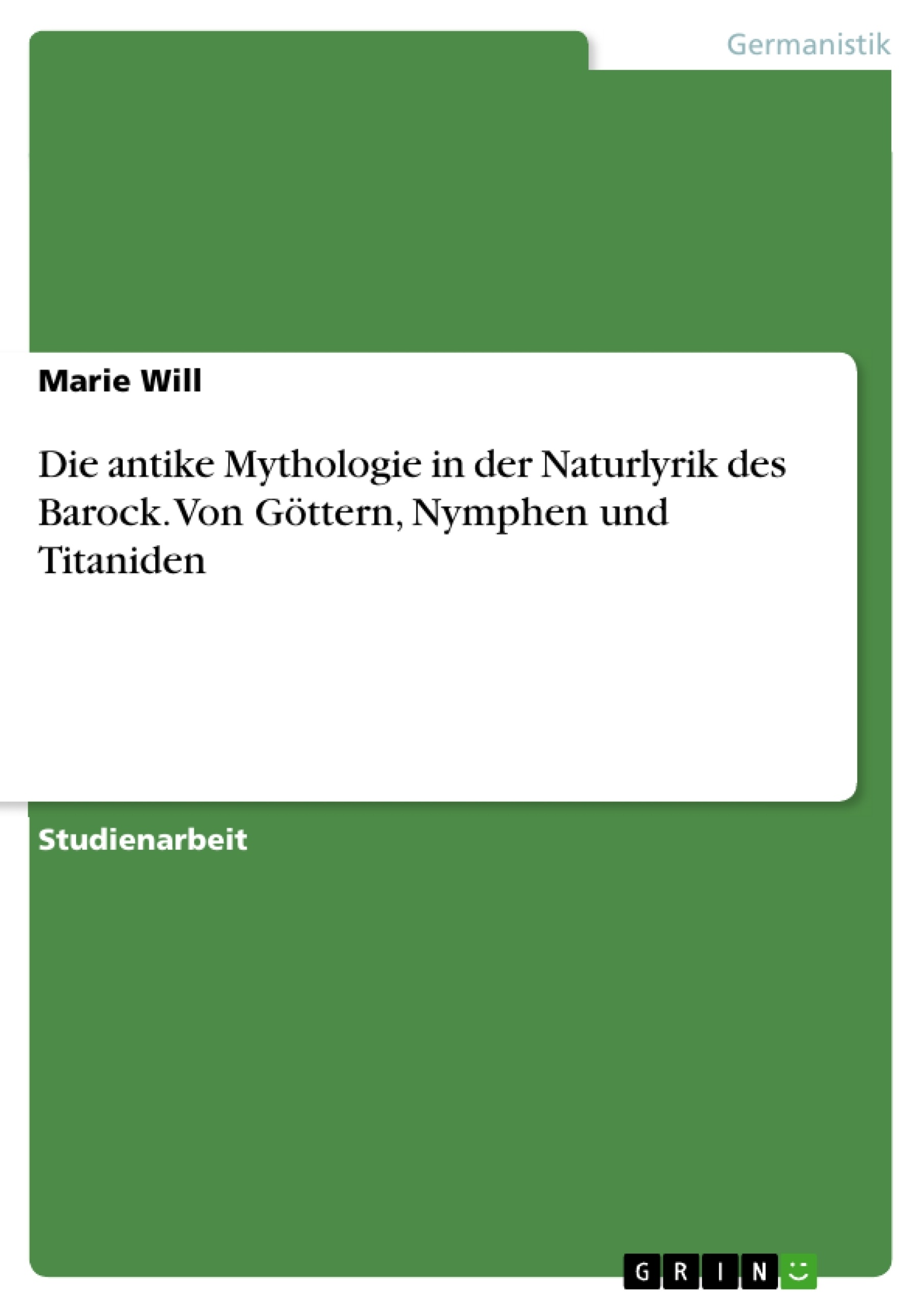Diese Hausarbeit strebt an, das außergewöhnliche Phänomen der Co-Existenz christlicher und heidnischer Themen in der Barocklyrik aufzudecken, indem spezifische Götter der antiken Mythologie identifiziert und der Grund für ihre fortgesetzte Präsenz in der Naturlyrik, trotz der Dominanz des christlichen Gottes, untersucht wird.
Im Kontext der politischen und religiösen Stabilität, die während der Konsolidierungsphase in Europa erreicht wurde, erlebte die Kirche eine Wiederbelebung, was sich in der Kunst und Literatur, insbesondere in der Verstärkung christlicher Themen, widerspiegelte (vgl. Hartmann „Das große Kunstlexikon“). Dennoch fand erstaunlicherweise auch der heidnische Glaube Platz in der Barocklyrik und Literatur. Durch eine detaillierte Analyse ausgewählter Werke untersucht diese Arbeit die Darstellung antiker Götter und Göttinnen in der Naturlyrik und erforscht die Gründe für ihre beständige Präsenz neben dem allgegenwärtigen christlichen Gottesbild.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine Einführung in das Zeitalter des Barock und seine Lyrik
- Eine Einführung in die Götter und Göttinnen der antiken Mythologie
- Eine Analyse dreier barocker Naturgedichte
- Friedrich Spee - Liebgesang der Gesponẞ Jesu, im anfang der Sommerzeit
- Simon Dach - An eine Nymfe
- Martin Opitz - An Asterien
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das überraschende Nebeneinander von christlichem und heidnischem Glauben in der barocken Naturlyrik. Ziel ist es, anhand ausgewählter Beispiele die Präsenz antiker Götter und Göttinnen aufzuzeigen und deren Integration trotz der dominierenden christlichen Theologie zu erklären.
- Der Barock als Epoche: Charakteristika und Entwicklung der Lyrik
- Die drei Hauptmotive der barocken Lyrik: Carpe Diem, Memento Mori, Vanitas
- Der christliche Glaube in der barocken Naturlyrik
- Die Götter der antiken Mythologie in der barocken Naturlyrik
- Analyse ausgewählter Gedichte und deren Umgang mit mythologischen Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Koexistenz antiker Mythologie und christlichen Glaubens in der barocken Naturlyrik. Sie definiert den Barock als Epoche und hebt die Bedeutung des christlichen Glaubens in der Kunst dieser Zeit hervor, um die überraschende Präsenz heidnischer Elemente hervorzuheben. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie antike Gottheiten in die Naturdichtung integriert wurden, trotz der dominierenden christlichen Weltanschauung.
Eine Einführung in das Zeitalter des Barock und seine Lyrik: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der deutschen Lyrik im Barock. Es beschreibt die Reformbestrebungen von Martin Opitz, der sich für die Verwendung der deutschen Sprache in der Dichtung einsetzte und ein Regelwerk für die Metrik schuf. Der Konflikt zwischen Regelpoetik und freierer Form wird dargestellt. Die drei Hauptmotive der barocken Lyrik – Carpe Diem, Memento Mori und Vanitas – werden eingeführt und ihre Bedeutung im Kontext des Todes- und Vergänglichkeitsbewusstseins erläutert. Der starke Einfluss des christlichen Glaubens auf die Lyrik wird ebenfalls hervorgehoben.
Eine Einführung in die Götter und Göttinnen der antiken Mythologie: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über den Begriff "Mythos" und die antike Mythologie. Es erklärt die Funktion von Mythen als Orientierungshilfe und die Bedeutung der Mythologie als Gesamtheit der Mythen einer Kultur. Die Darstellung dient als Grundlage für das Verständnis der im folgenden Kapitel analysierten Naturgedichte, in denen antike Gottheiten eine Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Barocklyrik, Naturlyrik, Antike Mythologie, Christlicher Glaube, Heidnische Elemente, Martin Opitz, Friedrich Spee, Simon Dach, Carpe Diem, Memento Mori, Vanitas, Gott, Göttinnen, Götter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Analyse barocker Naturgedichte und die Integration antiker Mythologie"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die überraschende Koexistenz von christlichem und heidnischem Glauben in der barocken Naturlyrik. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie antike Götter und Göttinnen in Gedichte dieser Epoche integriert wurden, trotz der vorherrschenden christlichen Weltanschauung.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei barocke Naturgedichte: "Liebgesang der Gesponẞ Jesu, im anfang der Sommerzeit" von Friedrich Spee, "An eine Nymfe" von Simon Dach und "An Asterien" von Martin Opitz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die Präsenz antiker Götter und Göttinnen in der barocken Naturlyrik aufzeigen und deren Integration trotz der dominierenden christlichen Theologie erklären. Sie untersucht, wie diese scheinbar widersprüchlichen Elemente nebeneinander existieren und sich in der Dichtung manifestieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Charakteristika und Entwicklung der barocken Lyrik, die drei Hauptmotive der barocken Lyrik (Carpe Diem, Memento Mori, Vanitas), der christliche Glaube in der barocken Naturlyrik, die Götter der antiken Mythologie in der barocken Naturlyrik und die Analyse des Umgangs mit mythologischen Figuren in ausgewählten Gedichten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus folgenden Kapiteln: Einleitung, Einführung in das Zeitalter des Barock und seine Lyrik, Einführung in die Götter und Göttinnen der antiken Mythologie, Analyse dreier barocker Naturgedichte (mit Einzelanalysen der oben genannten Gedichte) und Zusammenfassung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Koexistenz antiker Mythologie und christlichen Glaubens in der barocken Naturlyrik. Sie definiert den Barock als Epoche und hebt die Bedeutung des christlichen Glaubens in der Kunst dieser Zeit hervor, um die überraschende Präsenz heidnischer Elemente zu betonen.
Was wird im Kapitel über den Barock und seine Lyrik behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der deutschen Lyrik im Barock, die Reformbestrebungen von Martin Opitz, den Konflikt zwischen Regelpoetik und freierer Form und die drei Hauptmotive der barocken Lyrik (Carpe Diem, Memento Mori, Vanitas) im Kontext des Todes- und Vergänglichkeitsbewusstseins. Der starke Einfluss des christlichen Glaubens wird ebenfalls hervorgehoben.
Was wird im Kapitel über die antike Mythologie behandelt?
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Begriff "Mythos" und die antike Mythologie, erklärt die Funktion von Mythen als Orientierungshilfe und die Bedeutung der Mythologie als Gesamtheit der Mythen einer Kultur. Es dient als Grundlage für das Verständnis der im folgenden Kapitel analysierten Naturgedichte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Barocklyrik, Naturlyrik, Antike Mythologie, Christlicher Glaube, Heidnische Elemente, Martin Opitz, Friedrich Spee, Simon Dach, Carpe Diem, Memento Mori, Vanitas, Gott, Göttinnen, Götter.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die deutsche Barocklyrik, die antike Mythologie und die Interaktion zwischen Religion und Literatur interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse literarischer Themen.
- Quote paper
- Marie Will (Author), 2019, Die antike Mythologie in der Naturlyrik des Barock. Von Göttern, Nymphen und Titaniden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1368684