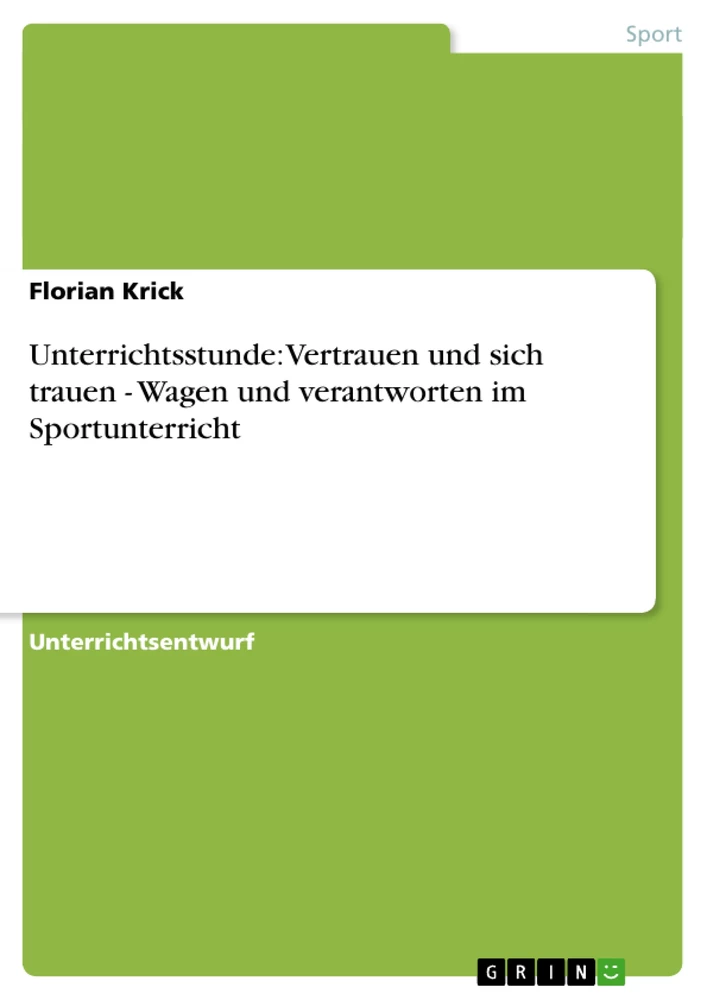Das Erleben von Wagnis ist ein bedeutsamer Bestandteil des Sportunterrichts (vgl. Koch, 1994; Baumann, Hundeloh & Bockhorst, 1998; Neumann, 2002; HKM, 2003, S. 6) und durch die Pädagogische Perspektive Etwas wagen und verantworten in der neuen Sportlehrplangeneration auch programmatisch verankert. Der Wegfall von Wagniselementen und risikobehafteten Situationen im Alltag und die gleichzeitig vermehrte Konfrontation „mit Erlebnis- und Reizangeboten (…), die sehr verlockend erscheinen und meist unreflektiert ausprobiert werden” (HKM, 2003, S. 8) führt häufig zu neuen riskanten Betätigungsfeldern, die sich auch auf negative Weise auf den Alltag auswirken können (z. B. Drogenkonsum, S-Bahn surfen usw.) (vgl. von Cube, 2000). Aber auch das (unreflektierte) Aufsuchen von legalen Wagnissituationen kann eine Spirale in Gang setzen: „Geht man von einem linearen und nicht-umkehrbaren Wagnisprozess aus, dann folgt auf das Gelingen der Wunsch nach einem größeren Wagnis“ (Neumann, 2002, S. 30). Irgendwann überschreitet der Wagende auf der Suche nach dem „Kick“ die Grenze bei der die kompetenzbedingte Kontrolle nicht mehr vorhanden ist und der Ausgang des Wagnisses (auch) von Zufall oder Glück abhängt.
Das Erleben von Wagniselementen im Sportunterricht kann davor sicherlich nicht vollständig schützen, aber der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe kann bzw. soll zumindest „die Ambivalenz von Risiko und verantwortbarem Wagnis aufarbeiten“ (HKM, 2003, S. 8). Allerdings können auch (pädagogisch reflektierte) Wagnissituationen im Sportunterricht ambivalent sein: Gelingt das Wagnis, bzw. wird die wagnisreiche Bewegungsherausforderung angenommen,
kann sich dies positiv auf das Selbstwirksamkeitskonzept auswirken, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen stärken (Neumann, 2002, S. 28; vgl. auch HKM, 2003, S. 8). Bewegungsaktionen, die Angst überwinden, Unbekanntes ausprobieren und eigene Fähigkeiten erleben lassen, Bewegungen, bei denen das Vertrauen zu sich selbst und zu anderen die Grundlage des sportlichen Handelns bildet, können als pädagogisch wertvolle Erfahrungsbereiche angesehen werden (vgl. hierzu Schmidt-Sinns, S. 106).
1 Didaktische Überlegungen
1.1 Sachanalyse: Wagen und Verantworten im Sportunterricht
Das1 Erleben von Wagnis ist ein bedeutsamer Bestandteil des Sportunterrichts (vgl. Koch, 1994; Baumann, Hundeloh & Bockhorst, 1998; Neumann, 2002; HKM, 2003, S. 6) und durch die Pä-dagogische Perspektive Etwas wagen und verantworten in der neuen Sportlehrplangeneration auch programmatisch verankert.
Der Wegfall von Wagniselementen und risikobehafteten Situationen im Alltag und die gleich-zeitig vermehrte Konfrontation „mit Erlebnis- und Reizangeboten (...), die sehr verlockend er-scheinen und meist unreflektiert ausprobiert werden” (HKM, 2003, S. 8) führt häufig zu neuen riskanten Betätigungsfeldern, die sich auch auf negative Weise auf den Alltag auswirken kön-nen (z. B. Drogenkonsum, S-Bahn surfen usw.) (vgl. von Cube, 2000). Aber auch das (unreflek-tierte) Aufsuchen von legalen Wagnissituationen kann eine Spirale in Gang setzen: „Geht man von einem linearen und nicht-umkehrbaren Wagnisprozess aus, dann folgt auf das Gelingen der Wunsch nach einem größeren Wagnis“ (Neumann, 2002, S. 30). Irgendwann überschreitet der Wagende auf der Suche nach dem „Kick“ die Grenze bei der die kompetenzbedingte Kont-rolle nicht mehr vorhanden ist und der Ausgang des Wagnisses (auch) von Zufall oder Glück abhängt.
Das Erleben von Wagniselementen im Sportunterricht kann davor sicherlich nicht vollständig schützen, aber der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe kann bzw. soll zumindest „die Am-bivalenz von Risiko und verantwortbarem Wagnis aufarbeiten“ (HKM, 2003, S. 8).
Allerdings können auch (pädagogisch reflektierte) Wagnissituationen im Sportunterricht ambivalent sein: Gelingt das Wagnis, bzw. wird die wagnisreiche Bewegungsherausforderung ange-nommen, kann sich dies positiv auf das Selbstwirksamkeitskonzept auswirken, das Selbstbe-wusstsein, das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen stärken (Neumann, 2002, S. 28; vgl. auch HKM, 2003, S. 8). Bewegungsaktionen, die Angst überwinden, Unbekanntes ausprobieren und eigene Fähigkeiten erleben lassen, Bewegungen, bei denen das Vertrauen zu sich selbst und zu anderen die Grundlage des sportlichen Handelns bildet, können als pädagogisch wert-volle Erfahrungsbereiche angesehen werden (vgl. hierzu Schmidt-Sinns, S. 106).
Wird die wagnisreiche Herausforderung hingegen gar nicht erst angenommen, kann dies auch negative Auswirkungen haben (z. B. schwindendes Selbstvertrauen, Entmutigung, Vermei-dungshaltung). Das Scheitern einer wagnisreichen Bewegung kann sogar mit einem Verlet-zungsrisiko verbunden sein. Für den Sportunterricht gilt, dass die objektive Sicherheit in jedem Fall gewährleistet sein muss. Zudem muss den Schülern klar gemacht werden, dass Wagnis-empfinden individuell ist, sich also nicht vergleichen oder an sozialen bzw. kriterialen Bezugs-normen messen lässt. Ein „Nein-Sagen“ muss ohne Gesichtsverlust möglich sein. Gleichzeitig sollten die Wagnissituationen aber so differenziert gestaltet werden, dass möglichst wenige bzw. keine Schüler diese gar nicht erst annehmen.
1.2 Didaktische Überlegungen zur Einbindung der Stunde in die Unterrichtsreihe
Die Unterrichtsstunde „Sich trauen und anderen vertrauen – Wagnissituationen im Sportunter-richt“ folgt – im Sinne einer inhaltlichen Ergänzung – einer sechs Doppelstunden umfassenden Unterrichtsreihe zum Thema „Le Parkour – L’Art du déplacement“, die im Bewegungsfeld „Be-wegen an und mit Geräten“ durchgeführt wurde. Die DSB-SPRINT-Studie hat gezeigt, dass im Sportunterricht zwar relativ häufig geturnt wird, Turnen bei den Schülern jedoch eher unbe-liebt ist (vgl. DSB, 2006). Die offene didaktische Struktur der Bewegungsfelder erlaubt nun die begründete Auswahl fachlicher Inhalte, die sowohl „in oberstufengemäßer Form ein systema-tisches und vertiefendes Erarbeiten sportlicher Bewegungskompetenz (...) ermöglichen“ (HKM, 2003, S. 17) als auch der aktuellen jugendlichen Bewegungswelt entsprechen. Zu Beginn der Unterrichtsreihe wurde die (begründete) Hoffnung formuliert (vgl. Entwurf zum Unterrichtsbe-such am 29.10.2007), den Schülern mit Le Parkour als „Paradebeispiel für eine aktuelle Crosso-ver-Sportart“ (Pape-Kramer, 2007, S. 169) eine motivierende Gelegenheit zu bieten, sich mit turnerischen Bewegungsformen intensiv auseinanderzusetzen und die eigenen Bewegungs-kompetenzen in diesem Bewegungsfeld zu erweitern (vgl. auch Laßleben, 2007). Die Ergebnis-se der Schülerpräsentationen sowie die schriftlichen Schülerrückmeldungen im Rahmen der Evaluation der Unterrichtsreihe zeigen, dass sich diese Hoffnung erfüllt hat: Die Schüler haben sehr motiviert und engagiert gearbeitet, neue (turnerische) Bewegungen gelernt und dabei – nach eigener Auskunft – viel Freude gehabt.
Gleichwohl wurde schon zu Beginn der Unterrichtsreihe von einigen Schülern der Wunsch ge-äußert Saltobewegungen zu erlernen. Diesem Wunsch habe ich nicht sofort entsprochen, je-doch angekündigt, dies im Anschluss an die Unterrichtsreihe zu tun.
Zwei Drittel der Schüler haben angegeben „Im Rahmen der Parkour-Reihe (...) mehrmals Wag-nissituationen“ erlebt zu haben (vgl. Evaluation in der letzten Doppelstunde) bzw. dass „das Ausführen mancher Bewegungen (...) ein Wagnis darstellte“ (vgl. Reflexion der vierten Doppel-stunde). Allerdings waren diese Wagnisse (fast) ausschließlich von den eigenen Fähig- und Fertigkeiten und dem Vertrauen in diese abhängig. Beim Neuerwerb turnerischer Bewegungen ist indes häufig auch das Vertrauen in Andere von zentraler Bedeutung, nämlich dann, wenn es sich um Bewegungen handelt, die eine aktive Hilfeleistung erfordern2.
In dieser Unterrichtsstunde sollen beide Aspekte (Realisieren einer Saltobewegung, anderen Vertrauen) aufgegriffen werden. Da dies in der Kürze der Zeit nicht erschöpfend möglich ist, werden beide Themen in der Folgestunde noch einmal kurz aufgegriffen sowie im Rahmen einer Unterrichtsreihe mit dem Thema „Von der Individualleistung zum Gemeinschaftswerk“ im neuen Schulhalbjahr weitergeführt, um den Prinzipien Kontinuität, Vertiefung und Progression (vgl. HKM, 2003, S. 12) gerecht zu werden.
1.3 Didaktische Überlegungen zur Unterrichtsstunde
Das Gassenlaufen zeigt den Schülern einerseits auf, wie schwer es sein kann, sich auf andere zu verlassen. Andererseits wird deutlich, dass sie ihren Mitschülern vertrauen können, was als Vorbereitung für die folgende Übung bedeutsam ist. Drittens muss jeder einzelne Schüler ver-antwortlich handeln, möchte er nicht den Abbruch des jeweiligen Laufes provozieren. Diese Aufgabe stellt keine besonderen Anforderungen an Koordination oder Kondition, so dass alle Schüler unabhängig von ihrem motorischen Leistungsniveau gleichermaßen diese Erfahrung machen können.
Das Stage-Diving3 stellt in mehrfacher Hinsicht eine Steigerung dar:
- Das subjektive Wagnisempfinden ist höher, da ein Sturz aus relativ großer Höhe die Folge eines Nicht-Fangens wäre.
- Es besteht nicht die Möglichkeit, die Bewegung „wagnisreduzierend“ auszuführen, wie das beim Gassenlaufen durch Verringerung der Laufgeschwindigkeit der Fall ist. Es gibt keinen Kompromiss: entweder der Schüler springt / lässt sich fallen oder eben nicht.
Allerdings bietet diese Übung vielfältige Möglichkeiten das individuelle Wagnisempfinden durch Variation der Ausführung zu steigern (rückwärts; mit geschlossenen Augen; späteres Hochnehmen der Arme durch die Fänger; Schüler, der sich in die Gasse legt; mit Absprung; Kombination der Variationen) bzw. durch Reduktion der Kastenhöhe notfalls auch zu reduzie-ren. Somit wird den unterschiedlichen Vorerfahrungen, Einstellungen und Voraussetzungen der Schüler Rechnung getragen (vgl. HKM, 2003, S. 12).
Diese Wagnissituation bietet sich m. E. zudem besonders an, da z. B.
- im Vergleich zum „Pendel“ diese Aufgabe einen ungleich höheren Aufforderungscha-rakter (vgl. hierzu auch Baumann, Hundeloh & Bockhorst, 1998, S. 17) und ein bedeu-tend höheres Wagnismoment besitzt. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Schü-ler in den vergangenen Wochen mehrfach mit Wagnissituationen konfrontiert waren und das Pendel vermutlich bei den meisten die individuelle „Wagnisschwelle“ nicht er-reichen würde.
- im Vergleich zu Fall-Arrangements z. B. von den Ringen, immer alle Schüler beteiligt sind;
- keine hohen Voraussetzungen an die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten ge-stellt werden, somit alle Schüler gleichermaßen die Bewegung realisieren können.
[...]
1 Der Unterrichtsbesuch findet in einer Lerngruppe der Jahrgangsstufe 11 statt, die im Klassenverband unterrichtet wird. Sie setzt sich aus insgesamt 23 Schülerinnen und Schülern (11 Schülerinnen und 12 Schüler) zusammen. Ich unterrichte diese Klasse seit Beginn des Schuljahres. In diesem Entwurf wird aus stilistischen Gründen durchgängig die maskuline Form verwendet. Wenn in allgemeiner Form von Schülern gesprochen wird, sind grundsätzlich Mädchen und Jungen gemeint.
2 Auch der Lehrplan fordert, dass die Schüler notwendige und geeignete Maßnahmen zum Helfen und Sichern im Lern- und Übungsprozess anwenden können sollen (HKM, 2003, S. 10).
3 Streng genommen ist diese Form des Springens in eine Menschgasse nicht als Stage-Diving zu bezeichnen und der Begriff ist zudem in manchen Kontexten negativ konnotiert. Er wurde trotzdem für diese Aufgabenstellung gewählt, da er Assoziationen der Schüler provoziert und der Aufforderungscharakter der Übung vermutlich (noch) gesteigert wird.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die pädagogische Perspektive „Wagen und Verantworten“?
Diese Perspektive im Sportunterricht soll Schülern helfen, die Ambivalenz von Risiko und verantwortbarem Wagnis zu reflektieren, Ängste zu überwinden und ihr Selbstvertrauen durch kontrollierte Herausforderungen zu stärken.
Warum ist Wagnis im Sportunterricht heute besonders wichtig?
Da Kinder im Alltag immer seltener mit natürlichen Risiken konfrontiert werden, suchen sie oft unreflektiert Reize (z.B. S-Bahn-Surfen). Der Sportunterricht bietet einen geschützten Raum, um Kompetenzen zur Risikoeinschätzung zu erwerben.
Dürfen Schüler im Unterricht „Nein“ zu einer Übung sagen?
Ja, ein „Nein-Sagen“ muss ohne Gesichtsverlust möglich sein, da Wagnisempfinden individuell ist. Die Lehrkraft sollte Aufgaben jedoch so differenzieren, dass jeder Schüler eine passende Herausforderung findet.
Was ist das Ziel von Übungen wie „Stage-Diving“ in der Sporthalle?
Diese Übungen fördern das gegenseitige Vertrauen und die Verantwortung der Mitschüler als Fänger sowie den Mut des Springenden, sich auf die Gruppe zu verlassen.
Wie wird „Le Parkour“ im Schulsport eingesetzt?
Parkour dient als motivierende Trendsportart, um turnerische Grundfertigkeiten zu vermitteln und Schülern zu ermöglichen, ihre Umgebung kreativ und wagnisorientiert zu überwinden.
- Quote paper
- Dr. Florian Krick (Author), 2007, Unterrichtsstunde: Vertrauen und sich trauen - Wagen und verantworten im Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136910