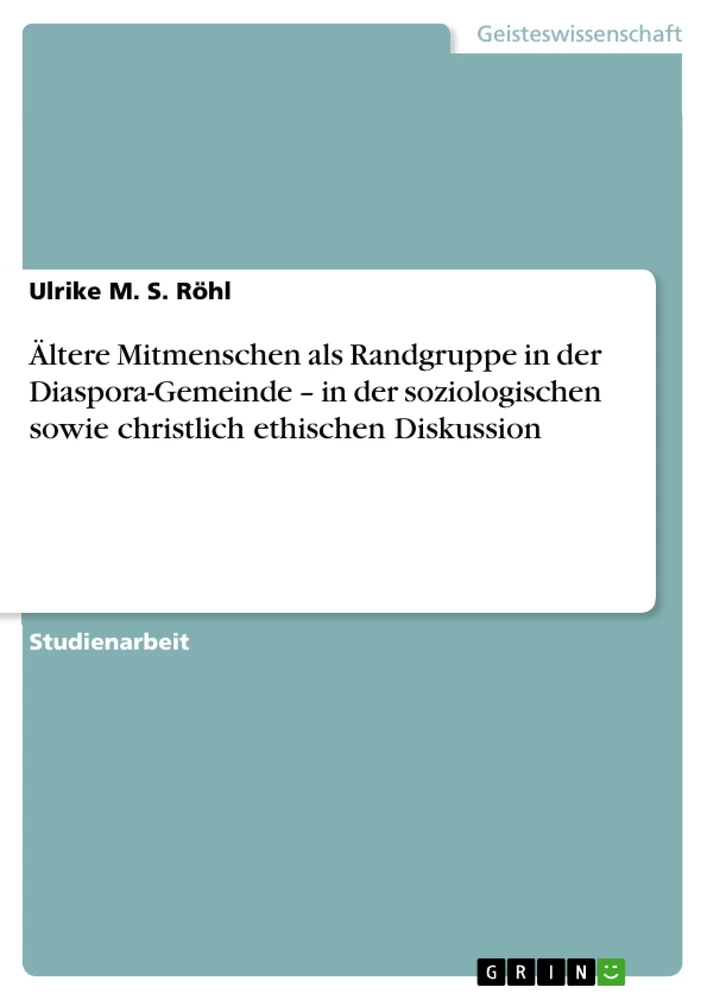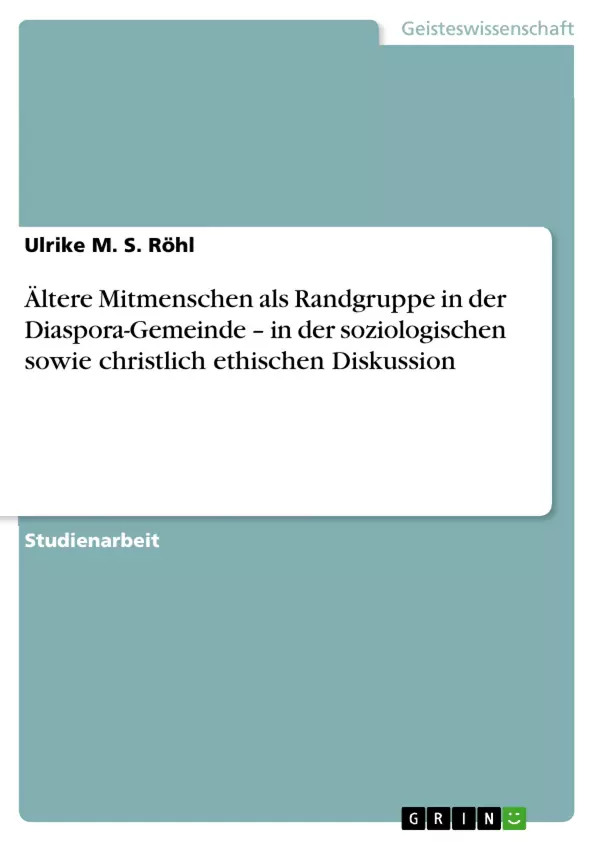Die Kirchenbänke in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland werden zunehmend leerer, ein Prozess, der kaum aufzuhalten scheint. Der Anteil der jungen Familien, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen sowie sich in der Kirchengemeinde aktiv engagieren, ist erschreckend niedrig. Es sind vorwiegend ältere Menschen, die das Kirchenbild entscheidend prägen. Jedoch genießt gerade diese Gruppe von Gemeindemitgliedern geringes Ansehen innerhalb des Kollektivs, sie werden eher belächelt, kaum beachtet oder gar aus dem Kommunenleben ausgegrenzt.
In unserer heutigen Leistungs- sowie Konsumgesellschaft, die lediglich darauf bedacht ist, Menschen ausschließlich nach ihren Beitrag zum Sozialprodukt, ihrem beruflichen Erfolg und Prestige sowie nach physischen und psychischen Fähigkeiten zu messen, wird unaufhörlich ein Netz gebildet, indem immer mehr Menschen zu exklusieren drohen. Es liegt nahe, dass unter diesen Bedingungen, gar Belastungen minder leistungsstarke, in der Marktwirtschaft erfolglose Personen oder Gruppen bzw. die Gesamtheit der Individuen, die nicht dem Idealbild der profanen Gesellschaftsordnung entsprechen, von vornherein als lästig sowie der Zielsetzung unserer Gesellschaft im Widerspruch stehend angesehen werden und somit schnell zur Randgruppe deklariert werden.
Mit Hilfe der hier vorliegenden, von mir persönlich, im Rahmen des im Sommersemester 2006 an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt belegten Soziologieseminar „Soziale Randgruppen in der Gemeinde“, angefertigten Hausarbeit „Ältere Mitmenschen als Randgruppe in der Diaspora -Gemeinde– in der soziologischen sowie christlich ethischen Diskussion“, möchte ich mich konzentrierter mit dem im soziologischen und theologischen Bereich auftretenden Phänomen der Randgruppe, explizit mit der Klientelgruppe der älteren Mitmenschen in der Diaspora-Pfarrgemeinde, auseinandersetzen, um anschließend verschiedene Integrationsmodelle vorzustellen, die es jenen, oftmals als Randgruppe deklarierten Menschen ermöglichen, wieder in die Kirchengemeinde zu inklusieren sowie sie erneut zum festen Bestandteil der christlichen Gemeinschaft werden zu lassen. Abschließend werde ich ein bewertendes Urteil bezüglich der Diskriminierung, der Ausgrenzung und Herabsetzung von älteren Glaubensmitgliedern in den Pfarrgemeinden, in Blick auf die von Jesus aufgetragene apostolische Sukzession, formulieren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Definition Randgruppe
2.1 Soziologischer Erklärungsansatz
2.2 Randgruppen im christlich biblischen Verständnis
3 Ältere Menschen als Randgruppen in der Diaspora-Gemeinde
3.1 Altern als Lebensphase
3.2 Ätiologie für das Aufkommen von Ranggruppen in der Gemeinde
3.3 Mögliche Interaktions- und Integrationsmodelle
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Mit Hilfe der hier vorliegenden, von mir persönlich, im Rahmen des im Sommersemester 2006 an der Katholischen Universität Eichstätt - Ingolstadt belegten Soziologieseminar „Soziale Randgruppen in der Gemeinde“, angefertigten Hausarbeit „Ältere Mitmenschen als Randgruppe in der Diaspora - Gemeinde– in der soziologischen sowie christlich ethischen Diskussion“, möchte ich mich konzentrierter mit dem im soziologischen und theologischen Bereich auftretenden Phänomen der Randgruppe, explizit mit der Klientelgruppe der älteren Mitmenschen in der Diaspora - Pfarrgemeinde, auseinandersetzen, um anschließend verschiedene Integrationsmodelle vorzustellen, die es jenen, oftmals als Randgruppe deklarierten Menschen ermöglichen, wieder in die Kirchengemeinde zu inklusieren sowie sie erneut zum festen Bestandteil der christlichen Gemeinschaft werden zu lassen. Abschließend werde ich ein bewertendes Urteil bezüglich der Diskriminierung, der Ausgrenzung und Herabsetzung von älteren Glaubensmitgliedern in den Pfarrgemeinden, in Blick auf die von Jesus aufgetragene apostolische Sukzession, formulieren.
Anlass für die intensivere Beschäftigung mit diesem Thema „Ältere Mitmenschen als Randgruppe in der Diaspora - Gemeinde – in der soziologischen sowie christlich ethischen Diskussion“ boten mir zum einen meine subjektiven Beobachtungen und Erfahrungen mit älteren Gemeindemitgliedern in der Katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius in Kassel sowie zum anderen meine persönlichen, privaten Erkenntnisse über meine eigenen Großeltern, beide bereits über 80 Jahre alt, denen es leider nicht mehr möglich ist, am kirchlichen Gemeindeleben aktiv teilzunehmen. Die Thematik tangiert mich im speziellen Maße aufgrund dessen, dass ich zum einen ein gewisses Interesse für die oftmals mit dem Alterungsprozess verbundenen Schwierigkeiten und Veränderungen in der Lebenswelt der älteren Mitmenschen der Gemeinde, vorzuweisen habe. Alte Menschen liefern ein klassisches Paradigma dafür, wie eng der Rückgang von psychischen und physischen Fähigkeiten mit dem Werteverlust der Person innerhalb eines Kollektivs, - einer Kirchengemeinde -, zusammenhängen, das es für jeden kritisch zu hinterfragen sowie zu beleuchten gilt, der eine ernsthafte, aufrichtige Beachtung der von Jesus gelebten Botschaft bekundet. Zum anderen bin ich zunehmend fasziniert vom weitreichenden Wesen der Erscheinungsform der Randgruppe in der Kirchengemeinde, welches sowohl die religiöse als auch moralisch - ethische Dimension der Fragen nach dem Sinn des Leides im Leben und des Lebens überhaupt, der Beschaffenheit der menschlichen Gottesebenbildlichkeit sowie der Art und Weise eines adäquaten Lebenswandels, beinhaltet. Beide für den rationalen sowie emotionalen Glaubensvollzug elementare Themen zu verbinden und in eine logische Stringenz zu bringen, stellt für mich ein großes Anliegen dar, dessen Herausforderung ich mich gerne stellen möchte.
2 Definition Randgruppe
Unter sozialen Randgruppen versteht man in einem allgemeinen Zugang gesellschaftliche Gruppierungen, den es aus den verschiedensten Gründen nicht oder lediglich geringfügig möglich ist, sich in die Gesellschaft zu integrieren, an dieser zu partizipieren und somit nicht selten am Rande der Gemeinde marginalisiert leben.
2.1 Soziologischer Erklärungsansatz
Die erste, primär zu analytischen Zwecken entwickelte Konzeption der sozialen Randgruppe stammt von Friedrich Fürstenberg[1]: „Derartige lose oder fester organisierte Zusammenschlüsse von Personen, die durch ein niedriges Niveau der Anerkennung allgemein verbindlicher soziokultureller Wert und Normen und der Teilhabe an ihren Verwirklichungen
Normen und der Teilhabe an ihren Verwirklichungen sowie am Sozialleben überhaupt gekennzeichnet sind, sollen als soziale Randgruppen bezeichnet werden“ (Fürstenberg 1965, S.27). Eine weitere Definition formulierte W. A. Newman wie folgt: „Als Minderheiten können solche Gruppen definiert werden, die von den sozialen Normen oder dem vorherrschenden Typus in jeweils bestimmter Weise abweichen, die im Rahmen der Verteilung sozialer Macht untergeordnet sind und selten mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Gesellschaft darstellen, in der sie leben“ (Newman 1973, S.20).
Im Diskurs der professionellen Sozialarbeit bezeichnet der Begriff der sozialen Randgruppe seit Ende der 60er - Jahre Gruppen von Personen, die aufgrund von unterschiedlichen Defiziten und Beeinträchtigungen nicht oder lediglich unvollkommen in die Kerngesellschaft eingegliedert sind. In Differenz zu Fürstenberg fokussiert diese Abhandlung jedoch nicht mehr ausschließlich die gesellschaftlichen und sozialen Folgen, sondern auch jene Attribute und die Lebenssituationen solcher Einheiten, die Beziehungen zwischen randständigen Gruppierungen und anderen Bevölkerungsformationen sowie die gesellschaftliche Bedingtheit und Befasstheit der Randständigkeit. Demnach weichen Randgruppen von den gesellschaftlich definierten Werte - und Normenvorstellungen ab, verfügen über mindere berufliche Qualifikationen und geringen Sozialkontakten, sind labil in den Produktionsprozess integriert, einkommensschwach und daher häufig auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen. Überdies wird betont, dass die Randposition dieser Gruppen nicht frei gewählt, sondern das Resultat von Exklusions - und Stigmatisierungsstrategien der dominanten Kerngruppe darstellt (siehe hierzu genauer Karstedt 1975).
Seit den 80er - Jahren wird dieses Randgruppenkonzept allerdings kontinuierlich in Frage gestellt. So wird moniert, dass der Begriff insofern unpräzise sei, als die Vielfalt der Personentypen, die sich darunter subsumieren lassen, zu heterogen sei. Ferner wird kritisiert, dass es sich dabei häufig nicht um Gruppen im Sinne sozialer Gruppen, sondern lediglich um statistische Einheiten bzw. Sozialkategorien handle. Aus soziologischer Perspektive lässt sich gegen die Begrifflichkeit zudem einwenden, dass sich in gegenwärtigen säkularisierten Gesellschaften nicht mehr nur eine, sondern diverse Kerngruppen identifizieren lassen. Nikolaus Sidler[2] ( vergleiche Sidler 1999) postuliert daher den Begriff aus der deskriptiv - analytischen Sprache zu eliminieren und ihn ausschließlich im sozialkonstruktivistischen Kontext als politischen Problembegriff zu verwenden. Mit anderen Worten: Als soziale Randgruppe gelten demnach all jene Gruppen, die im sozialpolitischen Diskurs als randständig und damit subventionswürdig eingestuft werden (siehe Wörterbuch der Sozialpolitik 2003).
2.2 Randgruppen im christlich biblischen Verständnis
Jesus Christus selbst, der unberührt vom kulturellen Geschehen seiner Zeit, in einem abgelegenen Winkel des Römischen Reiches lebte, zählte zu den Randgruppen, den Außenseitern jener Epoche. Er passte weder in die gläubige Wirklichkeit der frommen Juden, noch entsprach er den herrschenden Norm - und Wertevorstellungen der religiösen sowie politischen Herrschern. Er lehnte den Kontakt mit den Führern des Reiches weitgehend ab, „Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Talar einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen und in den Versammlungen und bei den Mahlzeiten obenan sitzen wollen, die der Witwen Häuser fressen und zum Schein lange beten; diese werden ein schwereres Gericht empfangen" (Mk 12,38-40), mied die Zugehörigkeit zu jeglichen Gruppierungen und brach mit den Traditionen, was seine randständige Position in der Gesellschaft zur Konsequenz hatte.
Seine Mission, Menschen zu retten und sie zum ewigen Heil zu geleiten, führte ihn zu den Außenseiter der Gesellschaft, zu den Aussätzigen, den Dirnen, den Kranken, den Zöllnern, den Sündern, den Andersdenkenden - und gläubigen, zu all jenen Individuen, die im gesellschaftlichen System nicht oder lediglich geringfügig integriert waren, die von der Masse der Bevölkerung gemieden, verachtet und ausgestoßen wurden. Jesus Christus pflegte gerade zu dieser Gruppe von Mitmenschen seine Freundschaft und hat sich diesen in intensiver Art und Weise angenommen, denn „Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt! Den wird der Herr erretten zur bösen Zeit“ (Ps 41,2). Randgruppen hat Jesus nie abgelehnt, sondern Außenseiter an seine Seite gezogen und sich Sündern zugewandt. Durch die nachhaltige Auseinandersetzung Jesu mit den randständigen Gruppierungen seiner Zeit erfahren gerade diese Menschen einen besonderen Stellenwert im Blick auf die Botschaft vom Reich Gottes, da „Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden“ (Jes 61,1 - 2), ihnen wird eine Besserung bzw. Veränderung der repressiven Verhältnisse verheißen.
[...]
[1] Friedrich Fürstenberg (* 1930 in Berlin) deutscher Soziologe, der besonders in den Bereichen der Industrie-, Arbeits- und Religionssoziologie hervor getreten ist.
[2] Nikolaus Sidler: Dr. Phil. Dr. theol. Nikolaus Sidler ist Professor für Soziologie an der Katholischen Fachhochschule Freiburg.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden ältere Menschen in der Diaspora-Gemeinde oft als Randgruppe wahrgenommen?
In einer Leistungs- und Konsumgesellschaft werden Menschen oft nach ihrem wirtschaftlichen Beitrag und Prestige gemessen. Ältere Menschen, deren physische Leistung nachlässt, drohen daher aus dem aktiven Kommunenleben ausgegrenzt zu werden.
Wie definiert die Soziologie den Begriff der Randgruppe?
Soziale Randgruppen sind Zusammenschlüsse von Personen, die aufgrund von Defiziten oder Abweichungen von Normen ein niedriges Niveau an Anerkennung erfahren und nur geringfügig am Sozialleben teilhaben können.
Was ist das christlich-biblische Verständnis von Randgruppen?
Jesus Christus suchte gezielt die Nähe zu Außenseitern der Gesellschaft (Kranke, Sünder, Arme). Im christlichen Verständnis erfahren gerade diese Menschen durch die Botschaft vom Reich Gottes einen besonderen Stellenwert.
Welches Ziel verfolgen die vorgestellten Integrationsmodelle?
Die Modelle sollen es als Randgruppen deklarierten älteren Menschen ermöglichen, wieder aktiv in die Kirchengemeinde zu inkludieren und ein fester Bestandteil der Gemeinschaft zu werden.
Welchen Anlass gab es für diese Untersuchung?
Anlass waren subjektive Beobachtungen in einer Kasseler Kirchengemeinde sowie persönliche Erfahrungen mit der eingeschränkten Teilhabe von Hochbetagten am Gemeindeleben.
- Citar trabajo
- Ulrike M. S. Röhl (Autor), 2006, Ältere Mitmenschen als Randgruppe in der Diaspora-Gemeinde – in der soziologischen sowie christlich ethischen Diskussion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136981