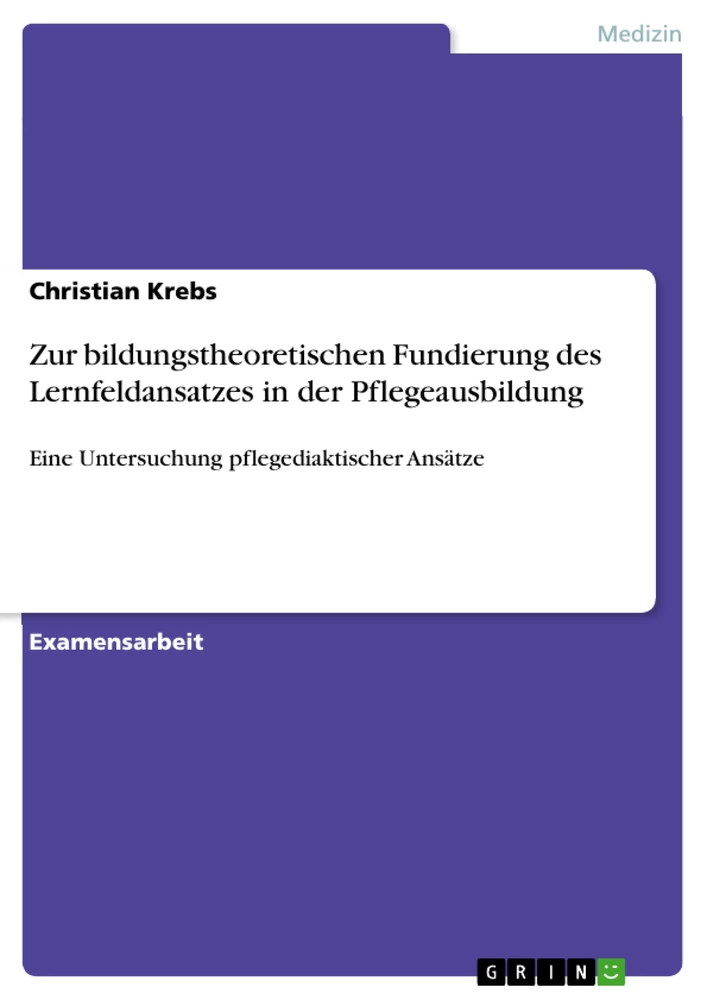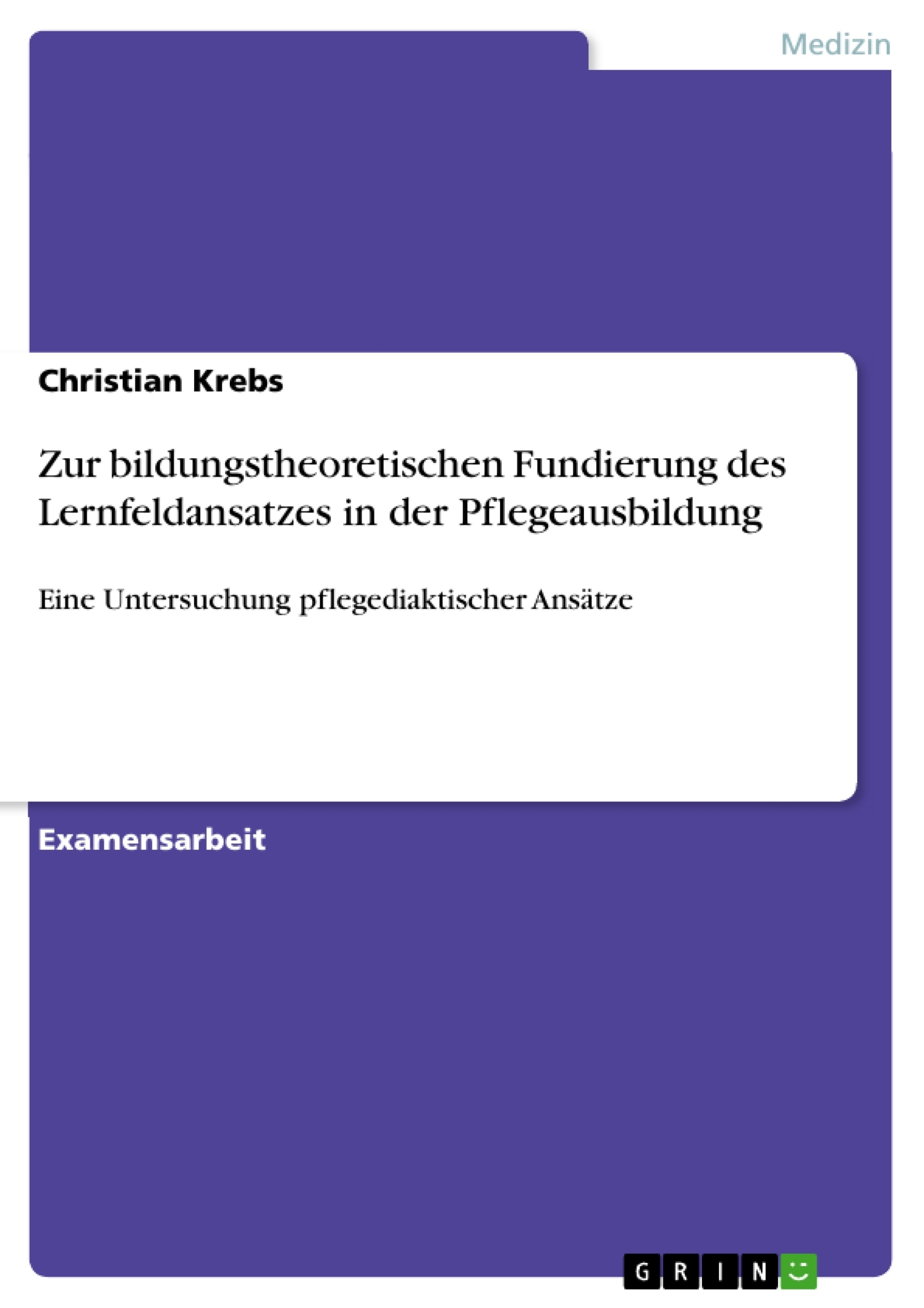Die Arbeit untersucht drei vorliegende pflegedidaktische Ansätze (Ingrid Darmann, Ulrike Greb, Kordula Schneider/Hannelore Muster-Wäbs) auf ihre paradigmatische und bildungstheoretische Passung mit den impliziten bildungstheoretischen Annahmen des Lernfeldansatzes der KMK. Dazu werden zuerst bildungstheoretische Begriffe und Theorien aus Allgemein- und Pflegepädagogik vorgestellt. Anschließend wird der Lernfeldansatz sowie dessen berufs- und pflegepädagogische Rezeption dargestellt. Implizite bildungstheoretische Annahmen des Lernfeldansatzes werden daraus abgeleitet. Dann werden drei pflegedidaktische Ansätze mit unterschiedlicher wissenschaftstheoretischer Verortung vorgestellt, kritisch analysiert und auf ihre Passung mit den herausgearbeiteten bildungstheoretischen Annahmen des Lernfeldansatzes analysiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bildungstheoretische Grundlagen
2.1 Allgemeine Grundlagen
2.1.1 Funktion und Charakter eines Bildungsbegriffes
2.1.2 Materiale vs. formale Bildung: Inhalte vs. Fähigkeiten
2.1.3 Kategoriale Bildung und Exemplarik
2.1.4 Bildung vs. Ausbildung
2.1.5 Die kritische Dimension von Bildung im 20. Jahrhundert
2.1.6 Kompetenzen & Schlüsselqualifikationen
2.1.7 Konstruktivismus
2.2 Bildung & Pflege
2.3 Zusammenfassung / Zwischenfazit
3. Der Lernfeldansatz der KMK
3.1 Entstehungshintergründe
3.2 Darstellung
3.3 Der Lernfeldansatz in der Kritik der Berufs- und Wirtschaftspädagogik
3.4 Konstruktivismus als implizites bildungstheoretisches Paradigma
3.5 Der Lernfeldansatz in der Rezeption der Pflegepädagogik
3.6 Zwischenfazit und Ausdifferenzierung der Fragestellung
4. Analyse pflegedidaktischer Ansätze
4.1 Das Strukturgitter Fachdidaktik Pflege (Ulrike Greb)
4.1.1 Darstellung
4.1.2 Einschätzung / Kritik
4.2 Die pflegedidaktische Heuristik (Ingrid Darmann)
4.2.1 Darstellung
4.2.2 Einschätzung / Kritik
4.3 Die Strukturierungshilfe (Kordula Schneider, Hannelore Muster-Wäbs)
4.3.1 Darstellung
4.3.2 Einschätzung / Kritik
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Gesetzestexte
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Orientierungen und Bezugspunkte zur didaktischen Reflexion pflegeberuflicher Bildungsprozesse
Abb. 2: Zusammenhang zwischen Handlungsfeldern, Lernfeldern und Lernsituationen und Reflexionsstufen zur didaktischen Analyse
Abb. 3: Grundstruktur des Strukturgitters und didaktische Mehrdimensionalität
Abb. 4: Übersicht der fachdidaktischen Kategorien in ihrer Vernetzung
Abb. 5: Pflegedidaktische Heuristik
Abb. 6: Pflegedidaktische Heuristik am Beispiel eines Narrativs
Abb. 7: Matrix zur Ermittlung eines Qualifikationsprofil
Abb. 8: Die 360° Analyse
Abb. 9: Frageraster zur 360° Analyse
Abb. 10: Darstellung der beruflichen Handlungskompetenzen
Abb. 11: Planungsraster zur handlungstheoretischen Aneignungsdidaktik
1. Einleitung
Seit 1996 der Unterausschuss für berufliche Bildung der Kultusministerkonferenz (KMK) die erste Version der Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz (KMK) für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule (im folgenden kurz ‚Handreichungen’ genannt) vorgelegt hat, ist Bewegung in die Lehrplandiskussion gekommen. Mittlerweile liegt das Dokument, in dem die KMK den von ihr erdachten Lernfeldansatz als curriculares Strukturierungsprinzip entwirft, in der vierten Fassung von September 2000 vor (vgl. KMK 2000). Innerhalb der betroffenen Erziehungswissenschaften haben die Handreichungen eine intensive kritische Diskussion angestoßen (vgl. insbesondere die Sammelbände Huisinga, Lisop, Speier 1999 und Lipsmeier, Pätzold 2000), und ein Ende ist auch fast zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung noch nicht abzusehen. Die kritische Auseinandersetzung bezieht sich dabei vor allem auf die nur wenig theoretisch ausformulierten und explizierten didaktisch-pädagogischen Postulate. Für einen Neuerungsansatz, der die Berufsbildung zur Bewältigung der gegenwärtigen sozialen- und ökonomischen Veränderungsprozesse bildungs- und lerntheoretisch reformieren will, bleiben die Aussagen relativ unpräzise und nahezu beliebig füllbar, weshalb von wissenschaftlicher Seite ein weitergehender Konzeptionalisierungsbedarf konstatiert wird.
Diese sich in der allgemeinen Berufs- und Wirtschaftspädagogik zutragenden Entwicklungen und Diskussionen werden von der Pflegepädagogik in den späten 1990er Jahren kaum rezipiert und aufgearbeitet (vgl. z.B. Muster-Wäbs, Schneider 1999). Das hat sicherlich zum einen damit zu tun, dass die Pflegepädagogik zu dieser Zeit erst beginnt, sich zu konstituieren und noch mit der Entwicklung pflegepädagogischer und –didaktischer Grundsatzfragen beschäftigt ist. Zum anderen sind die besagten Handreichungen als Hilfe für Lehrplankonstrukteure gedacht, die Curricula für Ausbildungsgänge des öffentlichen Dualen Systems der Berufsbildung entwerfen sollen. Administrativ sind die Pflegeausbildungsgänge auf Grund ihrer Sonderstellung nicht an die Handreichungen als Vorgabe gebunden: „Die Berufsbildung dieser Gesundheitsfachberufe fällt .. aus dem für die Berufsbildung in der Bundesrepublik Deutschland maßgeblichen normalen rechtlich- administrativen Rahmen“, weshalb sich die Kultusministerien der Länder für diese als „unzuständig bzw. allenfalls teilzuständig erklären“ (Bals 2002: 138). Spätestens seit 2002 ist findet aber auch in diesem Bereich der beruflichen Bildung eine intensive Diskussion zur Auslotung der Möglichkeiten und Grenzen einer Orientierung am Lernfeldansatz statt (vgl. z.B. Darmann, Wittneben 2002; Panke-Kochinke 2002). Ein Grund dafür ist das Bestreben, nicht noch mehr ins berufspädagogische Abseits zu geraten (vgl. Bischoff-Wanner 2003: 10). Ein anderer ist das Potential, welches gesehen wird, die pflegerischen Ausbildungsgänge didaktisch-methodisch und curriculumtheoretisch am ‚state of the art’ erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse zu orientieren (vgl. Oelke 2004: 14). Mit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des 2004 in Kraft getretenen neuen Krankenpflegegesetzes (KrPflG) wurde die curriculare Revisionsarbeit zudem auch von der administrativen Seite her notwendig, da die „gesetzlichen Regelungen .. neue Standards des Lehrens und Lernens [festlegen], die auch neue curriculare Überlegungen erfordern“ (Blotenberg u.a. 2004: 35). Eine Orientierung am Lernfeldansatz ist darin zwar nicht explizit enthalten, doch finden sich mit den zwölf Themenbereichen, die lediglich Lehrzielangaben enthalten und nicht mehr detailliert Inhalte vorschreiben sowie mit dem Verweis auf die Vermittlung fachlicher, personaler, sozialer und methodischer Kompetenzen eindeutig Bezüge dazu.[1]
Mit dem Lernfeldansatz wird ein großer Teil der Verantwortung für die curriculare Neugestaltung an die Schulen und die Lehrenden verlagert. Die Handreichungen geben dafür aber nur wenig Hilfestellungen und Vorgaben, da sie primär für die Konstrukteure der nur grob formulierten lernfeldstrukturierten Rahmenlehrpläne bestimmt sind. Diese werden dann den Schulen vorgelegt, um sie schul- und bildungsgangspezifisch mit detaillierten Inhalten aufzufüllen und die Unterrichtsplanung und -gestaltung danach auszurichten. Dabei sollen die relevanten Arbeits- und Geschäftsprozesse berücksichtigt und der Unterricht situations- und handlungssystematisch durchgeführt werden. Dies führt aber zu „einer erheblichen Verunsicherung der Akteure“ (Kremer, Sloane 2000: 176), wenn die Berufsschulen mit einem Konzept konfrontiert werden, „das sie weder verstehen noch umsetzen können, weil einfach inhaltliche aber auch organisatorische Räume fehlen“ (Panke-Kochinke 2002: 36).
Zumindest konzeptionell-theoretisch hat diese Situation dazu geführt, dass mittlerweile eine rege Entwicklung pflegedidaktischer Ansätze zur Bestimmung des Bildungsgehaltes von Lernsituationen (den schulischen Konkretisierungen der Lernfelder) eingesetzt hat.[2] Diese Ansätze sollen zumeist eine konzeptionelle Präzisierung der KMK-Vorgaben leisten und so deren theoretisch-konzeptionelle Schwächen ausgleichen. Darüber hinaus sollen sie das ersetzen bzw. hinzufügen, was die Handreichungen nur unzureichend leisten: die hinreichende Explikation des Bildungsauftrages der Berufsschule. So ist ein Kritikpunkt an den Handreichungen, dass Interpretationen möglich scheinen, diesen Bildungsauftrag zu vernachlässigen, und die geforderte Arbeits- und Geschäftsorientierung eng funktionell auszulegen (vgl. z.B. Huisinga 1999). Da aber der Wunsch besteht, die Pflegeausbildungsgänge nicht rein funktionell zu gestalten, sondern sie auch ausreichend bildungstheoretisch zu fundieren[3], bedarf es für die Implementation des Bildungsauftrages in den Curricula und den darauf aufbauenden Unterricht eben dieser weiteren fachdidaktischen „sach- und kompetenzbezogenen Systematisierungshilfen“ (Greb 2005b: 47). „Aktuell ist der Markt überschwemmt von solchen ‚Mitteln’ für die Lernfeldarbeit“ konstatiert dazu Greb (ebd.: 48).
Die Frage, die sich dabei stellt, ist, ob alle diese ‚Mittel’ in gleichem Maße in der Lage sind, der geforderten Bildungshaltigkeit von Lernfeldern (Darmann, Wittneben 2002) gerecht zu werden. Diese Frage bildet den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit. Dazu soll zuerst einmal geklärt werden, was mit den Begriffen Bildung und bildungstheoretischer Fundierung überhaupt gemeint ist bzw. gemeint sein soll. Darzustellen sind dabei die Unterschiede zwischen den Begriffen ‚Bildung’ und ‚Ausbildung’, unterschiedliche bisher vorliegende Bildungskonzepte, die eine Relevanz für die in dieser Arbeit bearbeitete Thematik haben, sowie deren Vor- und Nachteile. Als begriffliche und theoretische Vorarbeit soll damit die Grundlage für das weitere Vorgehen gelegt werden. Im Anschluss an diese allgemeinen bildungstheoretischen Grundlagen (Kap. 2.1) soll begründet werden, warum die Pflegepädagogik sich um die bildungstheoretische Fundierung der Pflegeausbildung bemüht, und wie ein Begriff von Bildung, der in Verbindung mit dem Beruf Pflege steht, auszusehen hat (Kap. 2.2 und 2.3). Im darauf folgenden Kapitel steht dann der Lernfeldansatz der KMK im Mittelpunkt. Ausgehend von der Frage, wo Chancen und Grenzen bestehen, mit diesem die geforderte Idee von Bildung umzusetzen, wird der Ansatz zunächst vorgestellt (Kap. 3.1 & 3.2). Danach wird die Kritik, die sich aus der Berufs- und Wirtschaftspädagogik äußert, dargelegt (Kap. 3.3). Diese sich zumeist auf eine mangelnde bildungstheoretische Fundierung beziehende Kritik wird ergänzt durch die These einer implizit wirkenden wissenschaftstheoretisch-paradigmatischen Bildungsvorstellung (Kap. 3.4). Daran anschließend erfolgt eine kurze Einführung in die pflegepädagogische Rezeption des Lernfeldansatzes und die Ansprüche der Pflegepädagogik an eine bildungstheoretische Umsetzung (Kap. 3.5). Über die Beantwortung der Frage nach den Chancen und Grenzen des Lernfeldansatzes mit dem Nachweis einer ungenügenden bildungstheoretischen Fundierung und der Notwendigkeit fachdidaktischer Systematisierungshilfen wird dann die Ausgangsfragestellung ausdifferenziert (Kap. 3.6). Dies geschieht bewusst erst an späterer Stelle, da die notwendigen Vorklärungen das Verständnis erleichtern sollen, und die These aus Kap. 3.3 so mit einbezogen werden kann. Das sich anschließende Kapitel (Kap. 4) stellt dann drei pflegedidaktische Ansätze zur bildungstheoretischen Fundierung des Lernfeldansatzes in der Pflegeausbildung vor: Das Strukturgitter Fachdidaktik Pflege von Ulrike Greb, die pflegedidaktische Heuristik von Ingrid Darmann und die Strukturierungshilfe von Kordula Schneider und Hannelore Muster-Wäbs. Das Auswahlkriterium für die jeweiligen Ansätze ist dabei kein arbiträres. Jeder Ansatz steht beispielhaft für eine bestimmte paradigmatische Verortung, die ihn beeinflusst, seine Grundkategorien hervorbringt (vgl. Gruschka 2002: 202) und Welt-, Menschen- und Bildungsverständnis mit bedingt. Diese drei Ansätze werden, gemäß den Fragestellungen aus Kap. 3.6, auf ihre Potentiale untersucht, bildungshaltige Lernsituationen und Lernfelder für die Pflege zu entwickeln.
2. Bildungstheoretische Grundlagen
2.1 Allgemeine Grundlagen
2.1.1 Funktion und Charakter eines Bildungsbegriffes
Mit bildungstheoretischer Fundierung ist hier gemeint, dass eine Theorie vorliegt, die in der Lage ist zu begründen und zu beschreiben, was Bildung sein soll. Nach Klafki entspricht der daraus resultierende Bildungsbegriff einer zentralen Ziel- und Orientierungskategorie für alle am Bildungsprozess junger Menschen Beteiligten, die unbedingt notwendig ist, wenn die pädagogische Arbeit „nicht in ein unverbundenes Nebeneinander oder gar Gegeneinander von zahllosen Einzelaktivitäten auseinanderfallen soll, wenn vielmehr pädagogisch gemeinte Hilfen, Maßnahmen, Handlungen und individuelle Lernbemühungen begründbar und verantwortbar bleiben oder werden sollen.“
(Klafki 1996: 44)
Notwendig ist diese Orientierungskategorie, da die Pädagogik immer in einem doppelten Legitimationsverhältnis steht. Sie ist zum einen auf die Gesellschaft bezogen. D.h. sie hat - aus strukturfunktionalistischer[4] Sicht- die dreifache Aufgabe der Qualifikation, Selektion und Integration bzw. Legitimation[5] und damit eine gesellschaftsstabilisierende Funktion. Auf der anderen Seite ist sie orientiert am jungen Menschen und dessen Handlungsfähigkeit und ‚kritischer Mündigkeit’, was erstens nicht allein aus dem gesellschaftlichen Auftrag abgeleitet werden kann und zweitens u. U. diesem entgegen steht (vgl. Tillmann 2001: 130-136). Da die Lehrplaninhalte aber nicht ausschließlich von der Pädagogik selbst hervorgebracht werden, sondern das Ergebnis des ‚Kampfes gesellschaftlicher Mächte’[6] sind, wie Erich Weniger in den 1930er Jahren festgestellt hat, braucht sie – in ihrer Funktion als Vermittlungsinstanz zwischen diesen Inhalten und den jungen Menschen - ein Kriterium, mit dem beliebige inhaltliche Ansprüche erzieherisch zu beurteilen sind. Der verwendete Bildungsbegriff stellt dieses Beurteilungskriterium dar. (vgl. Blankertz 1986: 32, 41) Als normative Kategorie beschreibt er das gewünschte Ergebnis sowie den dazu notwendigen Bildungsprozess. Art und Umfang des normativen Gehaltes ergeben sich zumeist aus dem größeren theoretisch-paradigmatischen Rahmen, welcher der Bildungstheorie zu Grunde liegt und der über Welt- und Menschenbild entscheidet. Die Begriffe ‚paradigmatisch’ und ‚Paradigma’ wurden von Thomas Kuhn in den 1960er Jahren in die Wissenschaftstheorie eingeführt (vgl. Kuhn 1996). Er sieht jede Wissenschaft geleitet von einem Paradigma, welches über das Weltbild, wissenschaftliche Problem- und Fragestellungen (Erkenntnisinteressen) sowie methodisches Vorgehen zum Erschließen der Welt entscheidet. Solch ein theoretisch-paradigmatischer Rahmen ist einer Bildungstheorie zumeist im Sinne einer Metatheorie vorgelagert. Das heißt, die Bildungstheorie wird bestimmt bzw. beeinflusst von allgemeineren (philosophischen, soziologischen, anthropologischen, naturwissenschaftlichen, etc.) Theorieentwürfen und deren paradigmatischer Welt- und Wissenschaftsauffassung (vgl. Jongebloed, Twardy 1983: 8-10).
Bildungstheoretische Modelle zeichnen sich also dadurch aus, dass sie anhand der übergeordneten Zielkategorie eines theoretisch begründeten Bildungsbegriffes Lehrplaninhalte aus ihrem Sachbezug lösen und nach pädagogischen Zwecken ordnen (vgl. Blankertz 1986: 31) und so die pädagogischen Zwecke und Ziele innerhalb von Bildungsmaßnahmen sichern[7].
2.1.2 Materiale vs. formale Bildung: Inhalte vs. Fähigkeiten
Eine wesentliche Unterscheidung von Bildungsvorstellungen besteht zwischen materialer und formaler Bildung. Materiale Bildungstheorien definieren Bildung inhaltlich, d.h. sie ist an den Besitz ganz bestimmter Wissensgüter gekoppelt (vgl. Blankertz 1986: 37). Jemand der für sich beansprucht, Allgemeinbildung zu besitzen, muss dafür eine mehr oder weniger vollständige ‚enzyklopädische’ Liste von Bildungsgütern beherrschen (vgl. Jank, Meyer 2002: 212). Formale Bildungstheorien definieren dagegen Bildung vom Subjekt und von der Entwicklung und Förderung seiner Möglichkeiten her (vgl. Blankertz 1986: 39). Sie beschreiben einen Satz von Methoden und Kompetenzen, die notwendig sind, um handlungs- und entwicklungsfähig zu werden und zu bleiben (vgl. Jank, Meyer: 2002: 213). Inhalte haben dabei nur sekundären Charakter. Ihre Bedeutung liegt in dem Potential, welches sie besitzen, um die geforderte Entfaltung der individuellen Kräfte zu leisten (vgl. Blankertz 1986: 39).
Einseitige Definitionen von Bildung in Richtung der einen oder der anderen Variante – material oder formal - sind aber immer auch problematisch, und keine der beiden Richtungen alleine kann eine umfassende Bildung des einzelnen ermöglichen (vgl. Jank, Meyer 2002: 213). Die materialen Bildungstheorien haben dabei vor allem das Problem der Auswahl der Inhalte aus einem nahezu unerschöpflichen kulturellen Fundus und damit der inhaltlichen Überladung (vgl. Blankertz 1986: 37). Wird Bildung zudem allein über klassische Bildungsinhalte definiert, besteht die Gefahr, diese hinsichtlich ihrer Bildungskraft spekulativ zu überschätzen und aktuelle politisch-gesellschaftliche Bedingungen wie Ökonomie, Technik, Beruf oder Politik auszublenden (vgl. Manstetten 1983: 84). Zudem lässt sich in einer pluralistischen Gesellschaft mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen ein für alle gleichermaßen verbindlicher inhaltlicher Kanon nur noch schwer glaubhaft machen (vgl. Blankertz 1986: 180). Die formalen Bildungstheorien müssen sich vorwerfen lassen, zum einen nicht empirisch beweisen zu können, dass Fähigkeiten und Kräfte, die an einem Bildungsgut gewonnen worden sind, auch auf ein anderes übertragbar sind (vgl. Blankertz 1986: 40). Zum anderen werden Bildungsinhalte ausschließlich nach der Maßgabe ihres formalen Bildungswertes ausgewählt, und die Auswahl- kriterien dabei spekulativ und eigenmächtig unterstellt (vgl. Manstetten 1983: 84), was zu Beliebigkeiten und Zufälligkeiten in der Inhaltsauswahl führen kann.[8]
2.1.3 Kategoriale Bildung und Exemplarik
Wolfgang Klafki, der seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der bedeutendste und prominentesten Vertreter einer bildungstheoretisch fundierten Didaktik ist[9], hat mit seinem Neuansatz der ‚kategorialen Bildung’ und der Rezeption der Idee des exemplarischen Lernens versucht, die Dichotomisierung und Ideologisierung beider Aspekte – materiale und formale Bildung - zu überwinden (vgl. Kron 2004: 75). Für ihn besteht zwischen den beiden ein Verweisungszusammenhang, und Bildung ist damit immer ganzheitlich zu begreifen (vgl. ebd.: 76). D.h. die formalen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kräfte etc. werden immer an bestimmten materialen Inhalten gewonnen. Das Problem der zunehmenden Stofffülle in materialen Bildungstheorien und den damit verbundenen Nachteilen, wie die lediglich reproduktive Übernahme vieler Einzelkenntnisse, -fähigkeiten und -fertigkeiten, soll so überwunden werden, und der Lernende soll sich an einer begrenzten Anzahl ausgewählter Beispiele mehr oder minder verallgemeinerbare Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen erarbeiten (vgl. Klafki 1996: 143-144). Genauso ist damit aber auch der Kritik an einer ausufernden formalen Bildung begegnet, die im Extremfall zu einer reinen Kräfte-, Fertigkeits- und Lernschulung entarten würde (vgl. Kron 2004: 76).
Mit dieser integrativen Vorstellung von Bildung gilt es nun, Bildungsgüter zu finden, die exemplarisch für ein Allgemeines stehen (vgl. Kron 2004: 76-77). Für Klafkis früheren Entwurf einer bildungstheoretischen Didaktik[10] bedeutete dies, dass es die Aufgabe des Lehrers sei, den Bildungs gehalt bzw. Bildungswert aus den vorgegebenen Lehrplan inhalten freizulegen (vgl. Jank, Meyer 2002: 217). Der Bildungsgehalt ist dabei substantiell mehr und weist über den speziellen Inhalt hinaus. Der verwendete Bildungsbegriff konstituiert dabei die Differenz zwischen Inhalt und Gehalt, also das, was dieses Mehr sein soll (vgl. Langewand 1997: 74-75).[11]
2.1.4 Bildung vs. Ausbildung
Der semantische und ideologische Hintergrund, der sich mit dem Wort Bildung im deutschen Kulturraum verbindet, und die intensive Diskussion um deren Gehalt und Bedeutung, geht geschichtlich auf die Zeit der Deutschen Klassik zurück. In dieser Zeit, zwischen 1770 und 1830, wurde der Bildungsbegriff erstmalig zu einem Zentralbegriff pädagogischer Reflexion (vgl. Klafki 1996: 15). Zur Zeit der Aufklärungspädagogik, also bis etwa 1770, wurde der Maßstab menschlicher Bestimmung vorwiegend in der Gemeinnützigkeit gesehen. Erziehung wurde daher utilitaristisch interpretiert, d.h. der Mensch wurde so erzogen, dass er an dem ihm zugewiesenen gesellschaftlichen Ort funktionierte und seine Aufgabe in Stand und Beruf erfüllen konnte. Im Interesse der Gesellschaft wurden dabei häufig eher Gehorsam, mechanische Fertigkeit und Alltagszufriedenheit gefordert als Vernunft, Einsicht und verunsicherndes Wissen. (vgl. Blankertz 1982: 21-82) In der Zeit der Deutschen Klassik wurde dieses Sichtweise auf Erziehung in Frage gestellt bzw. ganz abgelehnt. Vielmehr galt es nun, einen Bildungssinn jenseits aller Nützlichkeit zu definieren und „die freie Bildung von sich selbst genügenden Individualitäten wurde möglich“ (Blankertz 1982: 93). Die Frage nach der Bestimmung des Menschen wurde nun mit dem Ideal der Bildung beantwortet (vgl. ebd.).
Eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des so genannten Neu-Humanismus und damit auch für die Entwicklung des weiteren deutschen Schulwesens spielte Wilhelm von Humboldt. Er definierte Bildung als Weg der Individualität zu sich selber und sah diese als Parteinahme für das Individuum gegen dessen gesellschaftliche Vereinnahmung an. (vgl. Blankertz 1982: 89-135) Das Besondere für die Geschichte der Berufsbildung dabei ist, dass hiermit zwischen Bildung und bloßer Ausbildung ein Trennungsstrich gezogen wurde (vgl. Ingwersen 2003: 23). Bildung wurde nun vom Subjekt her bestimmt und von dessen individuellen Möglichkeiten, womit es sich verbot, diese grundlegende Vernunfts- und Humanitätsbildung an die materiellen Bedingungen der arbeitsteiligen Gesellschaft zu binden (vgl. Blankertz 1982: 100). Sie hatte einerseits den zentralen Auftrag, die Entfaltung aller Kräfte der Persönlichkeit (und nicht nur z.B. speziell handwerklicher) zu fördern, und andererseits den Menschen zur Selbstbestimmung zu befähigen (vgl. Ingwersen 2003: 22).[12] Als Bildungsgüter, die in der Lage sind eine so verstandene Geistesbildung zu bewirken, wurden primär die als klassisch definierten Werke der griechischen Antike verstanden, da in ihnen das angestrebte vollendete Menschentum als vergegenwärtigt gesehen wurde[13] (vgl. Blankertz 1982: 90). Berufliche Bildung und Ausbildung wurden dagegen verstanden als „System der notwendigen Anpassungen in wirtschaftliche und gesellschaftliche Anforderungen“ (Becker, zit. n. Ingwersen 2003: 23).
Da Humboldt 1809 zum Direktor der Sektion des Kultus und Unterrichts im Preußischen Innenministerium berufen und zum maßgeblichen Initiator der preußischen Bildungsreform wurde, nahm die Trennung zwischen Bildung und Ausbildung auch institutionell Einzug in das deutsche Schulsystem. Ein Grundsatz dieser Reform war es nämlich, dass die allgemeine Menschenbildung Vorrang vor aller speziellen Berufsbildung zu haben hatte, und letztere erst nach der ersten erfolgen konnte und sollte. Der beruflichen Ausbildung wurde die Möglichkeit der Persönlichkeitsbildung abgesprochen und diese so pädagogisch disqualifiziert, da sie lediglich Kunstgriffe und Fertigkeiten vermittele, die sich in Training und Abrichtung erschöpften. (vgl. Blankertz 1982: 120)
Ursprünglich war Humboldts Bildungsbegriff ein potentiell gesellschafts-kritischer (vgl. Klafki 1996: 45), denn ein Grundsatz lautete, allen Bildungs-einrichtungen den Kampf gegen die Untertanenmentalität aufzugeben. Allerdings vertraute er dabei allein auf die Kraft der individuellen Bildung, die den Menschen auch zur politischen Selbstbestimmung ermächtigen werde. Letztendlich trug die neuhumanistische Trennung der Bildung von der gesellschaftlichen Wirklichkeit aber zu einer unpolitischen, privaten und auf die Innerlichkeit des Menschen zurückbezogenen Bewusstseinposition bei. (vgl. Blankertz 1982: 121, 94) In Folge des Berechtigungswesens[14] des 19. Jahrhunderts wurde diese Entwicklung noch verschärft. So wurde zwar der adelige Geburtsschein durch den Leistungsnachweis ersetzt und der Adel so in das bürgerlich Examen gezwungen. Mit dem Beamtenstaat entstand aber auch ein neuer Standestypus, welcher sein Selbstbewusstsein nicht durch Besitz, sondern durch einen bestimmten Grad von ‚Allgemeinbildung’ bezog (vgl. ebd.: 155-161), was u.a. zur Folge hatte, dass der eher progressive Bildungsbegriff einer ‚Verfallsgeschichte’ ausgesetzt wurde (vgl. Klafki 1996: 46). Wurde Bildung von Humboldt noch als Bildung für alle definiert, galt diese fortan als Statussymbol, welches den gesellschaftlichen Ort des Trägers bestimmte (vgl. Blankertz 1982: 121, 157). Bildung wurde damit zum „Privileg der wohlhabenden, sich dem restaurierenden Obrigkeitsstaat anpassenden oder durch ihn profitierenden Gesellschaftsschichten“ (Klafki 1996: 47). Das reformerische Element des Klassischen Bildungsideals, d.h. der Kampf gegen die Untertanenmentalität und die Idee einer politisch-sozialen Umgestaltung, wurde zu Gunsten einer den bestehenden Staat stabilisierenden Idee von Bildung als statutsträchtigen Besitz bestimmter klassischer Bildungsinhalte aufgegeben (vgl. Blankertz 1982: 156-157). Für die Arbeiterschaft bedeutete dies, dass ihre Möglichkeiten eines Bildungsaufstieges umso mehr behindert wurden, da dieser an die Abschlüsse der höheren Allgemeinbildung gebunden war und berufliche Leistungsnachweise keine oder nur geringe Bedeutung hatten (vgl. ebd.: 184).
Die Geschichte des Bildungsbegriffes im 19. Jahrhundert war also gekennzeichnet durch eine strikte Trennung von Bildung und Ausbildung sowie dem Verfall von einem potentiell kritischen Bildungsbegriff hin zu einem, der den Staat in seiner gesellschaftlichen Hierarchie stabilisierte und Bildung als statusträchtigen Besitz ansah. Im 20. Jahrhundert wurde versucht, diese Entwicklungen zu revidieren (vgl. Ingwersen 2003: 24).
1900 war es Georg Kerschensteiner, der mit seiner Theorie von der Berufserziehung als ‚Pforte zur Menschenbildung’ die ‚Geburtsurkunde der Berufsschule’[15] schrieb (vgl. Blankertz 1982: 207-209). Neben Kerschensteiner, Eduard Spranger, Aloys Fischer und Theodor Litt (vgl. ebd.) versuchte vor allem auch Herwig Blankertz, allgemeine und berufliche Bildung zu integrieren und den ursprünglichen emanzipatorischen Gehalt des neuhumanistischen Bildungsbegriffes für die Berufsbildung fruchtbar zu machen (vgl. Ingwersen 2003: 25) sowie Bildung nicht lediglich über den Besitz von Bildungsgütern zu definieren: „Die Wahrheit der Allgemeinbildung ist somit die spezielle oder berufliche Bildung; oder anders gesagt: Allgemeinbildung als pädagogische Qualität muß verstanden werden als Anspruch und Regulativ, aber nicht als Inhalt“ (Blankertz 1982: 141). Damit holte Blankertz die Berufsbildung aus ihrer untergeordneten Position heraus und machte den Bildungsbegriff wieder für die Berufsbildung anschließbar (vgl. Ingwersen 2003: 25). Ein maßgeblicher Aspekt dieser Aufgabe ist u.a. die Absage an klassische Bildungskanons und die Anerkennung auch von spezialisierten Kenntnissen als potentiell bildungsbedeutsam (vgl. Blankertz 1986: 202-203). Mittlerweile scheint es unstrittig, dass auch spezielle berufsbildende Inhalte allgemein bildende, also auf die Persönlichkeitsentwicklung abzielende Potentiale besitzen, und dass eine ideologische Trennung in Allgemeinbildung und Ausbildung bzw. Berufsbildung veraltet ist (vgl. z.B. Deutscher Bildungsrat 1974: 54).
2.1.5 Die kritische Dimension von Bildung im 20. Jahrhundert
Eine weitere Unterscheidung hinsichtlich differierender Bildungsideale lässt sich zwischen gesellschaftlich-politisch affirmativen und gesellschaftskritischen Bildungstheorien treffen.
Ist im Laufe des 19. Jahrhunderts der kritische Aspekt des neuhumanistischen Bildungsbegriffes verloren gegangen und dieser zu einem wertkonservativem und gesellschaftsstabilisierenden Begriff geworden (vgl. Klafki 1996: 46-48), so wurde im 20. Jahrhundert versucht, Bildung wieder als kritisches Regulativ gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen zu definieren.
Adorno (1975: 70-71) z.B. kritisiert, dass eine Bildung, die auf die Selbstbestimmung und geistige Freiheit von Individuen abzielt, gewonnen an den Objektivierungen geistiger Kultur, verfehlt sei, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse diese Freiheit und Individualität nicht einlösen können. Wird von der Bildung erwartet, sie könne von sich aus den Menschen geben, was die Gesellschaft ihnen versage, so wird sie zu einer bloßen Apologie dieser Gesellschaft. Adorno kritisiert dabei insbesondere auch rein materiale Bildungsvorstellungen, wenn er diese als ‚Halbbildung’ bezeichnet, die vom ‚Fetischcharakter der Ware’ ergriffen ist (vgl. ebd. 81) und allein ihr Tauschwert[16] zählt. Ebenso ist Horkheimer (1985: 418) der Auffassung, dass Bildung als entfaltetes Denken und Gewissen auch auf die Einrichtung einer besseren Welt abzielen muss. Dieses Bildungsverständnis speist sich aus der Sicht, die Adorno und Horkheimer zusammen mit anderen Vertretern der ‚kritischen Theorie’ auf die Gesellschaft haben. Sie kritisieren vor allem eine Auffassung, die die Organisation und den Zustand der Gesellschaft als naturwüchsig und unabänderlich sieht und nicht darüber reflektiert, dass diese gesellschaftlichen Zustände und Tatsachen von ihr selber immer wieder reproduziert werden (vgl. Horkheimer, Adorno 2001). Die kritische Sozialwissenschaft macht es sich deshalb zur Aufgabe, aufzuzeigen „wann die theoretischen Aussagen invariante Gesetzmäßigkeiten des sozialen Handelns überhaupt und wann sie ideologisch festgefrorene, im Prinzip aber veränderliche Abhängigkeitsverhältnisse erfassen“ (Habermas 1968: 158). Deshalb setzt eine kritische „Theorie der Bildung .. unumgänglich voraus, daß das Aufwachsen unserer Kinder nicht nur ein Prozeß nötigender Anpassung, sondern auch möglicher Distanzierung ist“ (Blankertz 1979: 44).
Wolfgang Klafkis erster Entwurf einer bildungstheoretischen Didaktik aus den 1960er-Jahren ist noch geprägt von einem konservativen Bildungsverständnis, welches die materialen Entscheidungen über die Unterrichtsthemen den Vorgaben des jeweils gültigen Lehrplanes überließ (vgl. Jank, Meyer 2002: 218). Dieser konservative Zug wurde in Folge der Studentenbewegung der Achtundsechziger, die sich auch auf die kritische Theorie von Horkheimer und Adorno berief, scharf kritisiert (vgl. ebd.: 228). Der verwendete Bildungsbegriff mit den Kriterien Weltbewältigung und Personwerdung[17] (vgl. Blankertz 1986: 45), wurde als zu starke Orientierung am (wertkonservativen) Bürgertum bzw. an der Mittelschicht sowie deren Ideologie gesehen und als politisch affirmativ bewertet (vgl. Jank, Meyer 2002: 218).
Klafki beginnt auf Grund dessen, ab Anfang der 1970er Jahre, seine klassische bildungstheoretische Didaktik in eine kritisch-konstruktive Position zu transformieren (vgl. Kron 2004: 84). Wagte er sich in seinem früheren Entwurf noch nicht daran, aus eigener (pädagogischer) Kraft konkrete Bildungsziele zu nennen und zu beschreiben, wozu Bildung dem Einzelnen verhelfen und der Gesellschaft nützlich sein soll (vgl. Jank, Meyer 2002: 219), so nennt er jetzt drei übergeordnete Bildungsziele: Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität (vgl. Klafki 1996: 40). Bildung als Befähigung zur vernünftigen Selbstbestimmung assoziiert er nun mit Elementen wie Freiheit, Emanzipation, Autonomie, Mündigkeit, Vernunft und Selbsttätigkeit[18] (vgl. Kron 2004: 85). Kritisch heißt seine Didaktik deshalb, weil er davon ausgeht, dass die Wirklichkeit der Bildungsinstitutionen dieser Zielsetzung widerspricht und starke gesellschaftlich-politische Widerstände und Gegenströmungen den erforderlichen Veränderungsbestrebungen entgegenstehen (vgl. Klafki 1996: 89-90). Der Baustein ‚konstruktiv’ verweist auf den Praxisbezug, d.h. das Handlungs-, Gestaltungs- und Veränderungsinteresse, welches für seine neue didaktische Konzeption konstituiv ist (vgl. ebd.: 90). Klafki fasst damit Bildungsfragen explizit als Gesellschaftsfragen auf und ist der Auffassung, dass der Bildungstheorie und –praxis die Möglichkeit und Aufgabe zugesprochen werden, auf gesellschaftliche Verhältnisse nicht nur zu reagieren, sondern diese zu beurteilen und mitzugestalten (vgl ebd.: 50). Inhaltlich orientiert er sich damit nicht mehr allein an den klassischen Lehrplaninhalten, sondern setzt gesellschaftliche Schlüsselprobleme als Zentren eines neuen Allgemeinbildungskonzeptes (vgl. ebd.: 61). Als Beispiele für solche ‚epochaltypischen’[19] Schlüsselprobleme nennt er die Friedensfrage, die Umweltfrage, die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit, die Gefahren und Möglichkeiten neuer Technologien und die Ich-Du-Beziehung (vgl. ebd.: 56-60). Die Bearbeitung dieser Schlüsselprobleme stellt an die Lernenden die Anforderung, problemsichtig zu werden und ein differenziertes Problembewusstsein zu gewinnen (vgl. ebd.: 62). Zudem sollen an den Schlüsselproblemen Einstellungen und Fähigkeiten angeeignet werden, die über den Bereich des jeweiligen Schlüsselproblems hinausreichen, wie z.B. Kritikbereitschaft und -fähigkeit, Argumentationsbereitschaft und -fähigkeit, Empathie, Zusammenhangsdenken und vernetztes Denken (vgl. ebd.: 63). Klafki bezieht ebenso die Berufsbildung in sein Konzept von Allgemeinbildung mit ein, wenn er die in der Schule vermittelte berufliche Grundbildung verknüpfen will mit der „Aufklärung der ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beruflicher Tätigkeiten, der Bedeutung des Berufs für die Ausbildung der personalen Identität und der Beziehungen zwischen beruflicher Arbeit und Freizeit“ (ebd.: 72).
Klafki ist nur einer aus einer Reihe von Erziehungswissenschaftlern, die versucht haben, mittels der kritischen Theorie einen gesellschaftskritischen Bildungsbegriff und eine gesellschaftskritische Pädagogik zu begründen.[20] Weitere bekannte Namen lauten Heinz-Joachim Heydorn, Herwig Blankertz oder Klaus Mollenhauer (vgl. Klafki 1996: 48). Die Orientierung der Pädagogik am Paradigma der kritischen Theorie und derem obersten Sinnkriterium der Emanzipation hat allerdings auch Kritik hervorgerufen. Gerade der Begriff ‚Emanzipation’ wird als pseudonormative Leerformel kritisiert, die keine Verhaltensvorschriften enthält und darüber hinaus die Frage nach dem absolut Guten oder Bösen offen lässt. Es sei ein Schlagwort, auf das sich jeder ohne jede weitere Verpflichtung berufen könne. (vgl. Jongebloed, Twardy 1983: 56) Blankertz hält dieser Kritik entgegen, dass Begriffe wie ‚Emanzipation’ oder ‚Mündigkeit’ nicht operationalisierbar seien im Sinne einer „kleinkarierten Unterrichtstechnologie und Verhaltensteuerung“, und dass der emanzipatorische Charakter der Erziehung zudem ergebnisoffen sei, denn die nachfolgende Generation müsse, sollte sie die Bewahrung des vorgegebenen wünschen, dieses Tradierte in eigener Verantwortung interpretieren und verteidigen (vgl. Blankertz 1979: 40).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Trennung von Bildungsmaßnahmen in solche, die lediglich beabsichtigen, den Menschen unter Umgehung des Bewusstseins in den gesellschaftlichen Zusammenhang zu integrieren (vgl. Blankertz 1979: 44), und solche, die ihn zu einem diesen Zusammenhang durchschauenden und sich bewusst für oder gegen diesen Zusammenhang entscheidenden Menschen machen wollen, nach wie vor eine bedeutende Reflexionsaufgabe der Pädagogik ist. Denn nicht „hinnehmbar .. ist: wenn Bildung das eine beansprucht (die Werte, die Kultur, die Verantwortung, die Führung) und das andere betreibt (die Bedienung der Wirtschaft, die Regelung des Arbeitsmarktes, das Fitmachen für die Laufbahn, die Aufbewahrung der Kinder und die Disziplinierung der Jugendlichen).“
(v. Hentig 1999: 57)
2.1.6 Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen
Insbesondere in der Berufspädagogik wurde der Bildungsbegriff nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Qualifikationsbegriff abgelöst (vgl. Ertl-Schmuck 2000: 74). Damit einhergehend wurden alternative Konzepte entwickelt, die das, was der Bildungsbegriff bisher beinhaltete - die Orientierung am Menschen und der Entwicklung einer selbstbestimmten Persönlichkeit –, transportieren bzw. operationalisieren sollen.
1974 legt der Deutsche Bildungsrat in seinen Empfehlungen zur Neuordnung der Sekundarstufe II ein Konzept vor, welches die Begriffe ‚Qualifikationen’ und ‚Kompetenzen’ unterscheidet. Qualifikationen meinen dabei den Aspekt der Verwertbarkeit von Lernerfolgen im Hinblick auf die beruflichen, privaten und gesellschaftlichen Anforderungen. Diese werden von der gesamtgesellschaftlichen Seite vorgegeben und nachgefragt. Kompetenzen dagegen bezeichnen den Lernerfolg im Hinblick auf den Lernenden selbst und seine Befähigung zu selbstverantwortlichem Handeln im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Bereich. (vgl. Deutscher Bildungsrat 1974: 65) Sie beschreiben damit u.a. das, was über das spezielle Ausbildungsinteresse – d.h. die zu erfüllenden Qualifikationen – hinaus die menschliche Entwicklung der Jugendlichen sichert. Während dabei der Terminus ‚Fachkompetenz’ noch als Antwort auf die geforderten und angestrebten Qualifikationen gesehen wird, also das Leistungsangebot eines Menschen, mit dem er die geforderten Qualifikationen erfüllen kann[21], geht der Terminus ‚humane Kompetenz’ darüber hinaus. Humane Kompetenz wird dabei verstanden als die Fähigkeit, sich seiner selbst als eines verantwortlich Handelnden bewusst zu sein sowie seinen Lebensplan im mitmenschlichen Zusammenleben selbständig fassen und seinen Ort in Familie, Gesellschaft uns Staat richtig finden und bestimmen zu können. Der junge Mensch soll im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich eine reflektierte Handlungsfähigkeit erreichen. (vgl. ebd.: 49-50)
Der Deutsche Bildungsrat wollte mit diesem Entwurf die traditionelle Trennung von ‚Allgemeinbildung’ und ‚Berufsbildung’ überwinden und dagegen in einem integrativen Konzept beide Aspekte verbinden. Lernprozesse sollen bewusst der Vermittlung von Kenntnissen und der Beherrschung von Funktionen dienen zugleich aber auch der menschlichen Bildung im ganzen. Dies soll über die Rückbindung[22] einer auf Fachkompetenz zielenden Ausbildungsmaßnahme an eine humane und politische Bildung geschehen. „Bloße Anpassung und die das Bewusstsein des Lernenden umgehende Beeinflussung sollten auf diese Weise ausgeschlossen bleiben“ (Deutscher Bildungsrat 1974: 55).
Ebenfalls 1974 geht ein weiterer Begriff in die Berufsbildungspraxis und -theorie ein, der verbindend zwischen den eben genannten Konzepten Qualifikation und Kompetenz steht: die Schlüsselqualifikationen. Er wurde von Dieter Mertens (1974) geprägt und wird von ihm definiert als „solche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und begrenzten Bezug zu bestimmten, disparaten praktischen Tätigkeiten erbringen, sondern vielmehr (a) die Eignung für eine große Zahl von Positionen und Funktionen als alternative Optionen zum gleichen Zeitpunkt, und (b) die Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) Änderungen und Anforderungen im Laufe des Lebens.“
(Mertens 1974: 40)
Das Konzept der Schlüsselqualifikationen ist eine Reaktion auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt, die durch einen hohen technischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand, durch Dynamik, Rationalität, Flexibilität und Kreativität gekennzeichnet ist (vgl. ebd.). Nach Schelten (1991) stehen sie als berufsfeldübergreifende Qualifikationen hoher Reichweite über den berufsfeldweiten (mittlere Reichweite) und den fachspezifisch monoberuflichen Qualifikationen (geringe Reichweite) und werden auch als außerfachliche bzw. extrafunktionale Qualifikationen bezeichnet. So zählen z.B. selbständige Denk- und Lernfähigkeit, allgemeine berufsmotorische Befähigung sowie gruppenorientiertes Verhalten wie etwa Kooperationsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit zu den Schlüsselqualifikationen. Diesen überberuflichen Qualifikationen, die im Gegensatz zu spezialisierten Kenntnissen nicht veralten, sollen als dauerhaft verwendbarer Grundstock die berufliche Existenz in einem sich rasch wandelnden System sichern. Sie sollen aber nicht nur dazu dienen Arbeitsplätze schneller wechseln und sich auf neue Situationen einrichten zu können. Ebenso erfordern die komplexeren und mehr ganzheitlichen Arbeitstätigkeiten selber die besagten Schlüsselqualifikationen. (vgl. Schelten 1991: 145-160)
Ist das Konzept des Deutschen Bildungsrates eindeutig bildungstheoretisch motiviert (vgl. Lisop 1999), stellt dagegen das Konzept der Schlüsselqualifikationen aus bildungstheoretischer Perspektive ein Problem dar. So sind in ihm zwar humane Befähigungen wie z.B. Selbständigkeit und Teamfähigkeit enthalten, die dem Menschen selbst dienen und damit alte pädagogische Ziele darstellen. Auf der anderen Seite werden diese aber aus ökonomischen Anforderungen abgeleitet und für berufliche Zwecke nutzbar gemacht. (vgl. Schelten 2000: 140; Ertl-Schmuck 2000: 79) Das Konzept stellt damit sowohl eine Chance als auch eine Gefahr für ein umfassendes Bildungskonzept dar. Die Chance besteht darin, dass die von der wirtschaftlichen Seite geforderten Qualifikationen eine Bildung benötigen, die Selbstbestimmung und selbständige Denkfähigkeit – und damit auch allgemeine Kritik- und Mitbestimmungsfähigkeit - der Arbeitskräfte fördert. Die Gefahr besteht in einer einseitigen Interpretation im Hinblick auf eine verbesserte berufliche Tätigkeit und dem Abschöpfen von Subjektqualitäten, wobei die Reichweite der Schlüsselqualifikationen letztendlich doch an der Grenze der Betriebsinteressen endet. (vgl. Ertl-Schmuck 2000: 81-82)
Man könnte annehmen, dass das Konzept der Schlüsselqualifikationen eine rein formale Bildungstheorie ist, da es primär auf die Entwicklung von lebenslang verfügbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten abzielt. Schelten (2000) gibt aber zu bedenken, dass auch diese nicht abstrakt sondern nur anhand konkreter fachspezifischer Inhalte vermittelt werden können. Daraus entsteht aber auch ein Dilemma: um die Transferwirkung zu sichern, müssen sie eher bereichsspezifisch bleiben, womit ihre hohe Reichweite verloren ginge. Werden sie allerdings zu allgemein und unspezifisch definiert, dann kann ein unmittelbarer Transfer nicht gesichert werden. Damit ist wieder auf die eher berufsspezifischen Inhalte und Kenntnisse verwiesen – die Qualifikationen geringer und mittlerer Reichweite. (vgl. ebd.: 139) Mit einer Konzentration auf diese transferfähigen Qualifikationen rückt dann allerdings wieder die Idee von allgemeiner Persönlichkeitsentwicklung in den Hintergrund.
Ein weiteres Problem der Schlüsselqualifikationen ist der große Interpretationsspielraum, der mit der Rezeption der vorliegenden Konzepte einhergeht. Dieser entsteht durch eine häufig fehlende Theoriestütze, wodurch reine Aufzählungen mit dem Charakter der Beliebigkeit entstehen. Zudem lässt eine abstrakte Formulierung der Schlüsselqualifikationen unterschiedliche inhaltliche Deutungen zu. Damit lassen sich dann verschiedenste Wünsche, Ansprüche und Menschenbilder legitimieren.[23] (vgl. Müller-Seng, Weiß 2001: 162; Czycholl 2001: 179) Werden die Schlüsselqualifikationen dann auch noch stark in Richtung traditioneller Arbeitstugenden ausgelegt wie z.B.: Fähigkeit zur Ausdauer (vgl. Müller-Seng, Weiß 2001: 165), bleibt von einer auf Mündigkeit zielenden Persönlichkeitsentwicklung nicht mehr viel übrig.
2.1.7 Konstruktivismus
Eine nahezu radikale Subjektorientierung erhält der Bildungsgedanke neuerdings mit dem Theoriegebäude des Konstruktivismus.[24] Dieser steht in einer Denktradition, die behauptet, dass der Mensch sich nicht eine objektiv und unabhängig von ihm existierende Welt erschließt, sondern dass er sich diese Welt und ihre Wirklichkeit auf der Grundlage seiner ihm gegebenen Erkenntnismöglichkeiten selbst konstruiert.
Basis konstruktivistischer Argumentationen ist die neurobiologische Erkenntnis, dass das Gehirn auf der Grundlage seiner ihm gegebenen Struktur und den eigenen neuronalen Aktivitäten unspezifische äußere Sinnesreize verarbeitet, interpretiert und sich daraus seine Welt ‚konstruiert’ (vgl. Jank, Meyer 2002: 288).
Das heißt nicht die äußere Welt bestimmt über die Struktur und den Zustand der wahrgenommenen Welt, sondern die dem Lebewesen eigenen Strukturen, die sich biologisch und biographisch entwickelt haben (Strukturdeterminiertheit) (vgl. ebd.: 290). Informationell ist damit jedes Lebewesen geschlossen. Neuronale Signale werden nach eigenentwickelten Kriterien gedeutet und bewertet, womit die Realität ‚an sich’ unerreichbar ist und alles, was wir von ihr wissen, von uns selber erzeugt ist (vgl. ebd.; Terhart 1999a: 632). Damit sind Lebewesen autonome bzw. autopoietische Systeme, d.h. Informationen werden nur von ihnen selbst erzeugt mit Rückgriff auf biologische und informatische Ressourcen sowie die Reize der Sinneskanäle (vgl. Backes-Haase 2001: 222). Lebende Systeme organisieren sich somit selbst, d.h. sie sind ‚selbstreferentiell’ und immer bezogen auf eigene Zustände (vgl. Jank, Meyer 2002: 290). Das konstruierte Wissen über die Welt folgt immer dem Prinzip der Funktionalität und Viabilität[25] für das eigene Überleben. Wissen ist dann viabel, wenn es nicht in Widerspruch zur eigenen Weltwahrnehmung gerät, sondern wenn es anschlussfähig ist an die vorhandenen Wirklichkeitskonstruktion (vgl. ebd.: 291). Wissen und Erkenntnisse sind dabei immer an die handelnde Auseinandersetzung mit der uns umgebenden Welt geknüpft (vgl. ebd. 290). So können im Handeln unsere Wirklichkeitskonstruktionen gestützt werden und sich als viabel erweisen. Oder aber sie funktionieren nicht, sind nicht viabel. Dann wird eine Neuorganisation unserer Konstruktionen notwendig (d.h.: Lernen). Umstände, die diese Zustands-veränderungen in der kognitiven Struktur eines lebenden Systems hervorrufen, heißen Pertubationen[26]. Dabei bestimmt aber immer die interne Struktur des Organismus, wie auf diese Pertubation reagiert wird (vgl. Blumstengel 1998). Möglich werden Pertubationen, da die lebenden Systeme zwar autonom agieren, aber strukturell an ihre Umwelt gekoppelt sind, d.h. sie können untereinander kommunizieren und kooperieren (z.B. über die Sprache). Lernen lässt sich damit als Pertubation eines Organismus durch einen anderen Organismus interpretieren. (vgl. Siebert 2000: 31)
Diese auf der paradigmatischen Ebene angesiedelten erkenntnistheoretischen Annahmen haben nun Eingang gefunden in unterschiedliche pädagogische Ansätze. Konstruktivistische Argumente werden dabei vor allem als Neuansatz gegenüber traditionellen didaktischen Überzeugungen[27] propagiert. So wird der traditionelle erkenntnistheoretische Realismus mit der Aussage ‚Wir erkennen die Welt wie sie wirklich ist’ abgelehnt, da dies zu einer ‚Abbilddidaktik’ führt, welche versucht ist, diese objektive - und damit als einzig wahre postulierte - Realität in den kognitiven Strukturen der Lernenden abzubilden (vgl. Siebert 1996: 16). Vor allem die passive Rolle der Lernenden bei diesem Input-Output-Verständnis der Wissensvermittlung wird kritisiert. Wissensaneignung sei vielmehr ein aktiver und selbstgesteuerter Prozess. Damit soll auch dem pädagogischen Machbarkeitsdenken Einhalt geboten werden. Lernen wird eher als Angebot gesehen, bei dem sich Wirkungen nicht erzwingen lassen. (vgl. Diesbergen 1998: 70-75) Zwei weitere Probleme der traditionellen Instruktionsansätze werden in der Produktion ‚trägen Wissens’ und einem ‚mangelnden Transfer’ gesehen. Träges Wissen ist solches, welches zwar prinzipiell vorhanden, aber im konkreten Fall nicht abruf- und anwendbar ist. Erzeugt wird es dadurch, dass eine große Menge Wissen vermittelt wird, aber der tatsächliche Nutzen und die persönliche Relevanz dabei unberücksichtigt bleiben. Mit mangelndem Transfer ist gemeint, dass im Unterricht erworbenes Wissen nicht auf andere (reale) Kontexte übertragen werden kann. (vgl. Blumstengel 1998)
Die sich aus dieser Kritik ergebenden pädagogisch-didaktischen Implikationen lassen sich wie folgt zusammenfassen (nach Siebert 1996: 19-20):
- Der Konstruktivismus bestätigt die Subjektorientierung der Bildungsarbeit, bei der die Lernenden als eigensinnig und eigenwillig anerkannt werden und sich nicht lediglich belehren oder aufklären lassen.
- Erfahrung und Wissen bauen auf früheren Erfahrungen und vorhandenem Vorwissen auf. Gelernt wird, was als relevant, bedeutsam und integrierbar erlebt wird.
- Lehre determiniert und instruiert nicht. Der Lernende geht auf seine eigene Weise mit dem Stoff um.
- Lehrende vermitteln keine Wahrheiten, sondern ihre Konstrukte und Ansichten. Die Bedeutsamkeit und Viabilität einer Information kann dabei nicht vorgeschrieben werden.
- Lernen wird über Pertubationen initiiert, durch die die Viabilität von Konstrukten in Frage gestellt wird.
Dieser Aufzählung kann noch hinzugefügt werden, dass Lehr-/Lernprozesse über die Verknüpfung von Handlung, Erfahrung und Erkenntnis zu individuellen Wirklichkeitskonstruktionen führen, und der Wissenserwerb abhängig ist von seiner kontextuellen Einbettung (Situiertheit). Lernen ist damit ein aktiver, selbstgesteuerter, situativer und sozialer Prozess. (vgl. Keuchel 2001: 168-169)
Überträgt man den Konstruktivismus radikal auf die Schularbeit, wäre Lehre nicht mehr möglich und sogar ethisch illegitim, da die individuellen Konstrukte von außen nicht determiniert werden können, und ein Versuch, diese zu beeinflussen, unmoralisch wäre (vgl. Jank, Meyer 2002: 300). In der Pädagogik wurde daher der Konstruktivismus in seiner Radikalität gemildert, um eine Aktivität wie Unterrichten überhaupt zu legitimieren (vgl. Terhart 1999a: 638). Ernst von Glaserfeld hat dies mit der Möglichkeit der intersubjektiven Verständigung begründet (vgl. Jank, Meyer 2002: 300). Trotzdem bleiben konstruktivistische Positionen paradigmatisch an ihren radikalen Ursprung gebunden, und bestimmte Elemente bleiben doppelgesichtig, da sie sowohl eher pädagogisch-normativ als auch normfrei-funktionell interpretiert werden können. Wie dies zu verstehen ist, soll mit einem Blick auf kritische Stimmen bezüglich konstruktivistischer Positionen erläutert werden.
Bildungstheoretisch bedeutsam ist, dass konstruktivistische Bildungstheorien rein formale Bildungstheorien darstellen. Die materialen Entscheidungen über Ziele und Inhalte sollen dem Aushandeln der Beteiligten überantwortet werden. Mit dieser Aufgabe des Sachanspruches besteht aber die Gefahr der Beliebigkeit. (vgl. Jank, Meyer 2002: 301; Terhart 1999a: 642) Zudem vertritt der Konstruktivismus mit dem Konzept der Viabilität einen radikal utilitaristischen Bildungsbegriff: „wahr ist was taugt, was mir/uns nützlich ist, womit wir zurechtkommen“ (Terhart 1999b: 47). Im schlechtesten Fall führt dies zu einem „harmlos-fröhlichen, vordergründig toleranten Instrumentalismus“ (ebd.), bei dem die Prinzipien der Situationsbezogenheit und Authentizität die Beschränktheit des eigenen Erfahrungszirkels bewirken und Anschauung als kritisches Distanznehmen zum Gegebenen entfällt (vgl. Remme 2002: 260). Toleranz wird vom Konstruktivismus zwar mit der Idee der Aufgabe absoluter Wahrheiten begründet. Gleichzeitig wird aber auch behauptet, dass ‚Außenseiterwissen’ im Konflikt mit Bezugsgruppen meist korrigiert wird, und dass Wissen sozial verankert ist. (vgl. Siebert 2000: 72, 34, 63) Wissen, welches für die Gesamtheit nicht viabel ist, hat demnach keine Chance. Das Viabilitätskonstrukt ist damit die größte normative Schwäche des Konstruktivismus. Da dieser keine Aussage darüber macht, was der Mensch sein bzw. werden soll, kann auch z.B. sozialdarwinistisches Handeln als viabel interpretiert werden. (vgl. Diesbergen 1998: 234, 255-256) Nach Berzbach (2005: 187) gerät die konstruktivistische Pädagogik deshalb - über die Absage an allgemeingültige Normen - in eine ‚Ethikfalle’. Weil die Pädagogik der Normen bedarf, werden diese versteckt und nicht thematisiert und damit letztlich beliebig. Und wenn nach von Glaserfeld der Lehrer „die Umwelt eines Schülers so zu verändern [hat, C.K.], dass dieser möglichst jene kognitiven Strukturen aufbaut, die der Lehrer ihm vermitteln möchte“ (Glaserfeld, zit. n. Diesbergen 1998: 243), ist die Tatsache der Beeinflussung durch Fremde doch wieder gegeben. Die Instruktion wird quasi über die vom Lehrenden nur richtig gesetzten Pertubationen von hintenherum wieder eingeführt. Zumal Strukturdeterminiertheit nicht die komplette Aufgabe der Steuerbarkeit bedeutet. Beeinflussung ist bei ausreichender Kenntnis der Struktur nach wie vor möglich (vgl. Diesbergen 1998: 254). Und gerade letzteres ist nun einmal eines der Kerngeschäfte der Erziehungswissenschaft und Pädagogik. So wird auch die einseitige individuell-psychologische Ausrichtung des Konstruktivismus kritisiert, der damit gesellschaftlich-soziale und politische Aspekte nicht berücksichtigt und deren Widersprüche, Zwänge und Ungereimtheiten in die Konstruktionen des Individuums verlagert (vgl. Diesbergen 1998: 249). Das wird noch einmal am Postulat der Nicht-Verantwortlichkeit der Erziehenden für das, was der Erziehende tut, deutlich (vgl. Siebert 2000: 77). Theoretisch-ideologisch soll dies die Lehrenden entlasten. Praktisch können diese aber nicht von den empirisch-realen Zwängen absehen, nach denen sie sehr wohl für die Ergebnisse ihrer erzieherischen Arbeit verantwortlich sind.
Vielfach wird der Konstruktivismus als formale Bildungstheorie genutzt bzw. als reine Methode. Gerade im Übergang von der Reflexions- zur Operationsebene erfolgt dann eine deutliche Abschwächung der Radikalität des Konstruktivismus, wie Terhart (1999a: 645) feststellt. Damit ist ihr aber auch das neue genommen, und lediglich alt bekannte methodische Formen des Lernens werden mit neuen Begriffen belegt (vgl. ebd.). Allerdings sind die Begriffe in der Lage, die Importdisziplin (d.h. die Erziehungswissenschaft) entscheidend zu verändern und zu beeinflussen: „Mit neuen Begriffen können ohne dem Rezipienten bewusst zu sein, andere Welt- und Menschenbilder, methodologische oder moralische Vorstellungen in eine Disziplin eingeführt werden“ (Remme 2002: 252). So besteht die Gefahr, dass mit diesen Begriffen das normfreie Weltbild des Konstruktivismus unreflektiert importiert wird bzw. die eigenen Normen dahinter versteckt werden.
2.2 Bildung und Pflege
Das Thema Bildung - verstanden als über eine reine Berufsqualifizierung hinausgehende und auf berufliche Mündigkeit gerichtete Persönlichkeitsbildung - hat innerhalb der Pflegeausbildungen im 20. Jahrhundert lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Dieser Umstand lässt sich vor allem auf historisch-ideologische Gründe und die Sonderstellung der Pflegeausbildungen im Hinblick auf das Duale System der Berufsausbildung zurückführen.
Als im frühen 19. Jahrhundert die Medizin begann, sich an den Naturwissenschaften zu orientieren, und dadurch die divergierenden Menschenbilder und Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit in ein einheitliches, rein naturwissenschaftliches Paradigma überführt worden sind, begann sie bisher beispiellose Erfolge zu erzielen (vgl. Rothschuh 1978; Ertl-Schmuck 2000: 95-99). Mit diesem Erfolg wurden die akademisch ausgebildeten Ärzte zu Experten für Diagnose und Therapie und zur bestimmenden Berufsgruppe in den Krankenhäusern, welche vorher nur auf Versorgung und Verwahrung ausgerichtet waren (vgl. Ertl-Schmuck 2000: 101). Dies führte gleichzeitig auch zu einem Interesse der Ärzteschaft an qualifizierten Pflegekräften, die in der Lage waren, die erforderlichen Daten (Symptome) am kranken Menschen zu erheben und den Behandlungserfolg zu sichern (vgl. Wittneben 2003b: 21-22; Ertl-Schmuck 2000: 103). Die Ausbildung der Pflegekräfte hatte sich von nun an zwei Polen zu orientieren: der Medizin und der bisher gültigen christlichen Tradition. So wurde zwar eine verbesserte Ausbildung ärztlicherseits angestrebt, um medizinische Erfolge zu sichern und die Ärzte von der reinen Symptomerhebung für andere Aufgaben freizusetzen. Die christliche Tradition der Berufung und Aufopferung wurde aber bewahrt, und der nun bürgerliche Frauenberuf ausgerichtet am Ideal der unbezahlten Liebestätigkeit, der Wohl und Zufriedenheit des kranken Menschen Belohnung genug sei (vgl. Ertl-Schmuck 2000: 103). Damit entwickelte sich ein Widerspruch, den die Pflegekräfte zu bewältigen hatten, ohne das er reflektierend in die Ausbildung mit aufgenommen wurde. Das naturwissenschaftliche Paradigma der Medizin hat die mittelalterliche ganzheitliche Betrachtung des Menschen aufgegeben, die auch die Umgebungsbedingungen sowie die Lebensweise des kranken Menschen berücksichtigte (vgl. Wittneben 2003b: 1516). Krankheit wurde nun als rein somatisches Phänomen aufgefasst, welches sich über die Gesetzte der Natur (aus Physik, Chemie etc.) erfassen und beeinflussen ließ (vgl. Rotschuh 1978). Die zunehmende Spezialisierung und Technisierung, die mit dieser Sichtweise einherging, führte dazu, dass die Pflegekräfte verstärkt medizinische Assistenzaufgaben zu übernehmen hatten. Zugleich wurde aber auch von ihnen verlangt, die mit der naturwissenschaftlichen Medizin aufgegebene menschliche Zuwendung zum Patienten quasi nebenher zu leisten. Da diese einfühlende Zuwendung als genetisch mitgegebene weibliche Fähigkeit verstanden und stillschweigend vorausgesetzt wurde, sah man auch kein Bedarf für eine gezielte Ausbildung psychosozialer Fähigkeiten. Die hieraus entstehende emotionale Überforderung wurde lange Zeit nicht thematisiert. (vgl. Ertl-Schmuck 2000: 106107)
Eine Integration in das öffentliche Duale System der Berufsausbildung wurde ebenso durch solche ideologischen Implikationen lange verhindert. So sahen vor allem Kirchenvertreter die christliche Krankenpflege in Gefahr. Aber auch die Mehrheit der Pflegeorganisationen – kirchlich und nicht-kirchlich – lehnte die Integration ins Bildungssystem ab, womit im Krankenpflegegesetz von 1985 die Anwendung des Berufsbildungsgesetzes und damit ein formeller Anspruch auf allgemeine Bildung explizit ausgeschlossen wurde.[28] Damit fühlte sich die wissenschaftliche Disziplin der Berufspädagogik weiterhin nicht für diesen Bereich zuständig. (vgl. Ingwersen 2003: 36-37)
Diese Umstände sowie das Fehlen einer etablierten Pflegewissenschaft und –pädagogik führte zu einer Berufsausbildung, die geprägt war durch unreflektierte Übernahme von Routinen und Rezeptwissen sowie durch Fremdbestimmung und Anpassung. Die thematische Ausbildungsstruktur wurde bestimmt von der medizin-orientierten und arztabhängigen Pflegepraxis sowie pflegerisch-tradiertem Erfahrungswissen, und die Berufserziehung insgesamt war ausgerichtet auf die Unterordnung unter die Krankenhausmachtverhältnisse. Die pragmatisch festgelegten Inhalte, die ohne eine wissenschaftsorientierte pädagogische Ausrichtung gelehrt wurden, waren geprägt von Zufälligkeiten, Begrenzungen und den funktionalen Stationsanforderungen. Ohne eine schulische Möglichkeit der Reflexion über das eigene praktische Handeln, führte dies zu einem affirmativen Handeln, Fremdbestimmung und Instrumentalisierung durch die Institution Krankenhaus. (vgl. Ertl-Schmuck 2001: 103-111)
Erst seit sich Ende der 1980er bzw. Anfang der 1990er Jahre eine auf Hochschulebene angesiedelte wissenschaftliche Disziplin der Pflegewissenschaft und Pflegepädagogik[29] bildet und etabliert, werden diese Zusammenhänge gezielt reflektiert. Mit als eine der ersten kritisiert Wittneben (2003b) auf wissenschaftlichem Niveau Anfang der 1990er diese Situation. Sie versucht zum einem das in den 1970er Jahren aufgekommene Konzept der Patientenorientierung, welches sich gegen inhumane Tendenzen einer einseitig krankheits- und organzentrierten Medizin und Krankenhausorganisation wendete (vgl. Ertl-Schmuck 2000: 130), begrifflich zu explizieren und über das darüber gewonnene erweiterte Pflegeverständnis die Qualität der Pflege zu verbessern. Vermittelt werden sollte dieses Pflegeverständnis über die Fachdidaktik. Mit der These, dass die Fachdidaktik einerseits an den Ansprüchen der Pflegewissenschaft und andererseits an denen der Auszubildenden orientiert ist, holte sie die Pädagogik und den Bildungsgedanken in die Pflegeausbildung herein. (vgl. Wittneben 2003b: 178-232) An Herwig Blankertz anknüpfend, verstand sie die Krankenpflege nicht nur als Ausbildungs- sondern auch als ‚Bildungsfach’: „Eine gute Pflege kann persönlichkeitsbildend sein, wie auch eine vertiefte Persönlichkeitsbildung einer guten Pflege förderlich sein kann“ (ebd.: 234). Bildungstheoretisch hat sie sich an Wolfgang Klafkis – paradigmatisch in der kritischen Theorie verorteten - kritisch-konstruktiven Didaktik orientiert, womit sie explizit gesellschaftliche Zusammenhänge[30] kritisch in den Blick nimmt:
„Ein Begriff von Bildung, wird hier also nicht als ein individueller Selbstzweck entwickelt und verwirklicht, sondern seine theoretische Entfaltung und seine praktische Verwirklichung weisen immer schon über den zu bildenden/sich bildenden Menschen hinaus auf gesellschaftliche Prozesse hin. Das ist auch die zentrale Intention einer hier und später weiter zu entfaltenden kritisch-konstruktiven Pflegedidaktik.“
(Wittneben 2003b: 196)
So will sie die Auszubildenden über einen rationalen „Aufklärungs- bzw. Bildungsprozess“ stark machen gegen die Vereinnahmungen einer traditionell eingefahrenen und ideologisch auf Unterordnung und Integration ausgerichteten Praxis und im Interesse der Gepflegten und Pflegenden die Ausbildungs- und schließlich die Pflegequalität verbessern (vgl. ebd.: 184).
Es sind aber nicht nur restriktive gesellschaftliche und institutionelle Anforderungen an die Pflegenden, die eine bildungstheoretisch fundierte Pflegausbildung erfordern. Ebenso machen das Gesundheitssystem betreffende gesamtgesellschaftliche Umbruchphänomene ein erweitertes Bildungsverständnis nötig. Der demographische Wandel mit einem wachsenden Anteil älterer und hochbetagter Menschen, der Wechsel von Krankheitspanoramen zu vermehrt chronischen und multiplen Erkrankungen, die Zunahme komplizierter und komplexer medizinisch-technischer Möglichkeiten, die Abnahme traditioneller Familienstrukturen mit resultierenden fehlenden Betreuungsfunktionen sowie die diesen Herausforderungen konträr entgegenstehenden und immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen, die zum Teil eine Verlagerung pflegerischer Betreuung in den ambulanten Sektor bedingen (vgl. Ertl-Schmuck 2000: 125-126), bedürfen einer Pflegausbildung, die die Auszubildenden befähigt, diese Herausforderungen in ihrer täglichen Arbeit selbstverantwortlich zu bewältigen. Eine lediglich verrichtungs- und krankheitsorientierte sowie an den Handlungsanweisungen eines beaufsichtigenden Mediziners orientierte Krankenpflege reicht dazu nicht mehr aus (vgl. Wittneben 2003b: 14-32). Es bedarf vielmehr Ausbildungskonzepte, die den Auszubildenden die notwendigen (Schlüssel-) Qualifikationen vermitteln, die sie befähigen autonom und kompetent in dieser Situation zu agieren. So finden sich in der pflegepädagogischen Literatur mittlerweile zahlreiche Konzepte mit Aufzählungen pflegerelevanter (Schlüssel-) Qualifikationen.[31] Beispielhaft sei hier zuerst ein stark qualifikationsorientiertes Konzept zitiert:
„Kenntnisse der kooperativen Betreuung sowie der Kooperation zwischen professionellen und informellen Helfern
Grundsätze der Teamarbeit innerhalb der gleichen Berufsgruppe und Einrichtung sowie der
intersektoralen und interdisziplinären Kooperation Grundsätze der Teamarbeit in einem multidisziplinären Team
Arbeitsteilung (mit andern Helfern, Diensten, den Klienten und informellen Helfern) bei Wahrung eigener Berufsidentität
[...]
[1] Vgl. KrPflG §3 und Anlage 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (KrPflAPrV).
[2] Vgl. Wittneben 2003a, 2003b, 2005; Panke-Kochinke 2003, 2005; Schneider u.a. 2004; Bischoff-Wanner 2004; Greb 2002, 2003, 2004b, 2005b; Darmann 2005.
[3] Vgl. ganz aktuell die Arbeit von Regina Keuchel (2005b). Deren Ergebnisse konnten leider nicht mehr systematisch in die vorliegende Arbeit eingebracht werden. Keuchel begründet in einem ausgreifenden Rahmen den Bildungsbedarf der Pflege und entwickelt ein Konzept allgemeiner beruflicher Bildung, welches im Kontext professioneller Bildungsarbeit in der Pflege vermittelt werden soll. Soweit ich das überblicken kann, kommt sie aber nicht zu gravierend abweichenden Ergebnissen. Ihre Erkenntnisse münden schließlich in ein Gesamtkonzept innovativer Lernkulturen.
[4] Strukturfunktionale Ansätze, wie z.B. die Theorie des amerikanischen Soziologen Talcott Parsons, untersuchen den Beitrag gesellschaftlicher Teilbereiche (wie z.B. der Schule) für das gesamtgesellschaftliche System (vgl. Tillmann 2001: 115). Das Interesse richtet sich dabei vor allem auf die Bedingungen von Stabilität in sozialen Systemen, also darauf was die besagte Struktur für den Erhalt des Systems leistet (vgl. ebd.: 118).
[5] Qualifikation für gesellschaftliche Aufgaben, Selektion zur Verteilung auf unterschiedliche berufliche Positionen sowie Legitimation der bestehenden Gesellschaft und Integration in diese (vgl. Tillmann 2001: 126-130).
[6] Für Weniger galt es, Bildung danach zu bestimmen, was als Bildung in der jeweiligen historischen Situation von der Gesellschaft ausgehandelt wird und nicht aus philosophischen oder pädagogischen Normen abzuleiten. Er sah die partikularen gesellschaftlichen Interessen (Staat, Kirche, Wissenschaft etc.) um ihre Repräsentanz im nationalen Lehrplan ‚kämpfen’, d.h. um ihren Einfluss auf die Erziehung. Zielt Bildung auf Weltbewältigung und Personwerdung der jungen Menschen, muss die Pädagogik die Lagerung dieser konkurrierenden Interessen entsprechend ausdrücken und divergierende Bildungsideale in einer in sich stimmigen Intentionalität zusammenfassen. (vgl. Blankertz 1986: 28-50, Langewand 1997: 87-88)
[7] Andere didaktische Modelle, denen diese Ziel- und Orientierungskategorie fehlt, müssen sich dagegen häufig vorwerfen lassen, rein instrumentalistisch ausgelegt werden zu können. So z.B. ein Modell, welches allein auf dem Lernbegriff aufbaut. Wird nämlich Lernen als einziger Zweck sowie als einziges Ziel pädagogischer Maßnahmen aufgefasst, besteht immer auch die Gefahr, dass außerpädagogische Zwecke - wie etwa Qualifikationsansprüche der Wirtschaft - die Überhand gewinnen und die pädagogischen Maßnahmen somit nur noch der technologischen Durchsetzung dieser außerpädagogischen Intentionen dienen. Pädagogik wäre damit ausschließlich auf ein Instrument gesellschaftlich vorgegebener Zwecke und Ziele reduziert. (vgl. Blankertz 1986: 115-116)
[8] So ist Bildung nie nur auf Fähigkeiten bezogen, sondern immer auch auf die Inhalte, an denen diese vermittelt werden (vgl. auch unter 2.6: die Schlüsselqualifikationen). Der Stellenwert der Inhalte wird deutlich, wenn man sich vorstellt, dass z.B. rhetorische Fähigkeiten allein an Reden von Adolf Hitler vermittelt würden. Man kann sicherlich viel in dieser Hinsicht lernen, aber auch die inhaltliche Aussage seiner Reden hätte eine Wirkung, die auf keinen Fall vernachlässigt werden darf.
[9] So nimmt Blankertz (1986: 28-50) Klafkis Didaktik als Beispiel für bildungstheoretische Modelle. Ebenso Kron (2004: 74-92), der Klafkis Bildungsbegriff als „exemplarisch für alle anderen Auffassungen“ (ebd.: 74) sieht.
[10] Sein erstes didaktisches Modell entwirft er in den frühen 1960er Jahren und erweitert dieses später, in den 1980er- Jahren, um eine gesellschaftskritische Perspektive (vgl. Jank, Meyer 2002: 206 und unter Punkt 2.1.5).
[11] Aus Sicht der Berufsbildung ist in diesem Zusammenhang insbesondere wichtig, dass eine Unterscheidung von Bildungsgütern mit formalen Bildungswert hinsichtlich aller Kräfte des Menschen (z.B. Latein, Englisch, Musik) und Bildungsgütern mit formalem Bildungswert hinsichtlich einzelner spezialisierter Fähigkeiten (z.B. Wirtschaftskunde oder Technologie), nicht mehr zeitgemäß ist. Formale Bildung ist immer nur als Ertrag einzelner, besonderer Inhalte zu sehen. (vgl. Ingwersen 2003: 26-27)
[12] Das war die formale Seite neuhumanistischer Bildung.
[13] Damit ist die materiale Seite bestimmt worden; in der ‚Theorie des Klassischen’. Das Ideal der ‚Humanität’ sollte in den klassischen Werken antizipiert werden und dem empirischen Menschen damit die Möglichkeit geben, eine über ihn hinausweisende und ihm doch innerlich verbundene Norm zu setzen. Durch das Studium der Griechen sollte der Mensch erfahren, was Menschsein eigentlich bedeutete. (vgl. Blankertz 1982: 103)
[14] Im 19. Jahrhundert wurde ein System von Berechtigungen etabliert, welches über den sozialen Aufstieg bestimmte. So z.B. die gymnasiale Reifeprüfung, das Universitätsstudium, der einjährig-freiwillige Militärdienst. Diese Berechtigungen waren notwendig, um z.B. in die höhere Beamtenlaufbahn zu gelangen. Dadurch konnte sich zwar das Bürgertum gegen die Adelsherrschaft wehren. Gleichzeitig wurde es aber auch als Ausschlussinstrument gegen die mit der Industrialisierung aufgetretene Arbeiterschaft genutzt. Der Zugang der Arbeiterschaft zu Schul- und Ausbildungsgängen konnte von den Besitzenden, da sie die politische Macht hatten, leicht manipuliert werden. (vgl Blankertz 1982: 181-186)
[15] Der eigentliche Begriff ‚Berufsschule’ wurde erst später geprägt, auf der Reichsschulkonferenz von 1920 (vgl. Blankertz 1982: 246).
[16] Das heißt die Bildung wird nicht um ihrer selbst willen erworben, sondern lediglich um sie gegen beruflichen Aufstieg etc. einzutauschen.
[17] Nämlich Bewältigung einer bestehenden Ordnung und antizipierten Zukunft und Personwerdung in dieser. Klafkis erster Entwurf steht noch ganz in der geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Tradition Erich Wenigers (vgl. S. 8, FN. 6).
[18] „Dabei wird Bildung jetzt ‚als Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung, die die Emanzipation von Fremdbestimmung voraussetzt oder einschließt, als Befähigung zur Autonomie, zur Freiheit eigenen Denkens und eigener moralsicher Entscheidung’ verstanden.“ (Klafki, zit. n. Kron 2004: 85)
[19] „Allgemeinbildung bedeutet in dieser Hinsicht, ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der Gegenwart und – soweit voraussehbar – der Zukunft zu gewinnen, Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher Probleme und Bereitschaft, an ihrer Bewältigung mitzuwirken. Abkürzend kann man von der Konzentration auf epochaltypische Schlüsselprobleme unserer Gegenwart und der vermutlichen Zukunft sprechen.“ (Klafki 1996: 56)
[20] In der Pflegepädagogik ist vorwiegend seine kritisch-konstruktive Bildungstheorie rezipiert worden. Deshalb wird sie hier ausführlicher dargestellt (vgl. unten: 2.2).
[21] Nochmal präzise: Qualifikation meint die objektive, gesellschaftliche Seite und Kompetenz die subjektive Seite, d.h. das, was der einzelne kann und weiß.
[22] Das Originalzitat lautet „ die Rückbildung dieser Fachkompetenzen an eine humane und politische Bildung“ (Deutscher Bildungsrat 1974: 55) . Ich vermute Rück bildung ist ein Druckfehler und meint tatsächlich Rück bindung. Dies erscheint mir zumindest sinnvoller.
[23] So kann z.B. die viel erwähnte Schlüsselqualifikation ‚Kritikfähigkeit’ rein methodisch ausgelegt werden, d.h. im Sinne eines ‚richtigen’ Vorgehens beim Geben und Nehmen von Kritik. Inhaltlich bleibt so eine ‚Methode’ dann leer. Werden wichtige moralische und soziale Aspekte nicht weiter berücksichtigt, dann rückt diese gelehrte Kritikfähigkeit eher in Richtung einer reinen Arbeitsqualifikation ohne Mündigkeitsaspekt. Klafki (1996: 74-75) spricht von Sekundärtugenden und instrumentellen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die „als solche nichts über ihre begründbare, verantwortbare Verwendung sagen“ (ebd.: 74). Sie sollten deshalb immer im Zusammenhang mit emanzipatorischen Zielsetzungen, Inhalten und Fähigkeiten erlernt werden und nicht losgelöst von begründbaren, humanen und demokratischen Prinzipien (vgl. ebd.: 75).
[24] Der Konstruktivismus ist kein komplett geschlossenes und widerspruchsfreies Theoriegebäude sondern vielmehr eine unterschiedliche Ansätze zusammenbringende „philosophisch-erkenntnistheoretische Baustelle“ (Jank, Meyer 2002: 289). So gehen die erkenntnistheoretischen Grundannahmen schon zurück auf Kant, der feststellte, dass der Mensch der Natur eine Ordnung gibt und nicht so erkennt, wie sie ‚wirklich’ ist (vgl. Siebert 2000: 11). Ein ausschlaggebendes Werk im 20. Jahrhundert war dann das Buch Der Baum der Erkenntnis (1987) der chilenischen Neurobiologen Humberto Maturana und Francisco Varela, die die konstruktivistische Grundargumentation auf eine neurobiologische Grundlage stellten und deren Begrifflichkeiten Eingang in unterschiedlichste sozialwissenschaftliche (z.B. die Systemtheorie Niklas Luhmanns) und pädagogische Theorien gefunden haben (vgl. ebd.: 29-31). Einführend sei hier auf die folgenden Werke verwiesen: Jank, Meyer (2002: 286-303), Siebert (1996, 2000), Blumstengel (1998), Backes-Haase (2001). Kritisch beschäftigen sich Terhart (1999a, 1999b), Diesbergen (1998) und Remme (2002) mit dem Konstruktivismus.
[25] ‚Viabilität’ und ‚viabel’ meinen soviel wie begehbar, tauglich, möglich. Viables Wissen ist also solches, welches sich problemlos in die vorhandene Wissenskonstruktion einfügt. (vgl. Jank, Meyer 2002: 291)
[26] Pertubation lässt sich übersetzen mit ‚Störung’.
[27] Diesbergen (1998: 70-75) spricht von ‚Feindbildern’ des Konstruktivismus.
[28] Auch im aktuellen Krankenpflegegesetz von 2004 wird die Anwendung des Berufsbildungsgesetztes explizit ausgeschlossen wird (vgl. § 22 KrPflG: Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes).
[29] Vgl. für einen Überblick über pflegedidaktische Entwürfe der späten 1980er und 1990er Jahre: Ertl-Schmuck 2003.
[30] „Soweit mir zugänglich und erkennbar, wird diese Arbeit von einem Interesse an der Vermenschlichung der Gesellschaft geleitet. Im engeren Sinne ist dieses Interesse auf die Humanisierung der Krankenpflege gerichtet“ schreibt Wittneben in ihrer Einführung (vgl. 2003b: 1). Problematisch bleibt, dass ihr Modell eines erweiterten Pflegeverständnisses institutionelle und gesellschaftliche Verhältnisse gar nicht in den Blick bekommt, da es in seinen Dimensionen beschränkt bleibt auf die pflegerische Interaktion (vgl. Ertl-Schmuck 2001: 124). Es verwundert allerdings, dass Wittneben dies selber sehr früh thematisiert (vgl. Wittneben 1993: 207), bis heute aber nichts daran geändert hat, und ihrem Modell trotzdem eine ‚Suchfunktion’ für das Auffinden von Inhalten zur Konstruktion von Lernfeldern zuspricht. So sollen neben den thematisierten auch die außerhalb der Typologie der multidimensionalen Patientenorientierung liegenden Inhalte damit gefunden werden. (vgl. Wittneben 2003b: 292) Meines Erachtens kann hieraus nur Beliebigkeit und Zufälligkeit für letztere entstehen.
[31] Vgl. z.B. auch Oelke 2001, Falk 2003, Ertl-Schmuck 2000: 275-277, Ertl-Schmuck 2002.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Lernfeldansatz in der Pflegeausbildung?
Der Lernfeldansatz ist ein curriculares Strukturprinzip der KMK, das den Unterricht an beruflichen Handlungsfeldern statt an klassischen Schulfächern orientiert.
Welche pflegedidaktischen Ansätze werden in der Arbeit analysiert?
Es werden die Ansätze von Ingrid Darmann (pflegedidaktische Heuristik), Ulrike Greb (Strukturgitter Fachdidaktik) und Kordula Schneider/Hannelore Muster-Wäbs untersucht.
Warum ist die bildungstheoretische Fundierung in der Pflege wichtig?
Sie stellt sicher, dass die Ausbildung nicht nur rein funktionale Fertigkeiten vermittelt, sondern die Entwicklung einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz und Persönlichkeitsbildung fördert.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus im Lernfeldansatz?
Der Konstruktivismus dient als implizites bildungstheoretisches Paradigma, bei dem Lernen als aktiver Aufbau von Wissen durch den Lernenden in authentischen Situationen verstanden wird.
Was kritisiert die Pflegepädagogik am KMK-Lernfeldkonzept?
Kritisiert werden oft die unpräzisen didaktischen Postulate und die Gefahr, dass der Bildungsauftrag zugunsten einer rein ökonomischen Funktionsorientierung vernachlässigt wird.
- Quote paper
- Christian Krebs (Author), 2005, Zur bildungstheoretischen Fundierung des Lernfeldansatzes in der Pflegeausbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136989