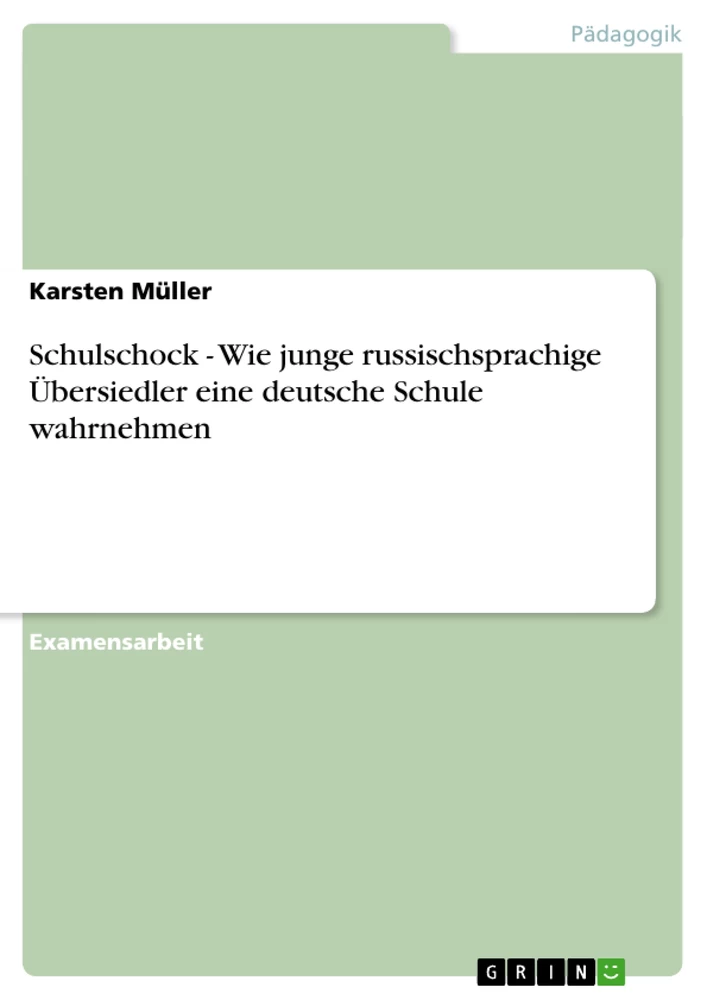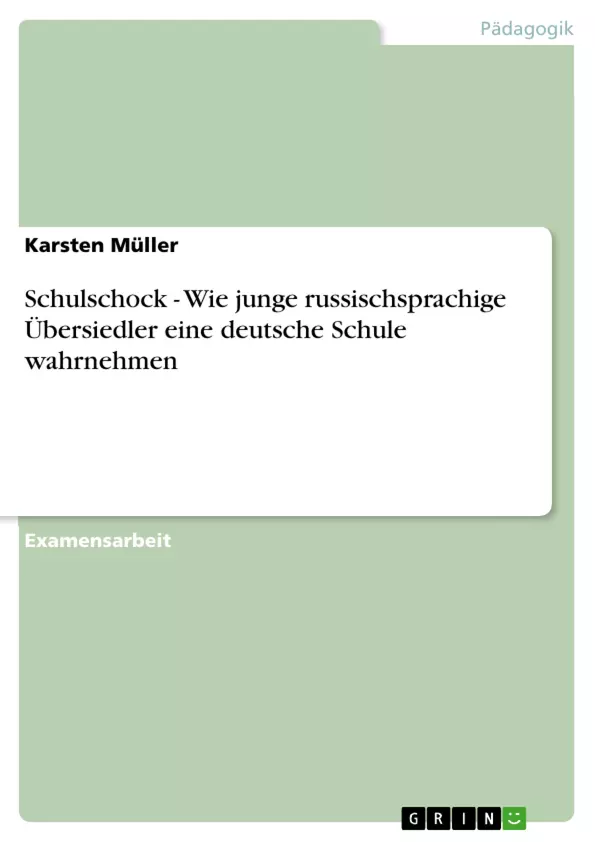„Was sind das eigentlich für Leute? Russen, Deutsche, Kasachen ...?“ „Warum kapseln die sich so ab?“ „Warum sind die so aufsässig?“ Dies sind Fragen, die Lehrer sich im Umgang mit russischsprachigen Schülern und Schülerinnen häufig stellen. Dies weist auf zwei Probleme hin: Zum einen besteht bei den Lehrern ein Informationsdefizit. Obwohl an deutschen Schulen nun schon fast zwei Jahrzehnte verstärkt Übersiedler aus der GUS unterrichtet werden, scheint zumindest ein Teil der Lehrer sich nur wenig mit deren biografischen Voraussetzungen auseinandergesetzt zu haben. Die vielen Fragen von Lehrern zeigen zum anderen einen offensichtlichen Informationsbedarf. Unter diesen beiden Prämissen – Informationsbedarf und Informationsdefizit – wurde diese Arbeit verfasst. Präsentiert werden die Ergebnisse einer Untersuchung, die erforschte, wie russischsprachige Übersiedler ihre Situation an einer deutschen Schule wahrnehmen.
Obwohl national und kulturell höchst unterschiedlich geprägt, finden sich bei den untersuchten Schülern deutliche Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel das durchlaufene, relativ einheitliche sowjetische oder postsowjetische Schulsystem. Dieses prägte entscheidend die Wahrnehmung der deutschen Schule durch die jungen Übersiedler.
Eine schwierige Frage ist die, wie sich die Übersiedler selbst definieren. Daher wird u. a. untersucht, welchen Nationalitäten sich die Respondenten zuordnen. Die verschiedenen Bedingungen, die das unterschiedliche Nationalbewusstsein in den Herkunftsländern der Übersiedler prägen und definieren, werden ausführlich dargestellt.
Die deutsche Sprache stellt an der Schule eines der größten Probleme für die Übersiedler dar. Das Kapitel „Sprachverwirrung ...“ untersucht daher die sprachlichen Voraussetzungen, unter denen die Übersiedler nach Deutschland kommen sowie die Bedingungen, unter denen sie hier die deutsche Sprache erlernen sollen.
Die Beschreibung der Wahrnehmung der deutschen Schule in Kapitel „Die Schule hier ist doch ein Kindergarten!“ bildet den Schwerpunkt dieses Buches. Hier wird die schulische Vergangenheit der Übersiedler sowie ihre Grundeinstellung gegenüber der Schule dargestellt. Im Anschluss wird die allgemeine Wahrnehmung der deutschen Schule sowie die Einstellung zu Lehrern und verschiedenen Schülergruppen eingehend untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen
- 2.1 Deutsche
- 2.2 Ausländer
- 2.3 Übersiedler
- 2.3.1 Kontingentflüchtlinge
- 2.3.2 Aussiedler
- 2.3.3 Russen und andere
- 3 Das „Geno“ – Ein ganz besonderes Gymnasium
- 4 Numerische Fakten
- 5 Das Identitätsproblem – Deutscher, Russe, Jude oder Kasache?
- 6 Sprachverwirrung – Welche Sprachen sprechen die Übersiedler?
- 6.1 Sprachliche Voraussetzungen
- 6.2 Die Sprachsituation in Deutschland
- 6.3 Warum sprechen sie Russisch?
- 6.4 Auswege aus der sprachlichen Sackgasse?
- 7 Die Schule hier ist doch ein Kindergarten!
- 7.1 Der schulische Hintergrund der Übersiedler
- 7.2 Allgemeine Einstellung zur Schule und Erwartungen an die Schule
- 7.3 Schule in den Augen der Übersiedler
- 7.3.1 Leistungsanforderungen
- 7.3.2 Lehrbücher und der Umgang mit ihnen
- 7.3.3 Außerschulisches Angebot
- 7.3.4 Ist der Übergang in die deutsche Schule zu erleichtern? – Schlüsse aus der Analyse der Schulwahrnehmung durch die Übersiedler
- 7.4 Lehrer in den Augen der Übersiedler
- 7.4.1 Unterrichtsstil
- 7.4.2 Verbales Lehrerverhalten
- 7.4.3 Nonverbales Lehrerverhalten
- 7.4.4 Spezielles Verhalten der Lehrer gegenüber Übersiedlern
- 7.4.5 Müssen sich die deutschen Lehrer anpassen? – Schlüsse aus der Analyse der Lehrerwahrnehmung durch die Übersiedler
- 7.5 Mitschüler in den Augen der Übersiedler
- 7.5.1 Übersiedler unter sich
- 7.5.2 „Russen“ und „Deutsche“
- 7.5.3 „Russen“ und „Türken“
- 7.5.4 Mögliche Wege zu einem besseren interkulturellen Verständnis unter Schülern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Wahrnehmung der Situation russischsprachiger Übersiedler an einer deutschen Schule. Ziel ist es, ein Informationsdefizit bei den Lehrern zu beheben und Ursachen für auftretende Probleme aufzuzeigen, um das interkulturelle Verständnis zu verbessern. Die Arbeit verzichtet auf Lösungsansätze, konzentriert sich aber auf die Darstellung der Ursachen.
- Wahrnehmung der deutschen Schule durch russischsprachige Übersiedler
- Sprachliche Herausforderungen und deren Auswirkungen auf die Integration
- Nationale Identitätsfindung der Übersiedler
- Interkulturelle Beziehungen zwischen Übersiedlern, deutschen und türkischen Schülern
- Vergleich des sowjetischen/postsowjetischen und des deutschen Schulsystems
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung der Wahrnehmung russischsprachiger Übersiedler am Gymnasium Genovevastraße in Köln. Ausgehend von Fragen der Kollegen über das Verhalten der Übersiedler, untersucht die Arbeit die biografischen Hintergründe und die schulische Sozialisation der Schüler im Vergleich zum deutschen System. Ein eigens entwickelter Fragebogen wurde an 180 Schüler verteilt, ergänzt durch Interviews und persönliche Erfahrungen des Autors. Die Ergebnisse sollen in einer Lehrerinformationsveranstaltung vorgestellt werden.
2 Definitionen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Deutsche“, „Ausländer“ und „Übersiedler“ aus der Perspektive der befragten Schüler. Die Übersiedler werden in Untergruppen wie Kontingentflüchtlinge und Aussiedler differenziert, wobei die jeweilige Anzahl am Gymnasium Genovevastraße sowie die gesetzlichen Hintergründe erläutert werden.
3 Das „Geno“ – Ein ganz besonderes Gymnasium: Das Kapitel beschreibt das Gymnasium Genovevastraße in Köln-Mülheim und seine Besonderheiten. Es wird auf den hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund eingegangen und das „Aussiedlerprojekt“ mit seiner spezifischen Förderstruktur erläutert, inklusive der Besonderheiten des muttersprachlichen Russischunterrichts. Das „Türkischprojekt“ wird ebenfalls kurz beschrieben.
4 Numerische Fakten: Dieses Kapitel präsentiert demografische Daten der befragten Schüler (Alter, Geschlecht, Herkunft, Aufenthaltsdauer in Deutschland). Die Daten werden in Tabellen und Grafiken visualisiert und ihre Bedeutung für die weitere Analyse erläutert.
5 Das Identitätsproblem – Deutscher, Russe, Jude oder Kasache?: Das Kapitel befasst sich mit der nationalen Identifikation der Schüler. Es wird untersucht, wie die Schüler sich selbst definieren und welche Faktoren (Herkunftsland, Familienhintergrund, Assimilation) diese Identifikation beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen eine vielfältige und komplexe Identitätsfindung.
6 Sprachverwirrung – Welche Sprachen sprechen die Übersiedler?: Dieses Kapitel analysiert die sprachlichen Voraussetzungen der Übersiedler bei ihrer Ankunft in Deutschland und die Herausforderungen des Spracherwerbs. Es wird auf den Einfluss der sowjetischen Sprachpolitik auf die Deutschkenntnisse der Aussiedler, die Sprachsituation in den Familien und den Gebrauch von Russisch im Schulalltag eingegangen. Die Reaktionen der Lehrer auf die Verwendung von Russisch werden ebenfalls diskutiert.
7 Die Schule hier ist doch ein Kindergarten!: Dieses Kapitel bildet den Hauptteil der Arbeit und analysiert die Wahrnehmung der deutschen Schule durch die Übersiedler. Es vergleicht das sowjetische/postsowjetische Schulsystem mit dem deutschen System und beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Schulwahrnehmung (Leistungsanforderungen, Lehrbücher, außerschulisches Angebot, Lehrer-Schüler-Beziehung, Beziehungen zwischen Schülergruppen). Die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erwartungen werden detailliert beschrieben und analysiert.
Schlüsselwörter
Russischsprachige Übersiedler, interkulturelles Verständnis, deutsche Schule, Sprachverwirrung, Identitätsproblem, Integration, Schulsystemvergleich (GUS/Deutschland), Lehrer-Schüler-Beziehung, Schülergruppenbeziehungen, Sozialisation, Assimilation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wahrnehmung russischsprachiger Übersiedler an einer deutschen Schule
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Wahrnehmung der Situation russischsprachiger Übersiedler an einer deutschen Schule, insbesondere am Gymnasium Genovevastraße in Köln. Sie konzentriert sich auf die Darstellung der Ursachen von Problemen, die durch die unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergründe entstehen, und verzichtet auf konkrete Lösungsansätze.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung. Es wurde ein eigens entwickelter Fragebogen an 180 Schüler verteilt, ergänzt durch Interviews und persönliche Erfahrungen des Autors. Die Ergebnisse sollen in einer Lehrerinformationsveranstaltung präsentiert werden.
Welche Definitionen werden verwendet?
Die Arbeit definiert die Begriffe „Deutsche“, „Ausländer“ und „Übersiedler“ aus der Perspektive der befragten Schüler. Die Übersiedler werden in Untergruppen wie Kontingentflüchtlinge und Aussiedler differenziert, unter Berücksichtigung der jeweiligen Anzahl am Gymnasium und der gesetzlichen Hintergründe.
Welche Aspekte des Gymnasiums Genovevastraße werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt das Gymnasium Genovevastraße, seinen hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund und das „Aussiedlerprojekt“ mit seiner spezifischen Förderstruktur, inklusive des muttersprachlichen Russischunterrichts. Das „Türkischprojekt“ wird ebenfalls kurz erwähnt.
Welche demografischen Daten werden präsentiert?
Demografische Daten der befragten Schüler (Alter, Geschlecht, Herkunft, Aufenthaltsdauer in Deutschland) werden in Tabellen und Grafiken visualisiert und ihre Bedeutung für die weitere Analyse erläutert.
Wie wird das Identitätsproblem der Schüler behandelt?
Die Arbeit untersucht die nationale Identifikation der Schüler, wie sie sich selbst definieren und welche Faktoren (Herkunftsland, Familienhintergrund, Assimilation) diese Identifikation beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen eine vielfältige und komplexe Identitätsfindung.
Wie werden die sprachlichen Herausforderungen der Übersiedler analysiert?
Die Analyse umfasst die sprachlichen Voraussetzungen der Übersiedler bei Ankunft in Deutschland, die Herausforderungen des Spracherwerbs, den Einfluss der sowjetischen Sprachpolitik, die Sprachsituation in den Familien und den Gebrauch von Russisch im Schulalltag. Die Reaktionen der Lehrer auf die Verwendung von Russisch werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird die Wahrnehmung der deutschen Schule durch die Übersiedler dargestellt?
Der Hauptteil der Arbeit analysiert die Wahrnehmung der deutschen Schule durch die Übersiedler. Es wird ein Vergleich des sowjetischen/postsowjetischen Schulsystems mit dem deutschen System durchgeführt, und verschiedene Aspekte der Schulwahrnehmung beleuchtet (Leistungsanforderungen, Lehrbücher, außerschulisches Angebot, Lehrer-Schüler-Beziehung, Beziehungen zwischen Schülergruppen).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Russischsprachige Übersiedler, interkulturelles Verständnis, deutsche Schule, Sprachverwirrung, Identitätsproblem, Integration, Schulsystemvergleich (GUS/Deutschland), Lehrer-Schüler-Beziehung, Schülergruppenbeziehungen, Sozialisation, Assimilation.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein Informationsdefizit bei den Lehrern zu beheben und Ursachen für auftretende Probleme aufzuzeigen, um das interkulturelle Verständnis zu verbessern.
- Citation du texte
- Karsten Müller (Auteur), 1999, Schulschock - Wie junge russischsprachige Übersiedler eine deutsche Schule wahrnehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137008